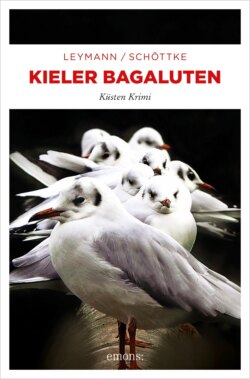Читать книгу Kieler Bagaluten - Henning Schöttke - Страница 14
Die Polizei kommt 1
ОглавлениеIch weiß jetzt natürlich nicht, wie du so drauf bist. Vielleicht gehörst du zu denen, die die überfahrene Katze vom Nachbarn im Genick packen, bei ihm klingeln und sagen würden: »Guten Tag, Herr Nachbar, ich habe Ihre Katze totgefahren, weil ich zu tief ins Eierlikörgläschen geschaut habe.« Sicher würdest du dann zumindest noch ein »Tut mir wirklich leid« hinterherschieben und betreten gucken. Aber ich will dir eins sagen: Von der Sorte gibt es nicht viele, da wärest du ein bisschen die Ausnahme.
So ist es nicht wirklich verwunderlich, dass Frau Heerten nicht zu diesen Ausnahmen gehört – aber Gott sei Dank auch nicht zur Mehrheit, die die Katze in so einem Fall kurzerhand in die nächste Mülltonne schmeißt (oder nicht mal das) und weiterfährt.
Frau Heerten hat der Katze löblicherweise ein quasi-christliches Begräbnis zukommen lassen, obwohl ich denke: Etwas übergriffig war das schon. Wer weiß, vielleicht war es eine Perserkatze oder eine gänzlich atheistische Katze, vielleicht sogar ein bisschen mit dem Teufel im Bunde, wie man es manchen Katzen nachsagt, auch wenn die dazugehörigen Hexen heute recht selten geworden sind. Na, was soll’s? Beim Begraben geht es vor allem um die Lebenden. Den Toten ist ihr Begräbnis, soweit man weiß, ziemlich egal.
Insofern alles in Ordnung mit Frau Heerten. Als sie jedoch die Katze eingebuddelt und das Kästchen ausgebuddelt hat, es sogar mit nach Hause genommen und obendrein die Ausweise darin gefunden hat, fing ich doch an, mich über sie zu wundern. Sie lebt nicht unter einer Brücke, wo man vielleicht sagen würde: So einen Pass kann ich gegen was Brauchbares eintauschen oder zukünftig selbst als Szupryczynski weiterleben. Obwohl mancher Obdachloser sich das bei einem solchen Namen sicher zweimal überlegen würde.
Frau Heerten wohnt in Suchsdorf, und da ist es eigentlich üblich, dass man bei einem so merkwürdigen Fund zur Polizei geht. Zumal sie bei sich zu Hause ein Büfett mit silbern gerahmter Ahnengalerie im Wohnzimmer stehen hat und Armleuchter an den Wänden und Kandelaber auf dem Esstisch. Solche Leute haben den Spruch »die Polizei, dein Freund und Helfer« mit der Muttermilch eingesogen. Für die ist es mehr als selbstverständlich, zur nächsten Polizeiwache zu gehen, die jetzt allerdings etwas weiter weg ist. Die Suchsdorfer Polizeistation hat wegen Personal- und Arbeitsmangels (außer Einbrüchen nix zu tun) nur noch dienstags und donnerstags zwei Stunden geöffnet. Aber wann ist für einen Rentner schon mal Dienstag oder Donnerstag? Frau Heerten müsste sich mit ihrem Fund in die Innenstadt bemühen und sagen: »Seien Sie doch so freundlich und helfen Sie mir.«
Aber siehst du, gerade die mit den Armleuchtern werden oft durch Eierlikör behindert, haben sie doch schon so viel über Marihuana gehört, das sich jahrelang in den Haaren verfängt, und befürchten, es könnte mit Eierlikör ähnlich sein.
Frau Heerten ist eine Alt-68erin. Nicht dass sie damals mit Knarre im Hosenbund rumgelaufen wäre, das nicht, aber so ein bisschen hat sie schon mitgekriegt, dass Polizisten früher Bullen hießen und weibliche Polizisten ganz gendermäßig Bulletten und dass die auch mal ganz unfreundlich sein können, von Helfer keine Spur.
Deshalb ist sie auch nicht begeistert, als tags darauf zwei Beamte in Uniform bei ihr klingeln und auch gleich mit einem Fuß in der Tür stehen.
»Tach«, sagt sie.
»Ist Ihnen doch sicher recht, wenn wir reinkommen«, sagt der Freund.
»Wegen der Nachbarn. Muss ja nicht jeder sehn, dass Sie was mit der Polizei zu tun haben«, ergänzt der Helfer.
Ist Frau Heerten aber gar nicht recht. Dabei denkt sie nicht mal an die vielen verkleideten Polizisten, die durch die Gegend laufen, sich bei einsamen alten Damen einschleimen und ihnen die Picassos von den Wänden klauen, während die Nichtsahnenden in der Küche Kaffee kochen. Sie denkt eher an die Fernsehkrimis, in denen Polizisten immer eine vermeintlich schwache Blase haben, nur mal schnell aufs Klo müssen und mit Haarbüscheln aus der Haarbürste wiederkommen. Dann wäre die Sache mit dem Eierlikör die längste Zeit ein Geheimnis gewesen.
»Um was geht’s denn?«, fragt sie, obwohl sie natürlich weiß, dass es um die Katze geht und sie die beiden deshalb besser reinlassen sollte, damit der Herr Nachbar – ach nein, inzwischen der Jürgen – nichts mitkriegt. Aber was soll sie dann machen, wenn einer der Bullen tatsächlich mal aufs Klo muss?
»Waren Sie letzten Dienstag mit Ihrem Auto unterwegs?«
»Nein«, sagt Frau Heerten, was – wie wir wissen – total gelogen ist. Dienstag war sozusagen ihr Hauptkampftag: Ahnenbeschädigung und Katzenmord unter Eierlikör-Einfluss mit anschließendem Kätzchen-Kästchen-Tausch.
Bei solch einem prompten »Nein« weiß jetzt selbst der freundlichste Freund und hilfreichste Helfer, dass das gelogen sein muss oder, vorsichtiger formuliert, nicht ganz der Wahrheit entsprechen kann. Denn mal ehrlich, die meisten Menschen wissen ja nicht mal, welcher Wochentag gerade ist. Vor allem Rentner, für die eine Woche zwar auch aus sieben Tagen besteht wie für alle anderen, aber eben aus sechs Samstagen und einem Sonntag. Dass bei all den Samstagen auch mal ein Dienstag dazwischen sein soll, können die wenigsten glauben. Deshalb kann so ein Nein erst nach reiflicher Überlegung erfolgen, in der ein Rentner lange nachdenken muss. Handelt es sich vielleicht um den Samstag, der auf den Dienstag fiel, an dem er bei der Fußpflege war, oder um den, an dem er den leckeren Braten für die nächsten drei Samstage gekauft hat, oder um den Samstag, an dem er abends immer den Krimi im Zweiten schaut? Was an Gedankenstützen in fortgeschrittenem Alter eben so anfällt.
Da macht sich Frau Heerten mit ihrem wie aus der Pistole geschossenen Nein selbstredend höchst verdächtig. Doch sie ist natürlich im Recht. Man muss sich an nichts erinnern, nur weil zwei Verkleidete an der Tür klingeln. Auch wenn sie einem zehnmal einen Ausweis unter die Nase halten, den man sowieso nicht lesen kann, weil die Lesebrille in der Küche neben der Zeitung liegt.
»Ein Anwohner hat einen dunklen Wagen gesehen, der über die alte Levensauer Hochbrücke gefahren ist. Am letzten Dienstag um einundzwanzig Uhr dreiundzwanzig. War das Ihrer?«, fragt der Helfer.
Siehst du, das meine ich. Es gibt benachbarte Schulterzucker und anwohnende Erinnerer. Suchsdorf ist voller Erinnerer. Vielleicht nicht so sehr in den Suchsdorfer Mietskasernen, wie man die Mehrfamilienhäuser oft abfällig nennt, aber in den Häuslebauer-Häusern gibt es massenhaft Erinnerer. Bei denen weicht Datenschutz gerne mal staatstragender Gesinnung und einem Wir-haben-nichts-zu-verbergen-Feeling, wenn die Ordnungshüter-Fraktion anklopft. Den Repräsentanten des Staates hilft ein Erinnerer, wo er kann, und erinnert sich. Selbst wenn es um einundzwanzig Uhr dreiundzwanzig zum Erinnern eigentlich schon zu dunkel war.
»Wer hat behauptet, dass ich um einundzwanzig Uhr dreiundzwanzig mit meinem Auto auf der Levensauer Hochbrücke war?«, fragt Frau Heerten, während sie weiterhin mit ihrem Körper den Eingang verbarrikadiert.
»Leider«, sagt der freundliche Polizist und hebt bedauernd die Schultern, »darf ich Ihnen das nicht sagen. Zeugenschutz, Sie verstehen?«
Sie versteht, aber fragt sich, was so eine Polizei eigentlich von einem will, wenn sie einem nichts sagen darf.
Die Polizei darf natürlich schon was sagen, jedoch nur in den seltensten Fällen das, was man wissen will. Jetzt sagt sie: »Letzten Dienstag ist auf der Alten Levensauer ein Unfall passiert. Dabei ist der Geschädigte mit seinem Auto über die Leitplanke geschleudert worden und zu Tode gekommen. Der Unfallverursacher ist flüchtig.«
So spricht eine Polizei, wenn sie was sagt. »Geschädigt« und »zu Tode gekommen« und »Unfallverursacher«, also ganz klar Amtsdeutsch, wie es nur Beamte beherrschen. Aber nicht, dass du denkst, die geschraubte Redeweise sei der einzige Grund, warum Polizisten Beamte sein müssen. Schon auch ein bisschen wegen Staatsgewalt und Gewaltmonopol und Schusswaffe immer im Holster und nicht im Halfter, damit keine Verwechslung mit den Sheriffs aus dem Wilden Westen aufkommen kann.
Bei der Ortsbezeichnung aber wieder ganz leger – auf der »Alten Levensauer« – und trotzdem korrekt. Denn bei den Levensauer Hochbrücken ist das Wort »Hochbrücke« nicht so wichtig wie die Frage, ob es sich um die alte oder die neue handelt. Auch wenn viele sagen würden, eine Brücke von 1984 ist nun wirklich nicht mehr das Neueste vom Neuen. Im Vergleich zu 1894, dem Entstehungsjahr der alten Brücke, ist sie natürlich doch irgendwie neuer als die alte.
Dass es sich um eine Hochbrücke handelt, kann man dagegen getrost unterschlagen. Um was sonst sollte es gehen? Das Dorf Levensau gibt es schon lange nicht mehr, und auch das Flüsschen Levensau ist seit 1784 im Eiderkanal verschwunden. Von der ganzen Levensauer Gegend ist nur der Name übrig geblieben, nämlich für zwei Brücken, und da ist es schon wichtig, ob man die eine meint oder die andere.
»Dürfen wir uns Ihren Wagen mal ansehen?«, fragt der Freund.
Frau Heerten atmet auf. »Aber natürlich, selbstverständlich«, sagt sie total freundlich und überaus hilfreich, denn sie ist total und überaus erleichtert, dass die beiden Herren Beamten nur wegen eines geschädigten Toten bei ihr geklingelt haben und nicht wegen der Katze, die sie überfahren hat. Und noch erleichterter, dass sie sie nicht reingelassen hat und die Sache mit dem Eierlikör in den Haaren nicht aufgeflogen ist, sonst hätte ihr die Staatsgewalt zu dem Katzenmord womöglich noch die Schädigung dieses Unfalltoten angehängt.
Auf dem Weg zum Wagen fällt ihr allerdings ein, dass die Katze beim Sich-überfahren-Lassen ja eine Delle ins Auto gesemmelt haben könnte, und sie denkt: Ach du Scheiße.
Die beiden Polizisten gehen vor ihrem Wagen in die Knie, leuchten ihm mit ihren Taschenlampen unter den Rock und kommen wieder hoch. Einfach so. Ohne sich abzustützen. Großartig. Diese Übung sollte sie unbedingt in ihr morgendliches Sportprogramm aufnehmen.
»Da ist nichts«, sagt der Freund.
»Bis auf die Reifen«, sagt der Helfer. »Denken Sie dran: Winterreifen nur von O bis O.«
»Wie bitte?«, fragt Frau Heerten.
»Von Oktober bis Ostern«, erklärt der Freund. »Schönen Tag noch.«
»Sollte Ihnen noch was einfallen«, lässt der Helfer wie im Fernsehkrimi vom Stapel und gibt ihr einen kopierten DIN-A5-Zettel, »lassen Sie es uns wissen.«
»Ganz herzlichen Dank auch«, sagt Frau Heerten und kann gerade noch den Impuls unterdrücken, ihnen nachzuwinken, ehe sie wieder ins Haus zurückgeht, um sich den Zettel anzusehen.
»Zeugen gesucht«, steht da neben dem Bild von einem Mann mit ziemlich großen Ohren. Und klein untendrunter sein Name: Kurt Bley. Und dann weiter: »Wer hat am Dienstag, dem 2. April den Unfall …«, bla, bla, bla, »… oder kann sachdienliche Hinweise geben?«
Da siehst du, dass in manchen Teilen der schleswig-holsteinischen Beamtenschaft das gendermäßig Korrekte noch nicht ganz angekommen ist, denn es müsste natürlich »Zeug*innen« heißen, obwohl ich zugeben muss, das hätte schon ein bisschen blöd ausgesehen.
Aber gut, dass der Unfall jetzt passiert ist, sozusagen auf den letzten Metern, denn zwei Wochen oder einen Monat später hätte es dazu gar nicht mehr kommen können, weil die Hochbrücke abgerissen werden soll und zuvor wegen Sicherungsarbeiten gesperrt werden muss. Nur dank der Fledermäuse, die seit dem Bau der Brücke ihr Winterquartier in den Widerlagern aufschlagen, musste mit den Umbaumaßnahmen gewartet werden, und der Unfall konnte durchgezogen werden.
Aha, sagst du jetzt vielleicht, schuld sind mal wieder die Umweltschützer. Dass Menschen zu Tode kommen, ist ihnen schnurz. Aber über die doppelt gepurzelte Schlappohreule und über jede dahergeflogene Fledermaus halten sie schützend ihre Hände.
Stimmt. Aber nicht ganz. Umweltverbände gaben nur den Anstoß. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt GDWS höchstselbst hat verfügt, dass nur das nördliche Widerlager der Kanalverbreiterung weichen darf. Die Fledermäuse müssen sich halt zukünftig über Winter im südlichen Brückenkopf zusammenquetschen. Tun sie auch. Nur der Große Abendsegler widersetzt sich bisher standhaft und beharrt auf seiner nördlichen Behausung. Was tun? Eine kleine Fledermaus gegen hundert Millionen Tonnen Ladung, die jährlich durch den Kanal geschoben werden. Anders als in der Bibel gewinnt diesmal Goliath, denn Berlin hat in einem Planfeststellungsverfahren der besonderen Art bestimmt, dass der Große Abendsegler entweder umziehen oder aussterben muss. Das ist bitter. Aber keine Sorge. Der Große Abendsegler ist zwar stur, aber nicht doof, wie man so hört. Er wird seine Siebensachen schon noch packen. Engagierte Suchsdorfer haben Fledermaus-Winterquartiere in ihren Gärten aufgehängt. Da kann er überwintern, bis in der neuen Brücke wieder eine Fledermausbehausung gebaut ist – extra für ihn.
Nach solcherlei Vorarbeiten steht der Abriss der Alten Levensauer für 2022 in den Startlöchern, und die Schleswig-Holsteiner drücken die Daumen, dass diesmal alles reibungslos über die Bühne geht. Nicht wie beim Abriss der Prinz-Heinrich-Brücke 1992, wo die Schlaumeier des Abrisskommandos die Last der Fachwerkkonstruktion halbe-halbe auf die Kräne verteilen wollten. Wer schon mal zu zweit ein Sofa in den obersten Stock getragen hat, weiß, dass das Quatsch ist. Der linke Kran ist denn auch eingeknickt und das Sofa – Entschuldigung, die Brücke – in den Kanal gekippt.
Wieder in der Küche, knüllt Frau Heerten den Zettel zusammen und wirft das gendermäßig inkorrekte Teil gekonnt in ihren Behälter für Altpapier.
Ja, mit ihrem Altpapier ist sie heikel. Alles, was auch nur entfernt an Papier erinnert, wandert in diesen Korb oder gleich in die blaue Tonne. Die »Kieler Nachrichten«, ganz klar: Papiertonne. Manchmal sogar fast ungelesen. Auch wenn Frau Heerten noch nicht in dem Alter ist, in dem Artikel über Weltwirtschaftskrisen und neue Bauvorhaben in der Wyk sie deutlich weniger interessieren als die Seite mit den Todesanzeigen.
Allerdings bringt allein die tägliche Zeitungsration die Tonne manchmal an ihre Grenzen. Die alten Quittungen über Cola, Batterien und all so ’n Zeug, die sie in dem gammeligen Portemonnaie von diesem Schuppidingsbums findet, passen aber todsicher noch rein. Die kann sie getrost entsorgen. Die braucht nicht mal mehr Schuppi, sollte er jemals wieder auftauchen.
Doch dann wird sie stutzig.
»Pampers x 10: 34,90 €«, steht auf einem Kassenbon. Und auf einem anderen: »Baby-Gemüsegläschen à 2,39 € x 10: 23,90 €«.
Gut, dass die Lupe noch auf dem Küchentisch liegt. In siebenfacher Vergrößerung gibt es keinen Zweifel: Schuppi hat für fast sechzig Euro Baby-Equipment eingekauft. Bei so was handelt es sich wohl kaum um ein Gastgeschenk, das man einer Angebeteten mitbringt.
Ein Lupenblick auf das Verkaufsdatum, und Frau Heerten weiß: Schuppi oder Schuppine junior müsste jetzt vier bis fünf Jahre alt sein.