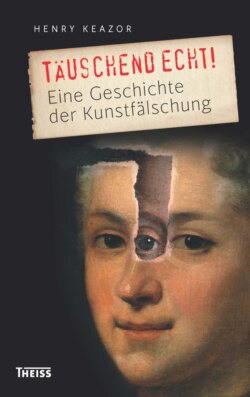Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Hyperrestaurierung
ОглавлениеEine Mischform aus diesen beiden Arten der „objektiven Verfälschung“ stellt schließlich die sogenannte Hyperrestaurierung dar – im Englischen treffend als „Restorgery“ bezeichnet, eine Zusammenziehung von „Restauration“ und „Forgery“. Dabei wird das Kunstwerk durch Überrestaurierung in einen, dem Zeitgeschmack entsprechend rekonstruierten Zustand gebracht. Indem jedoch der moderne Anteil an diesem Eingriff verwischt wird, entsteht ein irreführender Eindruck von der ursprünglichen Beschaffenheit des originalen Kunstwerks. Oft wurden und werden auf diese Weise Werke von eigentlich bescheidener Qualität „aufrestauriert“ und anschließend als vermeintliche Spitzenwerke ausgegeben.
In dieser Technik besonders hervorgetan hatte sich seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts der belgische Maler-Restaurator Jef oder Joseph van der Veken (1872–1964, ursprünglich Josephus Maria Vander Veken). Der Sohn des Inhabers eines Antwerpener Kristall- und Porzellangeschäfts begann zunächst damit, Gemälde nach Fotografien zu kopieren, freie Adaptionen von Werken Alter Meister anzufertigen und im Auftrag von Kunstinteressierten Pasticcios zu malen, wobei er sich auf die altniederländische Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts spezialisierte. Laut Tietze bedient sich die Kunstfälschung sämtlicher legitimer künstlerischer Methoden, wenn auch mit einer veränderten Zielsetzung. Das lässt sich bei van der Veken, der sich als Antiquitätenhändler niederließ, besonders gut beobachten, denn seine Kopien, Pasticcios und Stilaneignungen wurden schon bald auf dem Kunstmarkt als Originale von Malern wie Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, Hans Memling, oder Jan Mostaert verkauft.
Ab 1914 entwickelte van der Veken dann seine Methode der „Hyperrestauration“, um alte, eher unbedeutende und zudem schlecht erhaltene Bilder dadurch aufzuwerten, dass er von ihnen nur die am besten erhaltenen Partien stehen ließ, diese restaurierte und den Rest des Gemäldes in freier Erfindung „rekonstruierte“. Besonders problematisch wurde dies, als seine hyperrestaurierten Bilder ab dem Beginn der 1920er-Jahre besonders durch den aus Brügge stammenden Bankier und Mäzen Émile Renders (1872–1956) ungeahnte Verbreitung fanden. Renders besaß vor dem Zweiten Weltkrieg eine Sammlung Alter flämischer Meister, die als eine der wichtigsten Privatsammlungen weltweit erachtet wurde. Mit seiner Hilfe kaufte van der Veken nicht nur ruinierte oder weniger wertvolle, alte Bilder, die er sodann „hyperrestaurierte“, sondern er hatte in Renders auch einen regelmäßigen Abnehmer für diese „Hybride“. Über den Mäzen gelangten sie nicht nur auf den Kunstmarkt, sondern auch in Ausstellungen und gingen sogar als authentische Originale in die Forschungsliteratur ein.
Problematisch war daran vor allem zweierlei: Abgesehen davon, dass auf diese Weise Werke Eingang in die Kunstgeschichte fanden, deren Erscheinungsbild aufgrund der Eingriffe van der Vekens stark verzerrt war (die verbleibenden originalen Anteile waren zum Teil nur noch sehr gering und beschränkten sich im Extremfall auf den Bildträger), kombinierte van der Veken bei seinen freien „Rekonstruktionen“ zuweilen sehr willkürlich Vorbilder aus verschiedenen Zeiten und Kunstlandschaften. So konnte zum Beispiel durch eines der von ihm hyperrestaurierten Gemälde der irreführende Eindruck entstehen, dass es zwischen deutschen und flämischen Meistern des 15. Jahrhunderts nicht nur zu einem Kontakt, sondern sogar zu einem direkten Austausch von Motiven gekommen war. Hätte man das Bild nicht in den 1970er-Jahren als Fälschung beziehungsweise zu Beginn der 1990er-Jahre als Hyperrestaurierung van der Vekens enttarnt, hätte es zu einer bleibenden Verzerrung der kunsthistorischen Forschung geführt. Besagtes Gemälde suggerierte darüber hinaus auch, dass eine bestimmte Art der Perspektivdarstellung schon früher in der flämischen Kunst Anwendung gefunden habe, als man bis dahin angenommen hatte.
Anstatt auf die Eingriffe van der Vekens hinzuweisen, argumentierte Renders, der auch als Kunsthistoriker publizierte, sogar in Forschungsbeiträgen mit seinen hyperrestaurierten Bildern. Im Februar 1928 veröffentlichte er in der ehrwürdigen englischen Fachzeitschrift Burlington Magazine einen Aufsatz, dessen Inhalt sich angesichts der angeführten Beispiele fast wie Hohn ausnimmt. Denn in dem Cracks in Flemish Primitives (Craquelé in der frühen flämischen Malerei) betitelten Beitrag versucht er aufzuzeigen, wie man echte flämische Gemälde zuverlässig von deren Fälschungen unterscheiden kann – und als Belege dafür, wie echte flämische Bilder aussehen, verweist er auf zwei seiner hyperrestaurierten Bilder, darunter auch besagtes Werk mit den „deutschen“ Bezügen und der frühen Perspektivdarstellung. Just anhand dieser beiden Beispiele erklärt er, worauf man achten müsse, wenn man gefälschte Altersspuren wie Risse und Sprünge in der Maloberfläche von echten unterscheiden wolle. Dreist behauptet Renders sogar, es sei bis dahin keinem Fälscher gelungen, ein solches Craquelé überzeugend zu simulieren. Natürlich wusste er es besser, denn van der Veken hatte in der Zwischenzeit eine sehr raffinierte und komplexe Technik entwickelt, um selbst auf einer modernen Maloberfläche entsprechende Altersspuren zu erzeugen. Diese verstand er außerdem geschickt mit dem Originalcraquelé der alten Bildträger zu kombinieren. Indem Renders nicht nur auf seine hyperrestaurierten Gemälde mit dem gefälschten Craquelé van der Vekens verwies, sondern zudem mit Detailfotos arbeitete, die wissenschaftlichen Untersuchungen dieser Werke entstammten, sicherte er diesen natürlich einen unumstößlichen Status als Originale. Der weiteren Forschung stellte er damit ein ausgesprochen problematisches Vergleichsmaterial zur Verfügung. Es bestand die Gefahr, dass künftig zu untersuchende hyperrestaurierte Bilder mit hyperrestaurierten, aber für Originale gehaltenen Bildern verglichen würden und so die „Echtheit“ der verfälschten Werke zu Unrecht bestätigt würde.
Angesichts des Ausgangs des späteren Skandals um Han van Meegerens gefälschte Vermeer-Gemälde Ende der 40er-Jahre mutet es im Nachhinein fast wie eine Ironie an, dass Renders nach harten Verhandlungen zwischen 1940 und 1941 seine Sammlung an hyperrestaurierten Bildern früher flämischer Meister ausgerechnet an Hermann Göring verkaufte, wobei als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer just Alois Miedl, ein Vertrauter Görings, agierte, der später indirekt zur Entlarvung van Meegerens beitragen sollte, der eine seiner Vermeer-Fälschungen nämlich ebenfalls an Göring verkauft hatte (vgl. Kapitel 6).
Die Kunstgeschichte war jedoch nicht ganz so ohnmächtig, wie es zunächst scheinen mag, denn das Treiben von van der Veken und Renders wurde bereits Ende der 1920er-Jahre mit aufmerksam kritischen Blicken verfolgt und aufgedeckt, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit: 1898 hatte sich auf Betreiben des Züricher Kunsthistorikers Heinrich Angst der „Internationale Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebahren“ gegründet, dessen Mitglieder über ein eigenes Organ, die zwischen 1898 und 1939 zirkulierenden Mitt(h)eilungen des Museen-Verbandes, als Manuscript für die Mitglieder gedruckt und ausgegeben kommunizierten. In den einzelnen Ausgaben der Mitteilungen des nach seinem Mitinitiator zuweilen salopp als „Angst-Verein“ titulierten Verbandes informierten sich die Mitglieder gegenseitig über aktuelle Fälschungsfälle. Auch über Erkenntnisse zu älteren Fällen und zu sich weiter betätigenden Fälschern wurde berichtet. Um die einzelnen Fälschungen und ihre Beziehungen untereinander leichter erkennbar zu machen, wurden die Fälschungen nicht nur mit einer Archivnummer versehen, sondern auch abgebildet und häufig auch Vergleichsabbildungen der entsprechenden Originale gegenübergestellt. Leider brach diese wichtige Informationsplattform mit der Einstellung der Mitteilungen im Jahr 1939 zusammen. Mitte der 1970er-Jahre griff der damalige Leiter der Berliner Skulpturensammlungen der Staatlichen Museen und Hochschullehrer, Peter Bloch, auf den Bestand der Zeitschrift zurück und gründete auf dessen Basis ein Fälschungsarchiv. Darin wurden Presseartikel, Korrespondenzen mit Museen, Galerien und Sammlern, bibliografische Notizen sowie generell Aufzeichnungen zu bekannt gewordenen Fälschungsfällen gesammelt. Bedauerlicherweise wurde auch diese wichtige Initiative nach dem Tod Blochs im Jahr 1994 nicht weitergeführt, und das Archiv fristet heute ein halbvergessenes Dasein im Berliner Bode-Museum. Im Zuge des Falls Beltracchi startete der Bundesverband Deutscher Kunstversteigerer, dank der Initiative des Kölner Auktionators Markus Eisenbeis, 2011 eine Online-„Datenbank kritischer Werke“ (http://kunstversteigerer.msdnet.de/datenbank-kritischer-werke/datenbank-kritischer-werke/), die, wie seinerzeit die Mitteilungen, dem raschen Austausch unter Museen, Auktionshäusern und Kunsthändlern dienen soll. Letztlich haben sich Information und Transparenz immer wieder als bester Schutz gegen Fälschungen erwiesen. So hat beispielsweise der Kunsthistoriker Friedrich Winkler 1930 in der Mai-Ausgabe der Mitteilungen bereits vor den Totalfälschungen van der Vekens gewarnt, die offenbar schon seit 1913 entlarvt waren, wie auch vor dessen 1924 und 1927 in Ausstellungen als Originale gezeigten Hyperrestaurierungen.
Wünschenswert wäre, über die erwähnte „Datenbank kritischer Werke“ hinaus, auch ein „Zentrales Fälschungsarchiv“, in dem nicht nur Informationen zu einzelnen entlarvten Fälschungen gesammelt, sondern auch diese selbst verwahrt und zu Forschungs- und Lehrzwecken verfügbar gemacht würden. Das hätte den Vorteil, dass die Fälschungen aus dem Verkehr gezogen wären und nicht, wie schon häufig geschehen, als vermeintliche Originale in den Kunstmarkt zurückfließen könnten (vgl. Kapitel 3). Zudem ließen sich anhand der Objekte vergleichende Forschungen zu den von den Fälschern im Laufe der Geschichte angewendeten Methoden anstellen. Auch könnten die Fälschungen als Anschauungs- und Lehrmaterial für die in der kunsthistorischen Ausbildung an Universitäten und Museen bislang vernachlässigte praktische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Fälschung dienen. In der Ausbildung werden Fälschungen bis heute eher als zu ignorierender und lästiger Ausnahmefall behandelt. Es dürfte deutlich geworden sein, wie sehr die Beschäftigung mit der Wirkweise von Fälschungen grundsätzlichen Aufschluss über unseren Umgang mit Kunstwerken gibt. Offenbar spielen dabei die Rahmenbedingungen der Betrachtung von Kunst und des Umgangs mit ihr eine größere Rolle als häufig angenommen.
Im Unterschied zur „objektiven Verfälschung“ wird bei der „subjektiven Verfälschung“ das Werk an sich nicht materiell verändert. Es wird jedoch in einer Art und Weise präsentiert, dass der Eindruck entsteht, es handle sich dabei um ein Original. Wie erfolgreich eine solche subjektive Verfälschung sein kann, zeigt der Fall von John Myatt und John Drewe. Letzterer, von Beruf eigentlich Physiker, schmuggelte in Museums- und Sammlungsarchive gefälschte Dokumente ein, welche den Fälschungen seines Komplizen Myatt eine vermeintlich alte und ehrwürdige Herkunft attestierten. Die von ihm eigens zu diesem Zweck hergestellten Korrespondenzen, Bilderlisten und Inventare schienen zu belegen, dass die kurz darauf von den beiden zum Verkauf angebotenen Fälschungen in Museen, Galerien und Ausstellungen gut dokumentiert und schon seit Langem bekannt seien. Diese gefälschten Unterlagen wurden von den Vertretern des Kunstmarktes als so zuverlässig angesehen, dass Myatts Bilder nie technisch untersucht wurden. Einen solchen Test hätten sie keinesfalls bestanden, da Myatt seine Fälschungen mit modernen Farben ausführte, die zum Zeitpunkt der angeblichen Entstehung der Gemälde noch gar nicht existierten. Als Myatt und Drewe schließlich sowohl der Dokumenten- wie auch der Kunstfälschung überführt wurden, stellte sich zudem heraus, dass Drewe auch kein Physiker war, wie er stets von sich behauptet hatte.
Die einzelnen Verfahren, derer sich Fälscher bedienten und bedienen, wurden hier bislang voneinander abgegrenzt, um ihre jeweiligen Eigenheiten klarer herausarbeiten zu können. In der Praxis kommt es jedoch auch zu vielfältigen Vermischungen und Kombinationen dieser Verfahren. So kann beispielsweise eine Kopie nachträglich durch das Hinzufügen einer falschen Signatur objektiv verfälscht werden. Wird sie dann noch mit Dokumenten versehen, die sie als angebliches Original ausweisen, kommt es zusätzlich zu einer subjektiven Verfälschung.
Die bisherigen Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, dass die meisten der auch dem Fälscher zu Gebote stehenden Verfahren für sich genommen vollkommen legal und legitim sind. Erst in dem Moment, in dem sie mittels objektiver und/oder subjektiver Verfälschung dazu eingesetzt werden, ein Werk als Original auszugeben, das gar nicht original ist, erfüllt sich der Tatbestand der Fälschung.