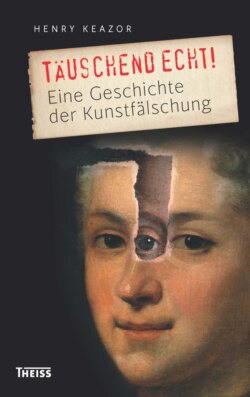Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Fälschung als Übersetzung
ОглавлениеWie häufig bei Fälschungen, stellt sich auch in diesem Fall die Frage nach ihrer Überzeugungskraft zur Zeit ihrer Entstehung und heute. Die damalige Kuratorin, Gisela Richter, war wohl insofern in ihrem Urteil eingeschränkt, als sie an die Echtheit der Skulpturen glauben wollte, nicht zuletzt, weil deren Ankauf für sie die Krönung ihrer Karriere bedeutete. Dass man die Figuren auch damals durchaus skeptischer und objektiver betrachten konnte, macht ein bereits 1937, also im Erscheinungsjahr der Studie von Richter und Binns publizierter Artikel des italienischen Etrusker-Spezialisten Massimo Pallottino deutlich, der die Statuen als Fälschungen zu entlarven versuchte.
Aus der heutigen Distanz den Fälschungen gegenüber fällt neben den technischen Unstimmigkeiten auf, dass die Fälscher auf recht simple Weise kleinformatige Vorbilder wie den Zeus von Dodona oder etruskische Kleinplastiken ins Monumentale vergrößerten (Abb. 6), ohne zu überprüfen, ob etruskische Kolossalfiguren nicht vielleicht ein anderes Erscheinungsbild aufweisen, was sich an dem erwähnten Apoll von Veio bestätigt, dessen Physiognomie wenig Ähnlichkeit mit den erwähnten Statuetten zeigt. Ebenso springen die Ähnlichkeiten der Fälschungen mit der damals zeitgenössischen Skulptur ins Auge. Vergleicht man beispielsweise ein Werk wie Wilhelm Lehmbrucks Stehenden Jüngling von 1913 (New York, Museum of Modern Art) mit dem Alten Krieger (Abb. 6), so lassen sich hier die gleichen schlanken und filigranen Glieder und sogar eine ganz ähnliche Körperhaltung finden.
Derartige Parallelen sind immer auch ein Zeichen dafür, wie sehr Fälschungen ihrer eigenen Zeit verhaftet sind. Häufig beruht ihr Erfolg gerade darauf, dass sie die jeweils zeitgenössische Sichtweise auf die gefälschte zurückliegende Epoche aufnehmen und widerspiegeln: Fälschungen filtern oft ganz bestimmte, für den Blick ihrer eigenen Entstehungszeit typische Aspekte aus der gefälschten Epoche heraus und betonen diese. Darin liegt sogar eine gewisse Nähe zur Karikatur, denn auch dort werden die als charakteristisch empfundenen Züge einer Person verstärkt hervorgehoben, um sie auf den ersten Blick erkennbar zu machen.
Fälschungen mischen eben dieses Charakteristische mit den zu ihrer Zeit aktuellen und virulenten Kunstströmungen, indem sie es zugleich in ein der jeweiligen Gegenwart vertrautes visuelles Idiom übersetzen: Die gefälschten etruskischen Statuen wurden seinerzeit vielleicht auch deshalb so bereitwillig aufgenommen, weil sie, aufgrund ihrer Nähe zur zeitgenössischen Skulptur, weniger fremd wirkten als etwa der originale Apoll von Veio. Der deutsche Filmregisseur Hans Cürlis hat dies in Bezug auf die Fälschungen des italienischen Bildhauers Alceo Dossena (vgl. Kapitel 3) wie folgt formuliert: „Sie [spätere Zeiten] werden besser als wir sehen, was unbewußt in die Werke hineingeraten ist, das gerade u n s das Wesen der nachempfundenen Zeit verständlich machen sollte.“ Der deutsche Schriftsteller und Übersetzer Michael Kleeberg hat 2014 die Zeitverhaftetheit solcher Übertragungen in Bezug auf die Arbeit des Literaturübersetzers prägnant erfasst: „Der Übersetzer ist der ferne Bruder des Schriftstellers. Ganz gleich, ob er sein Zeitgenosse ist oder die Bücher eines langverstorbenen Autors neu übersetzt. Beides ist gleichermaßen nötig, denn es gibt ein merkwürdiges, unerklärbares Phänomen: Übersetzungen altern schneller als die Originale in ihrer Ursprungssprache.“ Ebenso verhält es sich mit Fälschungen, die als, wenn auch irreführende, „Übersetzungen“ betrachtet werden können. Insofern sind Fälschungen – auch als Zeugnisse der Kunstgeschichte – aufschlussreich, da sie sowohl die Ästhetik der Zeit, in welcher der Fälscher lebt, als auch deren Blick auf die jeweils gefälschte Epoche reflektieren.