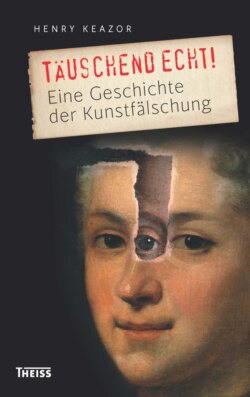Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Falsche Antike Fälschungen in der Antike? Plagiat, Imitat, Fälschung?
ОглавлениеWährend niemand bestreiten wird, dass es spätestens seit dem Mittelalter immer wieder zu Fälschungen, zumal zu Fälschungen von Antiken, gekommen ist, bleibt umstritten, ob es das Phänomen der Kunst-Fälschung bereits in der Antike gab: Wir wissen von gefälschten Münzen, Pergament- und Papyrus-Schriftrollen sowie von gefälschtem Schmuck – Gemmen, Edelsteinen und Perlen –, aber ob in der Zeit des alten Rom, bis hin zum Untergang des Weströmischen Reichs im Jahre 476, auch Statuen gefälscht wurden, wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Bei den zahlreichen Nachbildungen griechischer Statuen, die zum Teil in großen Stückzahlen hergestellt wurden, handelt es sich nicht wirklich um Fälschungen, da deren römische Käufer davon wussten, dass sie mit ihnen keine griechischen Originale erwarben. Letztere waren sogar gar nicht so erwünscht, da die Ästhetik der römischen Nachbildungen sich von derjenigen der griechischen Originale in genau den Punkten unterschied, welche dem spezifisch römischen Geschmack gehorchten.
Was es allerdings, den textlichen Überlieferungen zufolge, in der Antike gegeben haben könnte, sind Fälle objektiver und subjektiver Verfälschung. So wird zum einen überliefert, dass der berühmte griechische Bildhauer Phidias um 500 v. Chr. seine Signatur an Statuen angebracht habe, die tatsächlich von der Hand seines Schülers Agorakritos stammten. Hier liegt also eine objektive Verfälschung eines Werkes durch Hinzufügung einer irreführenden Signatur vor. Zum anderen haben wir Nachrichten davon, dass die beiden ebenfalls berühmten griechischen Maler Apelles und Zeuxis im 4. Jahrhundert v. Chr. unter ihrem Namen Bilder verkauft haben sollen, die tatsächlich ihr verkannter Kollege Protogenes gemalt hatte. Da nicht sicher ist, ob sie diese auch entsprechend signiert hatten, wäre dies also ein Fall subjektiver Verfälschung, bei der ein bestimmter Autor gegenüber dem Käufer lediglich suggeriert wird. In all diesen Fällen zogen die prominenten Künstler daraus keinen Vorteil, weshalb es auch wenig sinnvoll ist, ihr entsprechendes Handeln als „Plagiat“ zu betrachten, wie dies etwa der belgische Kunsthistoriker Thierry Lenain tut. Von einem Plagiat profitiert üblicherweise derjenige, der das Werk eines anderen zu seinem eigenen Nutzen als das eigene ausgibt. Phidias, Apelles und Zeuxis zogen hingegen selbst keinen Profit daraus, dass sie die Werke unbekannter und weniger geschätzter Künstler mit ihrem glanzvollen Namen zierten. Vielmehr hat man es hier mit dem seltenen Fall zu tun, dass eine objektive oder subjektive Verfälschung eines Werks mit dem Einverständnis des entsprechenden Künstlers geschieht.
Lenain beharrt dennoch auf der Deutung dieser Vorgänge als „Plagiat“, weil es das Phänomen der (Kunst-)Fälschung ihm zufolge erst seit der italienischen Renaissance gibt, und weil unsere moderne, tendenziell negative Sichtweise auf die Fälschung seiner Meinung nach erst 1884 mit dem Buch Le truquage (Die Fälscherkünste) eingesetzt hat. Dieses Handbuch mit dem Charakter einer Streitschrift hatte der französische Kunstsammler, -händler und Kolumnist Paul Eudel (1837–1911) als Warnung und zum Schutz gegen Fälscher verfasst.
Lenain lässt hierbei jedoch außer Acht, dass die Fälschung in anderen Bereichen, etwa in der Literatur, Grafton zufolge, bereits im 4. vorchristlichen Jahrhundert eine erste Blütezeit hatte und dass solche Fälschungen bereits in der Antike und im Mittelalter Kritik hervorriefen. Wieso sollte es sich also ausgerechnet in Bezug auf die bildende Kunst in dieser Hinsicht ganz anders verhalten? Tatsächlich weisen Überlieferungen wie die oben erwähnten Schilderungen über Phidias, Apelles und Zeuxis recht eindeutig in die Richtung des Phänomens der Fälschung. Und schließlich deutet auch der römische Dichter Horaz (65–8 v. Chr.) in seinen um 41/40 v. Chr. entstandenen Satiren (Sermones II,3, V. 18–23) bereits an, dass es sich bei dem dort an einem Dialog beteiligten Damasippus um einen Geschäftsmann und Kunstkenner handelt, der sich auch durch seine windigen Expertisen zu echten und falschen Kunstwerken bereicherte.
Was uns allerdings bislang fehlt – und hierin ist Lenain durchaus zuzustimmen –, sind eindeutige materielle Befunde für Statuenfälschungen: Bei den geschilderten Vorfällen handelt es sich lediglich um textliche Überlieferungen, denen gegenüber man insofern vorsichtig sein muss, als es sich dabei auch um Künstlerlegenden handeln könnte, die erfunden und erzählt wurden, um dem Publikum bestimmte Charakterzüge der entsprechenden Protagonisten zu verdeutlichen, etwa die Großzügigkeit und Selbstlosigkeit von Künstlern wie Phidias, Apelles und Zeuxis gegenüber Schülern und von der Käuferschaft benachteiligten Kollegen.
Selbst eine 1832 entdeckte und dann zunächst als Fälschung geführte Skulptur wie der sogenannte Apollo von Piombino (Paris, Louvre), eine in der Provinz von Livorno gefundene griechische Bronzestatue, scheint eher in Einklang mit dem zeitgenössischen Geschmack der römischen Käufer zu stehen, als dass sie versucht hätte, diese zu täuschen. Die Figur weist alle Stilmerkmale des 6. Jahrhunderts v. Chr. auf, wurde jedoch tatsächlich Jahrhunderte später geschaffen, wie eine 1842 bei seiner Restaurierung im Inneren entdeckte (und heute leider verlorene) Tafel mitteilte, auf welcher zwei aus Tyrus und Rhodos stammende Bildhauer des 1. Jahrhunderts v. Chr. als Urheber erwähnt werden. Angesichts dieser „Signatur“ erscheint es wenig wahrscheinlich, dass es sich um eine Fälschung handelt, die vorgibt, älter zu sein, als sie wirklich ist. Vielmehr scheint es, wie auch der 1977 in Pompeji erfolgte Fund einer weiteren solchen Skulptur bestätigt, dass solche archaisch aussehenden Statuen in der römischen Kultur der Zeit sehr beliebt waren. Nicht nur in der Archäologie, sondern auch in der Kunstgeschichte lassen sich immer wieder solche Rekurse auf frühere Stile beobachten.
Im Folgenden geht es nicht länger um antike Fälschungen älterer Werke, sondern um zwei Fälschungen antiker Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Diese beiden Fälle beleuchten exemplarisch die unterschiedlichen Facetten und Dynamiken solcher Antikenfälschungen.