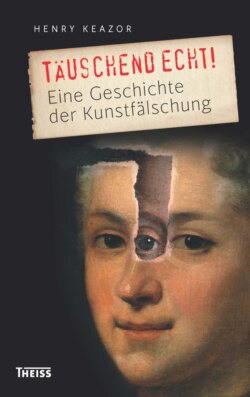Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung: Von Fakes, Hoaxes und „Foaxes“ Der Fall Beltracchi
ОглавлениеKommt man – zumal in Deutschland – aktuell auf das Thema der Kunstfälschung zu sprechen, so wird recht schnell der Fall Beltracchi thematisiert. Wolfgang und Helene Beltracchi wurden am 27. Oktober 2011 vom Kölner Landgericht im Rahmen eines von den Medien intensiv verfolgten Prozesses zu vier beziehungsweise sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Der damit verbundene Fälschungsskandal wurde als einer der größten der deutschen Nachkriegszeit bezeichnet. Er sorgte auch international für Furore, da Beltracchis Fälschungen nicht nur in Deutschland, sondern über Händler auch in London und Paris vertrieben wurden. Über den internationalen Kunsthandel erreichten sie auch so prominente Opfer wie den amerikanischen Schauspieler und Komiker Steve Martin. Darüber hinaus sorgten die geschätzte Schadenssumme von mindestens 15 Millionen Euro und die Langzeitfolgen auf dem Kunstmarkt für Schlagzeilen. Dieser hatte sich in der Finanzkrise zunächst als derart robust erwiesen, dass es bereits erste Ratschläge gab, Geld lieber in wertbeständigen Kunstwerken als in unsicheren Aktien anzulegen.
In den zahlreichen zu dem Fall Beltracchi erschienenen Pressebeiträgen werden vier Aspekte besonders thematisiert. Die ersten drei Punkte betreffen die angebliche Kreativität der Beltracchis, der vierte bezieht sich auf deren scheinbare Motivation:
1. Es wird betont, Wolfgang Beltracchi habe nicht einfach Gemälde von Expressionisten wie Heinrich Campendonk und Max Pechstein oder dem Surrealisten Max Ernst kopiert, sondern vielmehr neue Bilder in deren Stil „erfunden“.
2. Beim Fälschen sei er nicht willkürlich verfahren, sondern es sei ihm darum gegangen, verlorene oder fehlende Werke der gefälschten Künstler erstehen zu lassen, um Leerstellen in deren Œuvres wieder zu füllen und das zu erschaffen, was seiner Meinung nach dort nicht fehlen dürfe. Zu diesem Zweck habe Beltracchi sich in die Epoche, in die Person und in den kreativen Geist der von ihm gefälschten Künstler hineinversetzt, um auf diese Weise in deren Geist schaffen zu können.
3. Für den anschließenden Vertrieb der Fälschungen habe man sich besonders raffinierter und fantasievoll erdachter Herkunftsgeschichten bedient.
4. Schließlich habe Beltracchi vor allem gefälscht, um den Kunstmarkt bloßzustellen. Er habe zeigen wollen, wie geldgierig, vom Profit geblendet und dementsprechend fahrlässig man auf dem Kunstmarkt agiere. Insbesondere habe er so verdeutlichen können, dass es sich um ein System von täuschbaren und/oder käuflichen Experten sowie von Auktionshäusern handele, die aus Geldgier ihre Ware selbst nicht genau prüften und sich gerne täuschen ließen. Auf diese Weise hätten sich Verhältnisse etabliert, in denen man gar nicht mehr an der Entlarvung von Fälschungen interessiert sei, da man sonst den daran geknüpften Profit verlieren würde.
Trotz seiner Prominenz und Aktualität steht der Fall Beltracchi aus zwei Gründen am Ende dieses Buches. Der eine liegt in dessen im doppelten Sinne chronologischen Aufbau. Einerseits werden die besprochenen Beispiele nach der chronologischen Abfolge der einzelnen Fälscher geordnet – beginnend in der Frühen Neuzeit mit Michelangelo und endend mit Beltracchi; andererseits orientiert sich die Struktur auch an der Chronologie der gefälschten Epochen, beginnend mit Antikenfälschungen im ersten Kapitel. Dies harmoniert insofern mit der Künstlerchronologie, als Michelangelo auch mindestens ein Werk der Antike gefälscht hat. In diese doppelte Chronologie fügt sich der Fall Beltracchi am Schluss ein, denn er ist der historisch jüngste Fall, und Beltracchi hat vor allem Werke der Moderne gefälscht. Der zweite Grund, weshalb der Fall Beltracchi erst am Schluss abgehandelt wird, liegt darin, dass an ihm wenig neu oder ungewöhnlich ist, wenn man ihn vor dem Hintergrund der Fälschungsgeschichte betrachtet. So bedeutet fälschen eben nicht, wie in der Presse meist nahegelegt, zwangsläufig kopieren. Vielmehr trifft man in der Geschichte der Kunstfälschung sehr häufig Fälle an, in denen der Fälscher im Stil eines anderen Künstlers neue Werke erfindet. Auch das Fälschen verlorener Werke und deren Einbettung in lückenhafte Werkverzeichnisse gab es bereits vor dem Fall Beltracchi, ebenso die fantasievolle Erfindung von Provenienzen und Herkunftsquellen.
Schließlich lässt sich auch die angebliche Motivation des Fälschers, den Kunstmarkt, die Experten und die Kunsthistoriker bloßstellen zu wollen, bereits zuvor antreffen. Eine solche Begründung ist schon deshalb in jedem Einzelfall auf ihre Plausibilität zu prüfen, weil sie immer wieder von Fälschern als nachträgliche Rechtfertigung vorgebracht wurde, während deren Beweggründe primär finanzieller Art waren – so auch im Fall Beltracchi. Wäre es ihnen tatsächlich um die Entlarvung der auf dem Kunstmarkt herrschenden Missstände oder der dort agierenden unfähigen Experten gegangen, hätten sie ihre Fälschungen irgendwann selbst entlarven müssen, anstatt so lange mit dem lukrativen Fälschen fortzufahren, bis sie überführt wurden.