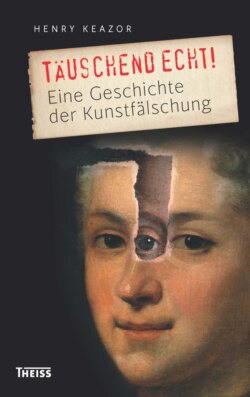Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Always historicize!“
ОглавлениеEs geht keineswegs darum, den Fall Beltracchi herunterzuspielen und gar zu verharmlosen. Ziel dieses Buches ist vielmehr, was der amerikanische Literaturkritiker und politische Theoretiker Frederic Jameson 1981 allen historischen Disziplinen ins Stammbuch geschrieben hat: „Always historicize!“ („Betrachte stets alles im historischen Kontext!“).
Gemeint ist damit keinesfalls die blinde Befolgung eines Prinzips, die im schlechtesten Fall sogar zum Selbstzweck werden könnte. Vielmehr lädt das „Always historicize!“ im Fall Beltracchi dazu ein, dessen Dimensionen besser einordnen und verstehen zu können, indem man seine Vorgeschichte untersucht. Das Ziel ist, zu erkennen, wie der Fälscher von früheren Fälschungsfällen lernen und profitieren konnte. Eng damit verbunden ist die Frage, wo und inwiefern sich Dinge in der Geschichte wiederholen. Dieses auch als „history repeating“ bezeichnete Phänomen lässt sich gerade auf dem Feld der Kunstfälschung immer wieder beobachten. Im Extremfall hat es sogar schon dazu geführt, dass Objekte, die schon einmal als Fälschungen entlarvt worden waren, erneut als vermeintliche Originale auf den Kunstmarkt zurückfanden.
Angesichts dessen stellt sich die Frage nach den Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden müssten, um künftig Fälschungen zu verhindern oder sie zumindest zu erschweren. Ebenso ist zu hinterfragen, weshalb diese Maßnahmen nicht schon früher ergriffen wurden. Aus einer solchen Warte heraus wird dann deutlich, warum man den Fall Beltracchi keinesfalls unterschätzen sollte, denn er kombiniert und potenziert Strategien vorangegangener Fälschungsfälle. Zugleich kann er als eine Art Prüfstein dienen für einen Vergleich des Umgangs mit diesen früheren Fällen und mit dem Fall Beltracchi selbst. Zuweilen wurden die Fälschungen Beltracchis im Nachhinein als eigentlich leicht enttarnbar, da schlecht und „sehr flach“ gemalt abgetan. Eine solche Sichtweise verleitet dazu, sich in einer falschen Sicherheit zu wiegen. Gerade der historisierende Blick verdeutlicht hingegen, dass man sich Vergleichbares bisher nach fast jedem größeren Fälschungsskandal gesagt hat. Das hat das Auftreten neuer Fälschungsfälle jedoch keinesfalls verhindert – vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Eine historische Perspektive legt auch offen, dass sich die Kunstgeschichte mit dem Phänomen der Fälschung stets nur aus aktuellem Anlass, das heißt kurzfristig und gezwungenermaßen, auseinandergesetzt hat. Aufgrund dieses reaktiven Umgangs mit dem Phänomen versandeten vielversprechende Ansätze stets rasch. Wenn die entsprechenden Fälle ihre Tagesaktualität eingebüßt hatten und verblassten, schliefen das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Beschäftigung mit dem Thema und das Interesse daran wieder ein – bis sie vom nächsten Fälschungsfall wieder geweckt wurden. Ein Blick in die Geschichte der Fälschung zeigt auch, dass die Fälscher sich ihrerseits immer intensiver mit der Kunstgeschichte befasst und auseinandergesetzt haben, um ihre Fälschungen entsprechend wirkungsvoll konzipieren, fertigen und lancieren zu können. Auf diese Weise entstand eine Schieflage der Kompetenz bezüglich Fälschungen zwischen Kunsthistorikern und Fälschern. Die Kunstgeschichte sollte sich künftig verstärkt mit dem Phänomen der Fälschung befassen, um für Fälschungen und deren vielfältige Spielarten stärker sensibilisiert und damit auch gegen sie gewappnet zu sein. Darüber hinaus kann man gerade in der Auseinandersetzung mit Fälschungen einiges über den Umgang mit Kunst und die an sie herangetragenen Erwartungen erfahren.
Damit eng verknüpft ist die 1965 bezeichnenderweise von einem Philosophen aufgeworfene Frage, was eigentlich problematisch an einer Fälschung ist: Weshalb, so Alfred Lessings provokante Fragen in seinem Aufsatz, kann man eine Fälschung nicht einfach als ein weiteres kreatives Erzeugnis akzeptieren? Wieso stört sie? Und was genau daran stört?