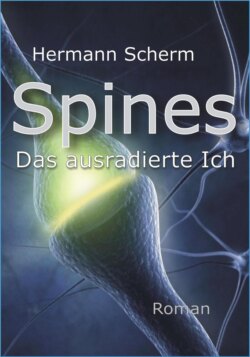Читать книгу Spines - Hermann Scherm - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
19
ОглавлениеDas Rot war unvergleichlich, es leuchtete in seinen Augen stärker als jeder Weihnachtsstern. Alles um ihn löste sich auf, versank in Bedeutungslosigkeit. Der ganze Stress der Vorbereitung auf die Bescherung war weggefegt. Paul hatte nur noch Augen für diesen knallroten Bagger, der unter dem Weihnachtsbaum auf ihn wartete. Er konnte es kaum noch erwarten, das ersehnte Geschenk auszuprobieren, und war der erste unter dem Baum, als die Geschenke zur Inbesitznahme freigegeben wurden.
Durch Drehen an einer kleinen Kurbel an der Gehäuseseite konnte man den Bagger in Bewegung setzen. Der Baggerarm bewegte sich nach vorne und senkte sich Richtung Boden. Dabei öffnete sich die Schaufel und schloss sich wieder. Paul schnappte sich eine Schale mit Erdnüssen vom weihnachtlich gedeckten Tisch, stellte sie auf den Boden und versuchte, die Nüsse mit der Baggerschaufel zu fassen – es klappte. Nach ein paar Minuten hatte er die Schale leer gebaggert. Paul war fasziniert. Was geschah wohl im Inneren dieses Spielzeugbaggers, wenn er an der Kurbel drehte? Wie war es möglich, dass er dadurch Arm und Schaufel bewegen konnte? Er musste unbedingt hinter den Mechanismus kommen und fing an, den nagelneuen Bagger zu zerlegen.
Was er tat, fiel zunächst niemandem auf, weil alle mit dem Auspacken von Geschenken oder mit Weihnachtsgebäck und Getränken zu Gange waren. Erst als er den Bagger bereits vollständig zerlegt hatte, bemerkte sein Vater, was er getan hatte, packte ihn unsanft am rechten Oberarm, zog ihn mit einem Ruck vom Boden hoch und deutete wutentbrannt auf die Einzelteile des Baggers, die verstreut auf dem Boden lagen. »Was zum Teufel machst du da! Jetzt schau dir an, was du mit dem teuren Bagger gemacht hast! Du wirst den jetzt sofort wieder zusammenbauen! Und wehe, du schaffst es nicht, dann erlebst du dein blaues Wunder!«
Erschrocken durch den rüden Ton fing er an zu heulen. »Aber ich wollte doch nur sehen, wie er funktioniert…«
»Das geht dich nichts an! Du baust das sofort wieder zusammen!«, schrie ihn der Vater an.
Onkel Achim stand vom Tisch auf und versuchte, ihn in Schutz zu nehmen. »Jetzt mach mal halblang, Josef, das ist doch nicht so schlimm. Der Junge wird mal Ingenieur!« Dann wandte er sich ihm zu und sagte sanft: »Gell, jetzt baust du den einfach wieder zusammen und alles ist in Ordnung.« Damit waren die Wogen wieder geglättet und alle feierten weiter.
Paul setzte sich auf den Boden zu seinem Bagger und fügte die Einzelteile fast ehrfürchtig wieder zusammen. Dabei fühlte er ungeheuren Stolz. »Jetzt weiß ich, wie das funktioniert!«, sagte er sich immer wieder und seine Augen leuchteten.
Eine Stunde später stand der Bagger wieder da, als wäre nichts geschehen. Kein Teil fehlte, alles war wieder am richtigen Ort – und das Ding funktionierte wie zuvor.
Onkel Achim fiel es zuerst auf. Er kam zu ihm herüber, packte ihn an den Armen, stemmte ihn bis unter die Decke und meinte laut: »Hab ich doch gewusst, der Junge baut das Ding wieder zusammen. Das wird mal ein Ingenieur! Hab ich euch doch gesagt, schaut euch das an! Gut gemacht Kleiner! Du lässt dich nicht unterkriegen, bravo!«
Als er ins Bett musste, schleppte er den Bagger mit und stellte ihn auf das kleine Regal gleich über dem Bett, damit er ihn beim Einschlafen immer im Blick hatte. »Der wird Ingenieur!«, hörte er den Onkel sagen, immer wieder, bis er einschlief.
Im Schmökeralter holte er sich Berge von Büchern über Technik aus der kleinen Pfarrbibliothek gleich neben der Kirche – las über Einstein und Flugzeugbau und begeisterte sich für die Geschichte des Überschallflugs. Er verbrachte die Tage damit, Modellflugzeuge und Schiffe zu bauen, und las nachts heimlich die Lebensgeschichten der großen Wissenschaftler und Erfinder.
Das war der Anfang seiner Leidenschaft für Technik und Forschung. Als er dann vor der Wahl stand, was er studieren sollte, war eines klar, es musste etwas Naturwissenschaftliches sein. Er entschied sich für Physik und Biologie. Während des Studiums kristallisierte sich dann mehr und mehr heraus, dass sein Ding die Neurobiologie war. Das Gehirn und seine Geheimnisse hatten ihn gepackt und ließen ihn nicht mehr los. Und er hatte immer noch die gleiche Leidenschaft. Entdecken, wie etwas funktionierte, war für ihn Spaß, ein Vergnügen, das ihn immer noch bis über beide Ohren strahlen ließ wie einen kleinen Jungen.
Dass er sich nach dem Abschluss des Studiums für Berlin als Wirkungsstätte entschieden hatte, hatte seinen Grund in der Wissenschaftsgeschichte. Ein kurzer Artikel über ein Experiment am MPI für Hirnforschung in Göttingen, den er in jungen Jahren zufällig gelesen hatte, war tief in seinem Gehirn verankert und hatte ihn stark beeindruckt. Damals hatte sich ein Forscher des Instituts in einem Selbstversuch von einem Kollegen ein Loch in die Schädeldecke bohren lassen, um eine Elektrode möglichst nahe ans Gehirn zu bringen. Den Namen des Forschers erinnerte er noch jetzt, Dr. Kornmüller. Dieser brennende Wunsch nach Erkenntnis, hatte ihn zutiefst beeindruckt. Und Kornmüller hatte seine Laufbahn in Berlin-Buch am MPI begonnen. Und als er vor der Wahl zwischen dem MPI in München und der Freien Universität Berlin stand, war es wohl die Erinnerung an diesen Artikel und Alois Kornmüller, die den Ausschlag für Berlin gab.
Kornmüller war einer der Pioniere der Hirnstromregistrierung. Er hatte gemeinsam mit Schwarzer den ersten einsatzfähigen Elektroenzephalographen konstruiert. Mit diesem Gerät war es zum ersten Mal möglich, die elektrischen Vorgänge im Gehirn anhand der von Hans Berger in den 30er-Jahren entdeckten globalen Potenzialschwankungen zu messen, die von der Kopfhaut abgeleitet werden können und als »Hirnströme« bezeichnet werden.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschränkten sich die Werkzeuge zur Erforschung des Gehirns auf Seziermesser und Lichtmikroskop. Erkennbar war für die Forscher nur, was sie nach dem Tod mit Hilfe von Lichtmikroskopen in den Gehirnpräparaten sehen konnten. Man erkannte, dass Nervenzellen höchst unterschiedliche, oft bizarre Formen annehmen können und auf hochkomplexe Weise miteinander vernetzt sind. Auch pathologische Veränderungen des Gehirns waren nur feststellbar, wenn sie sich nach dem Tod als Strukturveränderungen im Gehirn zeigten.
Erst in die frühen 50er-Jahren, einige Jahre nach der Gründung der ersten Max-Planck-Institute, begann mit der Erforschung der Hirnströme eine neue Ära. Zunächst blieb die Messung der Hirnströme jedoch unergiebig. Da ihre Herkunft ungeklärt war, lieferten die Messungen wenig mehr als die einfache Beobachtung von Versuchspersonen.
Erst in den 60er-Jahren gelang es Forschern am MPI bei Experimenten an narkotisierten Tieren, die Herkunft der Hirnströme zu klären. Manfred Klee, Hans Dieter Lux und Otto Creutzfeldt, allesamt Schüler von Kornmüller, stellten fest, dass die Hirnströme auf die Aktivität von Nervenzellen in der Großhirnrinde zurückgehen. Damit waren die Signale interpretierbar und die Elektroencephalographie entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Messinstrument für Forschung und Medizin.