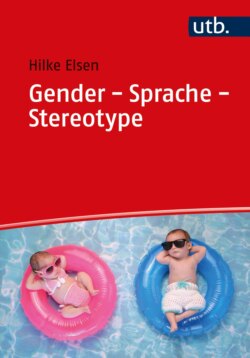Читать книгу Gender - Sprache - Stereotype - Hilke Elsen - Страница 17
2.3 Auseinandersetzungen mit dem Thema Frau und Sprache
ОглавлениеDie Thematisierung von Frauen und Sprache erfolgte bis weit in das letzte Jahrhundert hinein intuitiv und aus männlicher Sicht. Otto Jespersen gehört zu denjenigen Sprachwissenschaftlern (m.), die in diesem Zusammenhang sehr oft zitiert werden, weil er Anfang des letzten Jahrhunderts nicht nur auf das andere Sprachverhalten der Frau hinwies, sondern auch Erklärungen dazu formulierte: Die Sprache der Frau sei insgesamt primitiver, para- und nicht hypotaktisch, inhaltsärmer, unvollständiger. Frauen hätten einen kleineren Wortschatz und bewegten sich in jeder Beziehung im durchschnittlichen Bereich. Jespersen verdanken wir Beobachtungen wie
[…], daß manche männer unverbesserliche wortspieler sind, während die frauen im allgemeinen langsam im begreifen eines solchen wortwitzes sind und kaum jemals selbst etwas derartiges verbrechen […], daß die Frauen viel öfter als die männer mitten in der rede aufhören und den satz unbeendet lassen, weil sie zu sprechen anfangen, ohne das, was sie sagen wollen, zu ende zu denken (Jespersen 1925: 233f.).
Auch Überlegenheit wird uminterpretiert:
Nicht nur, daß sie [die Frauen] schneller lesen konnten als die männer, sie waren auch imstande, bessere rechenschaft über den absatz als ganzen zu geben. Eine dame z.b. konnte genau viermal so schnell lesen als ihr mann und überdies noch einen vollständigeren bericht niederschreiben als er von dem kleinen stück des absatzes, das er zu bewältigen vermochte. Aber es ergab sich, daß diese geschwindigkeit kein beweis für geisteskraft war (ibd.: 236).
Die Gründe dafür suchte Jespersen bei Unterschieden in der Ausbildung, in den täglichen Anforderungen und der Arbeitsverteilung. Im Gegensatz zu einigen außereuropäischen Sprachen gibt es für den deutschen Sprachraum aber keine „FrauenspracheFrauensprache, <i>women’s language</i>“ mit grammatischen, lexikalischen und / oder phonologischen Eigenheiten und damit auch kein geschlechtsspezifisches Sprachverhalten, sondern nur mehr oder weniger typische Merkmale.
Die SoziolinguistikSoziolinguistik, -isch nahm den Faktor Geschlecht Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit in ihren Untersuchungskanon zu Sprachvariation auf, beginnend mit William Labov und Peter Trudgill. Zunächst waren oft genug nur männliche Probanden untersucht worden (Thorne/Henley 1975b, Hellinger 1990: 20). Die Studien mit Frauen zeigten, dass sie im Vergleich zu Männern eher standardnah sprechen.
Eine erste auf tatsächlichen Belegen beruhende Abhandlung über 1500 Spott-, Scherz- und Schimpfnamen für Frauen in der schweizerdeutschen Volkssprache legte 1935 Luise Frei (Frei 1981) vor mit einer erstaunlichen Menge und Bandbreite an affektiven, zumeist negativ konnotierten Begriffen zu den Themenbereichen ‚hässlich‘, ‚dick‘, ‚faul‘, ‚geschwätzig‘, vor allem ‚moralisch fragwürdig‘, und aus zahlreichen Wortschatzbereichen wie TierenTier oder Objekten. So wurden Behälter, Gefäße oder allgemeiner Hohlräume in Übertragung auf weibliche Organe verwendet (Schmutzsack, Stinkloch, Schmutzampele). Alle Bezeichnungen waren laut Autorin von Männern geschaffen. Das sagt nun aber hauptsächlich etwas über die Männer und über das, was ihnen wichtig ist, aus (Wyss in Frei 1981: 9).
Batliner (1981) argumentierte ähnlich. Er überprüfte statistisch Denotate und Konnotate von Nomen und Nominalphrasen mit Bezug auf Frauen und Männer (angefasste Apfelsine für eine Frau, ein Bär von einem Mann) in einem Synonymwörterbuch. Zunächst ging es ihm um die Häufigkeitsverteilung und darum zu zeigen, dass die Sprache eher von Männern als von Frauen geprägt wird. Zahlenmäßig überwiegen ganz klar die Denotate für die Frau (418, für den Mann 44; Batliner 1981: 325). Inhaltliche Aspekte verstärken dann die Argumentation: Attribute für Frauen beziehen sich auf das äußere Erscheinungsbild, auf das Verhalten gegenüber Männern und auf Themen wie ‚jungfräulich‘ oder ‚liederlich‘, während der Mann Machtansprüchen gewachsen ist oder nicht, vgl. bei der Frau schön, attraktiv, sexy, dumm, zanksüchtig gegenüber dem Mann potent, fruchtbar, jugendlich, schwach, senil (Batliner 1981: 320ff.). Anhand der Ausdifferenzierung bei den Bezeichnungen für die Frau werden die inhaltlichen Tendenzen und die vielen Rollenklischees sichtbar, die in dieser Ausrichtung und Breite den männlichen Sprachbenutzern offenbar wichtig sind.
Ruth Römer (1973) untersuchte das Weltbild, das Lehrbücher vermitteln. Sie sammelte Beispielsätze aus renommierten Grammatiken in Hinblick auf Erwähnung, Rollen und Tätigkeiten von Frauen und Männern und fand die klassische Verteilung und Stereotype. Hauptsächlich agieren Männer, Frauen sind selten berufstätig, sondern mit Kindern und Haushalt beschäftigt. „Während er alles weiß, weiß sie nichts.“ „Der Mann ist gebildet. Das Mädchen ist reizend.“ „Der Vater liest. Er liest ein Buch. Die MutterMutter liest Erbsen“ (Römer 1973: 77f.). Solche Untersuchungen gab es später noch öfter (Kap. 11, 12).
Die aktuelle Auseinandersetzung mit der Thematik fand ihren Anfang u.a. mit Key (1972, ausführlich 1975). Sie beleuchtete in Anlehnung an Arbeiten von z.B. Jespersen die Unterschiede der Sprache von Frauen und Männern in einigen Kulturen und trennte dabei auch zwischen gender (‚GenusGenus‘) und sex. Darüber hinaus stellte sie Vorüberlegungen zu unterschiedlichem sprachlichen Verhalten als auch zu Unausgewogenheiten in der sprachlichen Behandlung an, etwa bei den Pronomina, beim Sprechen über Frauen, vgl. „[w]omen fret […]; men get angry. Men have careers; women have jobs“ (Key 1972: 22), „[m]en yell; women scream (or squeal)“ (Key 1975: 81), oder bei der Gruppierung, vgl. „the blind, the lame, and the women“ (Key 1972: 23), „minors, the mentally incapacitated, and sometimes special groups such as married women, convicts, and aliens“, „women, minors, convicts, and idiots“ (ibd.), „Women and dogs and other impure animals“ (ibd.). Kurz darauf erschien Lakoff (1973) und führte die beiden Themen, wie Frauen sprechen und wie über sie gesprochen wird, fort. Sie überlegte, unser Sprachverhalten zu nutzen, um daran unsere unbewussten Einstellungen zu erkennen. Über beide Wege erfahren Frauen Diskriminierung, wenn sie auf unterwürfige Aufgaben („subservient functions“) degradiert werden. Die Autorin sieht die Gründe bereits in der frühen Sozialisation. Schon kleine Mädchen müssen lernen, sich wie ein „richtiges“ Mädchen zu verhalten und damit auch „ordentlich“ zu sprechen. Dann bedienen sie als Erwachsene aber wieder die bestehenden Stereotype mit dem typischen Frauenverhalten und werden als unfähig eingestuft. Wenn sie es nicht tun, sind sie unweiblich.
So a girl is damned if she does, damned if she doesn’t. If she refuses to talk like a lady, she is ridiculed and subjected to criticism as unfeminine; if she does learn, she is ridiculed as unable to think clearly, unable to take part in a serious discussion (Lakoff 1973: 48).
Beide Wege führen dazu, dass den Frauen Führungskompetenzen und Machtpositionen verweigert werden, jeweils mit der Begründung, nicht intelligent genug oder aber zu aggressiv und hart zu sein. Ein Dazwischen gibt es nicht. Dieses Manko an Neutralität bei den Entscheidungsmöglichkeiten der Frauen und die damit verbundene unlösbare double-bind-Problematik bleiben Themen, die bei den Untersuchungen von Kommunikationsverhalten auch heute noch aktuell sind. Anders der Begriff women’s language: Er erwies sich für unseren Kulturraum als unpassend.
Lakoff (u.a. 1973, 1977) sprach zwar von FrauenspracheFrauensprache, <i>women’s language</i>, listete aber zahlreiche Unterschiede im sprachlichen Verhalten auf. Es ging nicht um zwei verschiedene grammatische bzw. lexikalische Systeme, sondern um andere Gewohnheiten, was die Verwendung des Begriffs Frauen- bzw. MännerspracheFrauensprache, <i>women’s language</i> nicht rechtfertigte. Lakoff stellte fest, dass Frauen über mehr Farbbezeichnungen als Männer verfügen (mauve, lavendel, beige), die von Männern aber als unwichtig erachtet werden. Sie verwenden „bedeutungslose“ Partikeln wie oh dear, dear me oder goodness. Andere frauentypische Begriffe sind charming, lovely, sweet, Intensivierungen wie so, such, Euphemismen, Diminutiva, Modalverben, HeckenausdrückeHeckenausdrücke, <i>hedges</i> (sorta, more or less) und tags wie isn’t it (Lakoff 1977: 22ff.). Solche Ausdrücke können zwar eine gewisse Differenziertheit zum Ausdruck bringen, schwächen eine Behauptung aber oft ab, um eine klare Aussage zu vermeiden, um Unstimmigkeiten zu mildern und um Kompromisse und Anpassung zu fördern. Das wird wiederum als Unsicherheit gedeutet. Ähnlich wirkt das Anheben der Stimme zum Ende eines Aussagesatzes, wie es eigentlich für Fragen typisch ist. Auf diese Weise klingen Frauen zwar höflicher, aber auch etwas unsicher und werden daher nicht ganz ernst genommen (Lakoff 1973: 57).
Lakoff führte einige AsymmetrienAsymmetrie auf der Sprachsystemebene auf wie die Pronomina, die Verwendung von master (‚Herr, Meister‘) gegenüber mistress (‚Geliebte‘), was im Übrigen nicht allein stehen kann, sondern immer nur in Bezug auf jemanden (Rhonda is *a / his mistress), oder auch der Unterschied zwischen he / she is a professional. Frauen sind in diesem Zusammenhang Prostituierte, Männer Profis in ihrem Beruf. Diese Asymmetrien reduzieren Frauen darüber hinaus wieder auf eine ihrer wenigen Hauptfunktionen. Hierzu gehörten laut Lakoff weiter auch die Unterscheidung von Miss und Mrs., vgl. sogar Mrs. John Smith, was kein Pendant auf männlicher Seite aufweist. Es zeigte sich außerdem, dass Frauen meist in Abhängigkeitsverhältnissen zu einem Mann dargestellt werden, vgl. auch Mary is John’s widow – *John is Mary’s widower (Lakoff 1973: 63ff.). Diese und andere sprachliche Disbalancen reflektieren soziale Ungleichheit, bezogen auf die Rollenverteilung. Lakoff (1973) trat aber ganz dezidiert nicht dafür ein, die sprachlichen Asymmetrien abzuschaffen.
Barrie Thorne und Nancy Henley legten 1975 einen Sammelband vor mit damals neuen Daten aus verschiedenen Erhebungsmethoden und Quellen und konnten die wesentlichen Behauptungen zu AsymmetrienAsymmetrie und männlicher Dominanz in der Sprache dadurch empirisch stützen. Auch sie gingen primär von sozialen Faktoren als Grund für Unterschiede aus und sahen „gender“ als kompliziertes soziales und kulturelles Phänomen (Thorne/Henley 1975b: 14). Insgesamt bot der Band ein zum damaligen Zeitpunkt sehr differenziertes Bild an beteiligten Disziplinen, Untersuchungsmöglichkeiten und Einflussfaktoren.