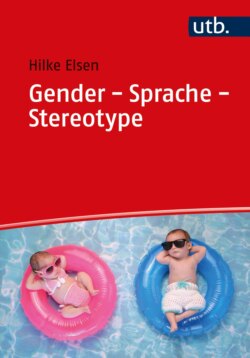Читать книгу Gender - Sprache - Stereotype - Hilke Elsen - Страница 23
3.3 Diversität – Gender und doing gender<i>doing gender</i>
ОглавлениеLange galt Geschlecht als feste Größe, als natürlich definiert, unveränderbar und universell (so) gegeben. Vor allem aber handelte es sich um ein bipolares Konzept. Das Geschlecht als entweder Mann oder Frau stand mit der Geburt automatisch fest und blieb für immer gleich, „one’s identity is known to oneself and seen by others as one’s body“ (Fryer 2012: 41). Damit war auch die GeschlechtsidentitätGeschlechtsidentität stabil. Das Geschlecht eines Menschen galt als so selbstverständlich, dass es nicht hinterfragt, ja nicht einmal darüber nachgedacht werden musste. Probleme gab es nur für diejenigen, die nicht oder nicht ganz zu einer der beiden Kategorien passten. Diese Vorstellung dürfte auch heute noch die übliche sein. Die beiden Geschlechtskategorien manifestieren sich in Verhaltensweisen, zum Beispiel in der InteraktionInteraktion, Kleidung, Mimik, Gestik, Vornamen oder einer Entscheidung zwischen männlich und weiblich in amtlichen Dokumenten.
Die meisten Aspekte, die die Geschlechter ausmachen, sind allerdings gar nicht angeboren, so die aktuelle Genderforschung, vielmehr werden sie uns anerzogen, und wir selbst richten uns, bewusst oder unbewusst, auch nach den Erwartungen der anderen, um im täglichen Umgang miteinander nicht benachteiligt zu werden. Damit gehorcht Geschlecht vielen Einflüssen, es ist nicht fix, sondern variabel, es kann auch nicht immer von anderen, etwa sozialen Aspekten getrennt werden. Das Englische unterscheidet daher zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und dem sozialen (gender). Geschlecht in diesem Sinne ist ein gesellschaftliches Konstrukt, es wird gemacht, gelernt, interpretiert:
differences in what happens to women and to men derive in considerable measure from people’s mutually developed beliefs about sexual differences, their interpretations of its significance, and their reliance on those beliefs and interpretations to justify the unequal treatment of women and men (Eckert/McConnell-Ginet 2013: 7).
Dieser Aspekt von Geschlecht wird aufgefasst als konstruiert – in der InteraktionInteraktion, in den MedienMedien. Auch unsere Bildungsinstitutionen sind am doing gender<i>doing gender</i> beteiligt, weil sie die unterschiedlichen Rollen ständig reproduzieren und inszenieren. Dies geschieht unbewusst und automatisch.
Das Gender-Konzept, das zwischen gender und sex trennt, führte weg von einer Selbstverständlichkeit der beiden Kategorien. Es erfolgte eine Ausweitung der natürlichen Zweiteilung. Hier ist Geschlecht weder fest noch biologisch determiniert, sondern durch unser Miteinander bestimmt und damit kulturell-sozial bedingt1. Der Ansatz beschäftigt sich mehr mit GeschlechtsidentitätGeschlechtsidentität, wie sie entsteht, wie sie immer wieder ausgehandelt wird und welche Facetten jenseits der traditionellen Zweiteilung möglich sind. So kam es zur Konfrontation und letztendlich für viele auch zur Trennung in biologisches und gesellschaftliches Geschlecht. Diese Auffassung sieht Geschlecht im Sinne von Gender als veränderbar und nicht mehr binär. Daran schloss sich die Vorstellung an, dass Gender situationsspezifisch und auch zeitlich punktuell ständig immer wieder inszeniert wird: Wir „machen“ unser Geschlecht.
Doing gender heißt, dass Gender im täglichen Leben permanent und immer wieder konstruiert wird und erst dann und dadurch überhaupt erst entsteht, dass es eine soziale Gewohnheit ist.
Der Gedanke des doing gender<i>doing gender</i> findet sich in zahlreichen Debatten und theoretischen Strömungen wieder, in denen verschiedene Wissenschaftstraditionen unterschiedliche Akzente setzen. Für Hirschauer (1994, 2001) dient aus Sicht der Soziologie die Aufteilung in zwei Geschlechter der sozialen Organisation. Die Ethnomethodolog/innen West/Zimmerman (1987) prägten den Begriff des doing gender als eine Routine, eine Fertigkeit, die wir in der InteraktionInteraktion mit anderen immer wieder neu schaffen. Die soziale Wirklichkeit erzeugen wir erst im alltäglichen Miteinander. Sie nahmen den Fall der transsexuellen Agnes als Ausgangspunkt. Agnes wurde zunächst als Junge erzogen, wollte dann aber trotz männlicher Genitalien Frau sein und ließ sich schließlich auch umoperieren. Als wesentlich erwies sich die Beobachtung, dass sie ständig ihr Geschlecht durch ihr Tun beweisen musste, unterstützt von adäquater Sprache, Stimmführung, Kleidung, Schminke, Frisur etc. Sie hatte das angemessene Verhalten, sich in jeder Situation als Frau und damit anders als bisher zu benehmen, um als Frau auch wahrgenommen zu werden, erst mühsam zu erlernen und war auf die Hinweise ihres Freundes angewiesen, etwa, eher einmal nichts zu sagen als sich durchzusetzen. Die Sichtweise des Doing gender-Konzepts rückt deswegen das Verhalten sowie die tragende Rolle der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Gender im Vergleich zu sex ist weniger Eigenschaft als immer wieder neu in der Interaktion miteinander hervorgerufenes Tun, was AsymmetrienAsymmetrie nicht ausschließt, aber Varianten mit einbezieht, die über +/- weiblich bzw. männlich hinausgehen, also verschiedene Transgenderformen, Hermaphroditen, Homosexuelle. Geschlecht ist nicht gegeben und auch nicht fix. Es ist „emergent“Heterosexualität<i>performing gender</i>2. Über die Interaktion aber rückt die Sprache etwas mehr in den Blickpunkt. Studien untersuchen u.a., wie genau Gender zustande kommt.
Kotthoff (2002) kritisiert allerdings die zu starke Betonung von Gender als soziale Kategorie. Denn erstens sieht sie durchaus Zusammenhänge zwischen sex und gender, zweitens sind NeutralisierungsstrategienNeutralisierung möglich, die von Einzelnen ausgehen können. Außerdem zeigt sich doing gender<i>doing gender</i> nicht nur in der InteraktionInteraktion, sondern auch in Äußerlichkeiten und Körpersprache. Gender wird nicht immer und in jeder Situation gleich „gemacht“. Meistens ist der/die Einzelne auch nicht allein beteiligt. Kotthoff möchte das Phänomen relativieren in rezipiertes gegenüber produziertes, bewusstes und nicht bewusstes, mehr oder weniger Gender.
Das biologische Geschlecht ist für Doing gender-Ansätze unwichtig oder sogar nicht existent, da Gender stets im Moment und abhängig von der Situation inszeniert wird und die Kategorie durch die sprachliche Benennung erst entsteht.
In der Tradition des ‚Doing gender‘-Ansatzes gibt es Gender nicht, außer wenn es sprachlich konstituiert wird. Sprache ist damit nicht Abbild von Gender, sondern Sprache ist herstellende Bedingung für Gender (Hornscheidt 2013: 346).
Diese Position ist in ihrer extremen Variante, auch die tatsächlich angeborenen Geschlechtsmerkmale zu negieren und sie erst gelten zu lassen, wenn sie für relevant erklärt werden, sehr umstritten. Es stellt sich auch die Frage, wie realistisch die komplette Ausblendung jeglicher biologischen Aspekte letztendlich ist.