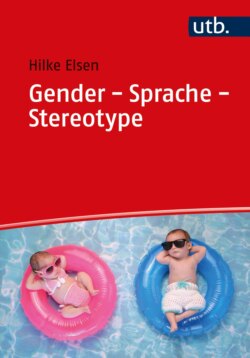Читать книгу Gender - Sprache - Stereotype - Hilke Elsen - Страница 25
3.5 EvolutionEvolution, aber nicht Determiniertheit
ОглавлениеSchließlich vertreten einige Ansätze die Meinung, dass biologische Faktoren nicht irrelevant sind. Auf der Suche nach Erklärungen, warum es etwa im Gesprächsverhalten zu Unterschieden kommt, flossen auch evolutionsbedingte Gründe mit ein, da die Arbeiten der Feministischen Linguistik für viele keine zufrieden stellenden Erklärungen für die Beobachtungen lieferten, weil sie lediglich Thesen und Vermutungen aufstellten und nicht nach Ursachen suchten. Auch der Doing gender-Ansatz erfährt Kritik: Die Universalität, die Stabilität und die psychischen Verankerungen der Geschlechterhierarchien werden nicht erklärt und dem Einzelnen wird zudem ein zu großer Handlungsspielraum beigemessen (Rendtorff 2006: 137f.). Deswegen versucht u.a. Locke (2011) zu zeigen, dass sich die großen Unterschiede zwischen Männer- und Frauengesprächen nicht über Gendereffekte, sondern über unterschiedliche biologisch bestimmte Eigenschaften erklären lassen, die ihren Ursprung in den verschiedenen Aufgaben bei der Fortpflanzung haben – „men and women speak in fundamentally different ways largely because they are outfitted by Nature to do so“ (Locke 2011: 9). Locke sieht in den Unterschieden jedoch keine Rechtfertigung für Ungleichbehandlung, vielmehr will er Frauen und Männer als sich gegenseitig ergänzend begreifen. Er betont die Vorzüge des Zusammenwirkens.
Bereits zu Zeiten der Jäger und Sammler(innen), die damals noch als egalitär zu betrachten waren, bedingten die biologischen Unterschiede vor allem die klassische Arbeitsteilung (Wood/Eagly 2012). Sie führten aufgrund des je anderen Evolutionsdrucks über viele tausende von Jahren hinweg zu Unterschieden von Körper und GehirnGehirn. Locke führt zahlreiche Belege zu universellem Verhalten, Parallelen bei anderen Spezies, höheren Testosteronwerten im Zusammenhang mit Dominanz und kindlicher Entwicklung an.
Besonders die sehr stark verbreiteten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sprachstilen lassen sich seiner Meinung nach schlecht als je unmittelbar konstruiert verstehen. Hier sieht Locke weniger psychologisches als vielmehr biologisches Erklärungspotenzial. Auffälligerweise sprechen kulturübergreifend Frauen eher ungern vor vielen Menschen, während Männer dazu tendieren, den öffentlichen Rahmen für die Selbstdarstellung und verbale Wettkämpfe zu nutzen, dazu gehören auch Witze, lange Monologe und Herumalbern. Wie die EvolutionEvolution uns lehrt, haben stärkere und intelligentere TiereTier bessere Überlebenschancen. Kämpfe, die jedoch nicht tödlich enden, und laute und gefährlich klingende Drohgebärden dienen dazu, den Stärksten und damit Statushöchsten auszuhandeln und damit weibliche Tiere zu beeindrucken und für die Fortpflanzung zu gewinnen. Diese wiederum bevorzugen möglichst starke Partner, die das Wohlergehen des Nachwuchses für längere Zeit gewährleisten. Bei den Menschen ersetzen verbale Gefechte die körperlichen Auseinandersetzungen. Dominanz und StatusStatus korrelieren mit Testosteron. Beispielsweise weisen Berufsschauspieler, Berufsfußballer und Prozessanwälte1 wesentlich höhere Testosteronwerte auf als andere Berufsgruppen (Locke 2011: 93). Das viele Sprechen über sich selbst, das verbale Dominanzverhalten und Statussichern entspricht der körperlichen Selbstdarstellung, etwa bei der WerbungWerbung, während das kooperative Verhalten Beziehungsgeflechte pflegt, die für die Aufzucht des Nachwuchses zwischen den weiblichen Mitgliedern einer Gruppe unentbehrlich waren.
So sieht es auch Scheunpflug (2004). Um das Überleben über erfolgreiche Reproduktion zu sichern, müssen männliche Individuen stark, gesund und schnell sein. Sie treten gegen viele andere Konkurrenten an und demonstrieren entsprechend ihre Vorteile wie körperliche Kraft oder beim Menschen hohes Einkommen und andere vergleichbare Leistungen. Sie wollen ihre Energie in möglichst junge (und viele) gesunde Weibchen investieren, müssen aber dafür lediglich Kraft für WerbungWerbung aufbringen. Im Gegensatz dazu wenden weibliche Säugetiere sehr viel Energie für Mutterschaft, Geburt, Stillen und Betreuung auf. Sie produzieren nur wenig Nachkommen und diese sind oft sehr unselbstständig und benötigen Schutz. Außerdem ist, je weniger Nachwuchs ein Weibchen hat, dieser umso wertvoller. Wenn sich das Weibchen um den Nachwuchs kümmern muss, benötigt es ebenfalls Schutz. Die weiblichen TiereTier sind deswegen auf die Hilfe durch die anderen weiblichen Mitglieder der Gruppe und das möglichst starke und mächtige Männchen angewiesen. Sie investieren darum ganz anders in den Partner: Er will sorgfältig ausgesucht sein, weil er für längere Zeit für die Gruppe bzw. das Weibchen sorgen soll, denn das Überleben der Kinder hat absolute Priorität.
Die Gruppe, die aus anderen weiblichen Mitgliedern bestand, die bei der Betreuung des Nachwuchses zusammenarbeiteten, stellte ein komplexes soziales Netzwerk dar, in dem sich die Einzelne kooperativ platzieren musste. Einige Ansätze gehen deswegen davon aus, dass die soziale Entwicklung über die weiblichen Mitglieder entstand. Die soziale Intelligenz, die mit der Größe der Gruppen korreliert, entwickelte sich zunächst über höhere kognitiveKognition, kognitiv Ansprüche und entsprechend größerem Gehirnbereich auf der Seite der weiblichen Primaten (Lindenfors et al. 2004, Lindenfors 2005, Locke 2011: 144).
Das viele Reden über Beziehungen und zwischenmenschliche Ereignisse bei Frauen entspricht einem Pflegen sozialer Bindungen, das viele Reden über sich selbst bei Männern der Selbstdarstellung und der StatusStatusdemonstration. Beides ist interpretierbar als sprachliche Entsprechung des evolutionärEvolution bedingten geschlechtstypischen Verhaltens mit dem Ziel, optimal zu reproduzieren und damit letztendlich die Art zu sichern.
Entsprechend lassen sich auch die unterschiedlichen Interessen schon im KindergartenKindergarten – Schönheit vs. Stärke – erklären: Da Männchen ihre Energie (Samen) optimal anlegen wollen, müssen die Weibchen gesund und im richtigen (jungen) Alter sein. Das Interesse auch kleiner Mädchen am Äußeren ist in diesem Ansatz ein Relikt aus den Zeiten, in denen das Äußere die für die Fortpflanzung grundlegenden Eigenschaften Jugend und Gesundheit signalisierte. Da die Weibchen um Männchen konkurrieren, mussten sie ihr Äußeres effektiv in Szene setzen. Andersherum benötigten Weibchen starke und gesunde Partner, die die Chancen auf erfolgreiche Aufzucht des Nachwuchses verbesserten. Ein starkes Männchen hat mehr Chancen bei den Weibchen. So erklärt sich die ständige Konkurrenz, die sich schon im Kindergarten zwischen Jungen oft auf körperlicher Ebene zeigt. Sie äußert sich später in StatusStatus, erfolgreicher Karriere, Einkommen und großen Autos oder aber Gewalt.
Da Männer bei der Partnerwahl potenziell das Risiko tragen, leer auszugehen, war es für sie in der Geschichte der männlichen EvolutionEvolution vorteilhaft, neben dem kommunikativen Konkurrenzverhalten eine hohe Risikobereitschaft zu entwickeln. Zudem kann die geschlechtsspezifisch hoch signifikante männliche Gewaltbereitschaft als ein Ausdruck innergeschlechtlicher Konkurrenz interpretiert werden (Scheunpflug 2004: 208).
Biologisch-evolutionäre Gründe für Unterschiede zwischen Frau und Mann werden gern dazu missbraucht, bestehende Statusunterschiede zu rechtfertigen und Veränderungen zu blockieren, die die männlichen Machtpositionen schwächen könnten. Dieser Missbrauch ist ein wichtiges Motiv für die vielfach vehemente Ablehnung des Ansatzes.
Der evolutionäre Ansatz ist nicht als Entschuldigung für stereotype Verhaltensweisen misszuverstehen, sondern als wichtig für Wissenserweiterung und die Möglichkeit, die Beobachtungen der Geschlechterforschung zu verstehen.
Zweifellos überlagert der kulturelle Fortschritt viele der angeborenen Tendenzen oder macht sie obsolet. Die durch unsere moderne Entwicklung nötige und/oder forcierte Flexibilität relativiert die genetischen Anlagen. Ganz aber verschwinden sie nicht, sonst gäbe es kein Streiten um Frauen und Macht und keine Vergewaltigungen mehr. Wir können unsere Handlungen selbst bestimmen, und je mehr wir über möglicherweise angeborene Zwänge wissen, umso eher können wir uns dagegen entscheiden und uns auch gegenseitig besser verstehen. In diesem Ansatz geht es nicht primär darum, dass Frauen und Männer nicht gleich sind. Sie sind trotz aller Unterschiede gleichberechtigt.