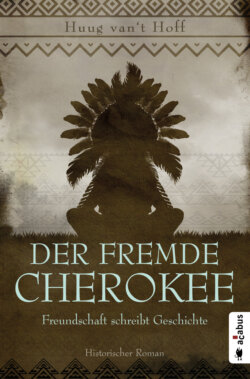Читать книгу Der fremde Cherokee. Freundschaft schreibt Geschichte - Huug van’t Hoff - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schweinefuß
ОглавлениеDie Nächte wurden länger und kälter. Das herabfallende Laub der Bäume hinterließ kahle Äste und Zweige, die Fichten warfen ihre Zapfen zu Boden und begruben sie in den welken Blättern. Der Nussmond Duliidsdi, der erste Neumond des Herbstes, war längst verabschiedet, die Ernte eingebracht, und das Leben in Ustanali, Head of Coosa, Oothcaloga, Gansagiyi und all den anderen Gemeinden verlangsamte sich. Die Einwohner der Dörfer warteten auf den Winter. Der Wandel der Zeit, der Einfluss der US-Nachbarn, die neuen Techniken, neuen Religionen und neuen Denkweisen hatten das Zusammenleben durcheinandergebracht. Das Verständnis von persönlichem Eigentum setzte sich im Stamm weiter durch. Das von den Müttern geerbte Hausland wuchs bei einzelnen zu großen Farmen und bei anderen sogar zu Reichtum an. Die Bedeutung des Gemeinschaftslandes sank im gleichen Maß wie der Arbeitsaufwand stieg. Das Ansehen der Familien bemaß sich nun ebenso in arm und reich. Neuartige Gesetze mussten Probleme regulieren, die zuvor nahezu unbekannt waren. Es mussten Diebstähle bestraft werden, weil sie in einer Welt des Eigentums das Miteinander bedrohten. Damit die Zinsen für Geliehenes das Leben der Leihenden nicht erdrückten, bedurfte es ebenfalls einer Regelung. Der Unmut über den Umgang mit den Nachbarn und deren Einfluss stieg. Vor allem bei jenen, für die er keinen Gewinn darstellte. Bei den Ärmeren und Älteren. Viele fürchteten den Verlust der eigenen Traditionen und Identität. Als der Handel mit Pelzen einbrach, weil der Krieg in Europa auch die Nachfrage bei den US-Händlern verringerte, sanken die ohnehin geringen Einkünfte der Cherokee, die mit Jagd und Pelzen ihr Überleben fristeten. Trotzdem sprachen sich sogar die meisten von ihnen gegen eine Rückkehr zu der alten Lebensart aus. Sie wollten das Alte bloß bewahren, um das Neue überstehen zu können. Ein Häuptling namens The Elk verkündete seine Vision von einer trennenden Gesellschaft aus weißen und roten Menschen, die alle ursprünglich von Mutter Erde abstammten. Ein trennendes Miteinander sei der Weg für ein gesundes Leben unter Brüdern. Gerüchte machten in den Dörfern die Runde, dass Tenkswatawa, den die Shawnee den Propheten nannten, mystische Lieder singe. Lieder, die zu wilden Tänzen verleiteten und die den Tanzenden die Kraft vom Großen Geist vermittelten. Geistertanz, Ghostdance. Lieder, um die Tanzenden und die Stämme der Tanzenden zu vereinen, damit sie gemeinsam den weißen Einfluss und deren Eindringen in ihre Welt stoppten. Vom Großen Geist würden sie bald ein magisches Pulver erhalten, prophezeite Tenkswatawa, um die Feinde zu verjagen. Die Ghostdances bedrohten all das, was The Ridge, Charles Hicks, John Ross, Pathkiller und sogar Black Fox als hilfreich für das Überleben des Stammes ansahen. Ihr Plan war, den Nachbarn in Georgia, Tennessee und bis nach Washington zu beweisen, dass ihre Fähigkeiten und Zivilisation den Weißen gleichwertig waren. Dass es nützlich und wertvoll für beide Seiten war, sie als einträchtige Geschäftspartner zu achten. Dass der Verbleib der Cherokee im Talland der Great Smokys auch zum Vorteil und im Interesse der Nachbarstaaten war. Der Ghostdance erwies sich hierfür als Hindernis, ließ sich aber nicht mehr aufhalten. Tecumseh, Tenkswatawas Bruder, sprach bei den Creek, suchte dort Verbündete und fand solche. Auch einige der Cherokee, die zu den Creek gereist waren, um ihn zu hören. Sie verbreiteten seine Visionen im Stamm und fanden Gehör: bei den Alten und Armen. Der Shawnee-Aufstand wurde von den US-Truppen niedergeschlagen. Doch der Gedanke überlebte. Als dann im Winter die Erde bebte und viele Häuser, Brücken, Mühlen und Fährbetriebe zerstörte, deuteten nicht nur die Anhänger des Ghostdances dies als Zeichen des Unmuts vom Großen Geist. Es sei der Beweis für den falschen Weg, den die Cherokee gingen. Sagten manche. Für Pathkiller, den Obersten Häuptling, stand fest, sie mussten rascher und effektiver als ihre politischen Gegner der Ghostdance-Bewegung handeln. Die Akkulturation sei ihre einzige Chance, den Druck von außen zu überstehen, pflichteten The Ridge, Charles Hicks, John Ross und sogar Black Fox ihm bei. Sie müssten ihre Verbündeten und die skeptischen Stimmen im Stamm davon überzeugen, dass dieser Weg für alle der beste sei.
»Eine Schrift würde uns voranbringen. So wie die sie haben. Um uns zu vereinen, Gesetze zu schreiben, eine Verfassung und um nachzuweisen, dass wir fähig sind wie die«, behauptete der hagere Mann mit dem Turban, genauso wie bei anderen Sitzungen des Stammesrats. »Ich bin mir sicher, ein neuer Stolz auf unsere eigene Kultur würde sich in den Dörfern ausbreiten, unsere Nachbarn und sogar die Ghostdancer von unserer Sache überzeugen.«
»Ja, gute Idee«, stimmte The Ridge wie gewohnt ironisch zu. »Dann zeig uns mal diese Schrift!« Der Stammesrat lachte. Sie wussten von der Unmöglichkeit des Vorschlags, genauso wie von der Vergeblichkeit der Versuche ihres Freundes. Womit keiner gerechnet hatte, war, dass er diesmal tatsächlich eine Schrift mitgebracht hatte. Er führte die Symbole vor, erklärte welche Bedeutung jedes habe und wie man damit Informationen weitergeben konnte. Einige der Anwesenden waren beeindruckt. The Ridge und Charles Hicks nicht. Es lagen etwa zweihundert kleine Holztafeln vor ihnen auf dem Boden, jede bemalt mit einem Zeichen. Bereits nach der zehnten Tafel hatten sie die Bedeutung der ersten vergessen. Wahllos zeigte The Ridge auf eine Tafel, auf der etwas gemalt war, das wie ein Hirschgeweih aussah.
»Was hieß das noch einmal?«, fragte er.
»Hirsch«, antwortete der Hagere stolz grinsend.
»Und das?«, hakte Pathkiller nach, als er verstand, worauf The Ridge hinauswollte. Ein Kreuz mit einem Punkt darüber war auf der Tafel zu erkennen.
»Wir treffen uns«, lautete die Antwort, auf die ein Zögern folgte, ein grüblerisches Kratzen am Kopf und: »Oder nein, es heißt: Mensch. Warte, doch nicht: Laufe in Richtung der Sonne. Nein, oder …«
Abermals war der hagere Mann mit seinem Vorschlag gescheitert. Da die Umsetzung wie seit jeher misslang, glaubte kaum einer an die Chance, dass es irgendwann gelänge. Was Sequoyah aber unbeirrt, ja, sogar eher stur an dem Vorhaben festhalten ließ. Wofür er Spott erntete. Wieder und wieder. Daran jedoch konnte er sich nie gewöhnen. Geschlagen verließ er den Stammesrat.
Der Unterricht in Springplace war zu meinem Alltag geworden, wie die Nachmittage mit den Freunden. Mittlerweile zweifelte ich nicht mehr daran, dass wir Freunde waren. Vereint in oder trotz der Unterschiede. Gallegina war weiterhin ein eifriger Schüler, Gottlieb Byhans Liebling. Nach dem schulischen Fiasko meines ersten Tags in Springplace hatte ich Steiner nie wieder im Unterricht erlebt. Ob es an den Ereignissen des Tages lag, oder ob er ohnehin seine Mission eher hinter der Kanzel sah, darüber gab es Gerüchte, aber nie Klarheit. Feststand, er übernahm fortan den Kirchdienst und Byhan die Schüler. So war, trotz Galleginas Vorwürfen, der Vorfall für ihn zum Vorteil geworden. Byhan war als Lehrer milder, und der gelehrsame Schüler erfreute ihn. John und mir schenkte er weniger Aufmerksamkeit. Was uns zupass kam. Gottlieb Byhan lehrte Rechnen und das Alphabet, zum Lesen und Schreiben der englischen Sprache und des ›rechten Glaubens‹. Gallegina las alles, was er in die Hände bekam. Vor allem die Bibel. Die las er immer und immer wieder. Und mit der Häufigkeit der Lektüre stieg sein Glaube an das, was in dem Buch geschrieben stand. Natürlich lernten auch John und ich Lesen und Schreiben, aber ohne Galleginas Wissensgier. Mein Interesse sah anders aus: John lehrte mich, wie die Rivercane-Bambusstöcke, die überall an den Flüssen wuchsen, über dem Feuer geradegebogen werden konnten, wie man sie zu Blasrohren aushöhlte und aus Robinien und Distelflaum Pfeile fertigte. Bald gelang es mir schneller und besser als ihm. Ebenso eine Chungke-Scheibe herzustellen und Speere zu schnitzen, fiel mir bald leichter als ihm. Dafür traf er das Ziel, war schnell und wendig. Ich bewegte mich so plump wie Gallegina. Mit der Häufigkeit an Niederlagen sank der Spaß am Spiel und die Anzahl der Spiele. Zu ungleich war der Wettstreit. Mit Degataga war es zumindest ein Zweikampf, einer zwischen John und ihm. Gallegina und ich stellten bloß Hindernisse ihres Spiels dar. Obwohl der kleine Bruder für ein wenig Ausgleich im Spiel sorgte, nervte es uns. Er war fast zwei Jahre jünger als wir, trotzdem kräftiger, schneller und geschickter. Degataga, der Standhafte, stand nicht, sondern preschte wie ein Bison über das Feld. Unumstößlich, standhaft, ohne stehen zu bleiben. Gallegina und ich überließen zunehmend John und ihm das Feld. Bald spielten wir kaum mehr Chungke. Auch, weil John seinerzeit an diversen Leiden erkrankte. Wobei ihn keine Krankheit lange schwächte. Kaum gesundet wirkte er, als sei er nie krank gewesen. Stärker als zuvor. Bis zum nächsten Fieber, bis zum nächsten Erbrechen oder bis zu den wiederkehrenden Gelenkschmerzen, für die kein heilkundiger Didanawisgi je die Ursache fand. Schmerzen und Krankheit und Stärke und Wendigkeit wechselten sich ab. Wegen der Besuche des erkrankten Freundes begleitete ich Gallegina nach Head of Coosa und verbrachte die Tage dort. Wegen meiner Freunde. Nicht nur, wenn John krank wurde. Abends bei meiner Heimkehr fragte mein Vater mich aus: über Johns und Galleginas Familien. Knappe Antworten hielten ihn lange in zufriedener Erwartung, seinen Geschäften half es nie. Es war keineswegs so, dass ich nicht mehr erzählen wollte, nur gab es in meiner Welt kaum etwas, das in seiner Bestand hatte. Die Welt der Freunde wurde täglich mehr zu meiner eigenen. Das Leben der Cherokee blieb Vater so fremd wie er mir. Ihre Sprache lernte ich nebenbei. Ohne Vorsatz, ohne üben. Rasch war das Cherokee zu meiner eigenen Sprache geworden.
Nachdem wir den Spaß am Chungke verloren hatten, also, nachdem vor allem Gallegina und ich ihn verloren hatten, fanden wir eine andere Beschäftigung. Durch Zufall. Oder durch Vorsehung. Träge von der Ereignislosigkeit des Tages zogen wir durch die Wälder jenseits des Coosa River, als mir eine Hütte auffiel, die einsam wie mein eigenes Zuhause in einer Senke lag. Auf die Frage, wer dort lebe, sagte John schmunzelnd, sie würden es mir zeigen. Was sie taten. Anders, als ich es erwartet hatte. Sie lasen vom Waldboden Fichtenzapfen, Eicheln und kleine Laublehmklumpen auf und schlichen zu der Hütte. Der Sinn der Aktion war eindeutig. Und niemand hielt sie auf. Ich folgte ihnen. Das Erste, was geschah, hatte ich erwartet: Sie warfen ihre Waldmunition gegen die Tür und das Dach der Hütte. Das Zweite wäre mir zumindest zuwider gewesen. Verhindert hätte ich es vermutlich ebenso wenig. Sie brüllten »Se-quo-yi, Se-quo-yi«, »Schweinefuß, Schweinefuß«, wie ich es mittlerweile verstand, und tanzten, mit Matsch und Zapfen um sich werfend, um die Hütte. Bis ein hagerer Mann mit wackelndem Turban auf dem Kopf aus dieser gestürmt kam. Auf groteske Art humpelnd. Ein schrecklicher und beschämender Anblick. John und Gallegina fanden die Situation lustig. Zugegeben: ich gleichfalls. Das Humpeln schränkte den Mann nicht ein, sondern schien ihn im Gegenteil anzuspornen. Wild mit den Armen fuchtelnd und mit einem ohrenbetäubenden Schrei stürmte er heraus und versuchte, uns zu ergreifen. Wegen der Überraschung und der Absurdität der Situation wäre es ihm bei mir fast gelungen. Körperliche Einschränkungen mussten nicht unbedingt Defizite darstellen. In der Hinsicht ähnelte er John und seinen wiederkehrenden Erkrankungen. Der Wille entscheidet, und der Wille des Turbanmannes schien mir gewaltig. In einem Gebüsch versteckt, in sicherer Entfernung, sahen wir ihn toben, bis er irgendwann in die Hütte zurückkehrte. Wie ein gefährliches Tier, das dort auf uns lauerte. Schlimmer als das, ein Monster sei er, behauptete Gallegina. Der Mann sei ein Silberschmied und habe den Verstand verloren, weshalb er ganz allein im Wald hausen müsse. In dem Dorf, in dem er einst gelebt hatte, seien Kinder verschwunden. Blutspuren hätten zu seinem Haus geführt, fügte John hinzu, aber gefunden habe man von den Kindern keines mehr. Sie blieben verschollen. Das Grinsen auf den Gesichtern der Freunde ließ mich am Wahrheitsgehalt der Aussage zweifeln. Das tosende Gemüt des Mannes, das ich erlebt hatte, ließ mich am Zweifel zweifeln. Es beruhigte mein Gewissen, niemand Unschuldigen tyrannisiert zu haben. Schließlich war es grausam, einen einsamen Menschen mit Hinkefuß zu attackieren. Es gibt kein vernünftiges Motiv für derartiges Verhalten. Ein Verhalten, das wir anschließend fast täglich wiederholten: das Bewerfen des Hauses inklusive der Se-quo-yi-Schmährufe. Plus Wettrennen mit dem hinkenden Silberschmied. Ein unverschämt schmachvolles Vergnügen. Wenn die Geschichte keine Wendung genommen hätte, wäre sie mein Geheimnis geblieben, für das ich mich im Stillen geschämt hätte. Da ich damals jedoch nichts vom Ausgang ahnen konnte, blieb die Scham. Ein wenig. Die erste Veränderung im Spiel – es war nicht mehr und nicht weniger als ein Spiel, wir waren Kinder – trat ein, als er begann, uns mit eigenen Geschossen im Haus aufzulauern. Er war flink und zielsicher. Kämpferisch uns ebenbürtig oder gar überlegen. Zumindest Gallegina und mir. Unser Vorteil war, dass er allein und wir zu dritt waren. Je aufmerksamer er unsere Angriffe parierte, desto spannender, desto mehr Spaß bereitete das Spiel, umso weiter trieben wir es. Irgendwann hoben wir im Wald eine Grube aus, füllten sie mit Blättern, Erde und Wasser, durchrührten die Pampe mit Ästen und überdeckten sie mit dünnen Zweigen und welkem Laub. Am nächsten Se-quo-yi-Tag stürmten wir nach der Attacke durch den Wald, lockten ihn hinter uns her und rannten direkt auf die Falle zu. Wir sprangen über sie hinweg, und er klatschte hinein. In den Dreck. Ein Anblick zum Johlen. Unser letzter Sieg. Beim nächsten Mal hatte sich das Blatt gewendet. Unser Vorteil war zu unserem Nachteil geworden, weil wir fest mit ihm gerechnet hatten.
Es begann wie gewohnt mit unserem Angriff. Wir hatten uns an unserem üblichen Platz vor der Hütte aufgestellt, die Munition griffbereit. Ein erfahrener Krieger hätte sich niemals so dumm angestellt und fortwährend die gleiche, wenn auch erfolgreiche Strategie angewandt. Keiner von uns war erfahren. Im Gegensatz zum Silberschmied. Nun hatte er uns einen Hinterhalt gestellt. Gerade als wir begannen, »Se-quo-yi« zu brüllen, flogen uns Eicheln und Lehm in den Nacken. Wir drehten uns erschrocken um, und jeden traf eine schleimige, schimmelstinkende Tomate im Gesicht. Hinter uns stand ein drahtiger Cherokee mit bunt tätowierten Armen. Lässig jonglierte er drei faulige Tomaten, die spritzend die Hände wechselten. Neben ihm ein Kerl, ein Krieger, älter, größer und kräftiger. Silber hing ihm am Hals, an den Ohren und Armen. Halb Metall, halb Mensch. Die Pranken waren mit Lehmklumpen gefüllt. Abwurfbereit. Der Wirklichkeit gewordene Albtraum aus meiner Vergangenheit.
»Ach du Schreck, Gulkalaski und Corn Tassel!« Panik lag in Galleginas Stimme. Wir drehten uns gleichzeitig um. Diesmal zur Flucht. Der Rückzug, oder vielmehr der Weg an der Hütte vorbei, war versperrt. Von Se-quo-yi und von einer sehnigen, alten Frau mit wirbelndem weißen Haarschopf. Vor ihnen auf dem Boden lag ein Korb voller Tomaten. Matschig, grün-weiß-pelzig vor Schimmel. Beide griffen in den Korb und stellten sich vor uns auf.
»Das ist Nanye-hi! Oder?« Wieder drehten wir uns um. John griff nach unten zu seinen gesammelten Wurfgeschossen. Noch bevor er sie ergreifen konnte, trafen ihn von beiden Seiten die widerlich stinkenden Tomaten. Er rutschte aus und fiel auf das eigene Fichtenzapfendepot. Hohnvolles Gelächter. Der drahtige Gulkalaski schüttelte sich vor Lachen, warf weiter nach uns, traf jedoch bloß noch den Boden. Corn Tassel ließ juchzend die Lehmklumpen fallen. Nanye-hi und der Sequoyi-Geschmähte feierten lauthals johlend ihren Triumph.
Siegesgeheul gellte durch den Wald.
Plötzlich kehrte mein Gewissen zurück. Oder vielleicht war es einfach nur die Angst. Im Angesicht meiner Albtraumkrieger brabbelte ich Entschuldigungen und flehte um Gnade. Sequoyah wollte nichts davon hören. Nicht aus Zorn. Im Gegenteil: Er selbst hatte jeden Morgen auf unser Erscheinen gewartet, um aus der Hütte zu stürmen und uns bei der Flucht zu beobachten. Es war sein Spiel genauso wie unseres gewesen.
»Dachtest du wirklich, er würde nicht mitspielen?« John und Gallegina warfen mir entsetzte Blicke zu. »Das wäre doch total mies!«
»Ihr sagtet, er wäre ein Monster, das Kinder zer …«
»Ein Monster?« Der Silberschmied sah vorwurfsvoll zu John und Gallegina, die grinsend mit den Schultern zuckten. »Nun, ich würd sagen ein verwandtes Monster.«
»Verwandt?« Ich musste noch viel lernen.
»Entfernt verwandt, ja.« Eine Überraschung folgte auf die nächste. Mir schwirrte der Kopf.
»Nur die Schlammfalle letztens, das war …« Der Finger des Silberschmieds durchbohrte anklagend die Luft.
»Grandios«, beendete die wild dreinschauende Alte neben ihm den Satz. Ihr weißes Haar wippte so begeistert, wie ihre Augen lebhaft funkelten. »Das hätte ich gern miterlebt!«
Der vorwurfsvolle Blick verlor an Anklagekraft, der erhobene Zeigefinger wendete sich der alten Frau zu. Der Silberschmied sah sie an, der Finger sank, und er lachte: »Ja, Nanye-hi, ich bin auf den einfachsten Trick der Welt hereingefallen. Wie der letzte Tölpel.«
»Gut gemacht, Jungs!«
»Du bist es wirklich? Die Nanye-hi?«
Die Alte lächelte mild. John und Gallegina starrten sie stumm staunend an, als ob Selu, die Mutter Erde, persönlich vor ihnen stünde.
»Kann mich mal jemand aufklären …«, bat ich und deutete auf die Alte, »… was es mit dieser … Nancy auf sich hat.«
»Nancy. Schon wieder einer, typisch Rotrock«, spottete der Gulkalaski-Genannte. »Ganz wie dein Mann Bryan. Hab ich nicht Recht, Sequoyah?«
»Se-quo-yah?«, wiederholte ich überrascht die Silben, die ich in ähnlicher Weise tagelang als Spottwort benutzt hatte. Wieder eine Überraschung. Sequoyah, der mit dem Schweinefuß. War das wirklich sein Name? Die Vorstellung, dass sich jemand so nennen würde, war abwegig. Das wäre, als ob wir Schüler den Lehrer Abraham Steiner mit Mr. Jähzorn ansprächen. Grotesk und unvorstellbar. Und real. Im Grunde sogar einleuchtend: Wer sein Manko stolz vorzeigt, der braucht es nicht zu verleugnen oder zu verstecken. Keine Kraft wird mehr verschwendet, um den Schwachpunkt zu verbergen. Schwäche wird zu Stärke. Sequoyah war der Beweis dafür.
»Den Fuß sieht doch eh jeder, warum soll ich mich dann nicht nach ihm benennen?«, erklärte er, erheitert von der Entdeckung meiner Verwirrung. »Aber wenn es dich stört, kannst du George Gist zu mir sagen.«
Ich entschied mich für Sequoyah. Es war seine Entscheidung, sie war logisch. Warum sollen wir unser Leben lang die Namen tragen, die unsere Eltern uns nach der Geburt gaben? Bevor sie wissen konnten, wer wir in Zukunft sein werden. Da ist es viel sinnvoller, sich später so zu benennen, wie wir wirklich sind: Sequoyah, der mit dem Schweinefuß; Tsawagakski, der Ständig-Rauchende; Yunwinsgaset, der gefährliche Mann; oder Ahuludegi, der die Trommel wegwirft. Galleginas kleiner Bruder Degataga, der Standhafte, würde den Namen vermutlich bis zum Ende seines Lebens tragen. Und Gulkalaski hieß, der aus schiefer Position fiel, weil er als Baby aus seiner Wiege kippte. Was Bestand hatte. Seine Position wirkte immer schief. Nett, aber schief war sein Naturell.
»Ja, die Rotröcke! Gefährliche Waffen, aber keinen Verstand bei den einfachen Dingen«, warf Gulkalaski ein. Seine geringe Meinung von den Engländern äußerte er gern und oft. Ob es in den Zusammenhang des Gesprächs passte, war ihm egal. Er sprach es aus, wenn ihm gerade danach war. Im Zweifelsfall passte es. Im Unabhängigkeitskrieg hatten sein Vater und die Cherokee auf Seiten des Vereinigten Königreichs gekämpft und verloren. Und Gulkalaski übernahm die Überzeugung des Vaters, die Rotröcke, wie er sie abfällig nannte, hätten feige aufgegeben und die Cherokee im Stich gelassen. Was er ihnen übel nahm. Zumal die Cherokee die Niederlage mit viel Land bezahlten. Mit dieser Einschätzung der Geschichte stand er nicht allein, ich hörte sie im Laufe der Jahre häufig: die Vertreibung der Cherokee aus den ursprünglichen Siedlungsgebieten in den östlichen Appalachen. Eine Schande und Ungerechtigkeit, über die sich kaum jemand dermaßen wortreich wie Gulkalaski ausließ. Diesmal war ich das Ziel des Vorwurfs, begründet auf dem Unverständnis von Namensgebungen. Absurd. Hätte ich Gulkalaski bereits näher gekannt, hätte ich es unkommentiert hingenommen.
»Nein, ich bin kein Engländer. Ich bin …«, schrie ich erbost über das Vorurteil. Doch bei aller Empörung blieb für mich ein Problem bestehen: Ich war zwar kein Engländer, doch was und wer war ich dann? Mit Vater sprach ich Deutsch. Er sagte, das sei die Sprache unserer Ahnen. War ich also Deutscher? Ich war nie in dem deutschen Land gewesen. Existierte ein Land mit dem Namen überhaupt? Wenn ja, wo lag es? Vater hatte über seinen Vater einmal erzählt, dass er aus Böhmisch-Rixdorf gekommen sei. War ich also ein Böhme? Gab es die? Von der preußischen Tugend des Großvaters im Kampf berichtete er. Einmal, als er betrunken war. Mit Stolz in der Stimme. Damals hatte ich nicht genau zugehört, war darauf bedacht, keine falsche Reaktion zu zeigen. Bedeutete es, dass ich ein Preuße war? Noch ein Land, von dem ich keine Ahnung hatte, ob es existierte, und wenn, wo es lag. Ich, ein Preuße? Nur weil mein Großvater einer gewesen war. War er denn wirklich einer gewesen? Schließlich hatte er sein Land verlassen. War in die USA emigriert. Folglich wäre ich ein US-Amerikaner. Logisch. Meine Mutter kam aus den USA, aus Boston. Soweit ich wusste. Vater war im Dienst für die USA tätig. Da war ich mir sicher. US-Amerikaner also! Trotzdem: Es fühlte sich falsch an. Irgendwie. Wie es sich stattdessen für mich hätte richtig anfühlen sollen, wusste ich nicht. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf, gleichzeitig, und keiner gab eine passende Antwort. Am liebsten hätte ich gerufen: »Ich bin ein Cherokee!« Nur das stimmte am allerwenigsten. Das wussten die anderen besser als ich selbst. Ich gehörte einfach zu niemandem. Alle starrten mich erwartungsvoll an. Mein Satz blieb von mir unbeendet.
»Adahy«, half mir schließlich Gallegina aus der bedrückenden Stille. Der in den Wäldern lebt? Seine Antwort gefiel mir. Ich kam aus dem Wald, ich lebte dort, es war meine Heimat, solange ich mich zurückerinnern konnte. Es klang fast, als wäre ich ein Cherokee.
»Ja«, bestätigte ich. Ein Waldmensch, ja, das war ich, der Adahy.
Die Begegnung mit Sequoyah veränderte mein Leben nachhaltig. Seit dem Tag war er ein fester Bestandteil meiner neuen Welt. Wenn uns dreien, John, Gallegina und mir, nichts mehr einfiel, was wir anstellen konnten, gingen wir zu ihm, spielten unser altes Spiel mit ihm oder halfen ihm beim Bewirtschaften seines kleinen Hausackers. Dass Sequoyah Hilfe bedurfte, stand außer Frage. Zeigte er als Silberschmied großes Talent und war ihm auch das Wissen um Nutzen und Heilkraft der Pflanzen vertraut, so fehlte ihm jedoch jede Begabung, diese sorgsam aufzuziehen, zu versorgen und zu hegen. Auf der eingezäunten Erde um seine Hütte sollten Mais, Kürbisse und Bohnen wachsen. So sagte er. Woher die gammeligen Tomaten stammten, sahen wir. Ohne die Hilfe von Nanye-hi wäre Sequoyah verhungert. Die Alte brachte ihm Obst, Getreide und Gemüse. Gulkalaski versorgte ihn mit Wildbret. Gulkalaski lebte zwar weit entfernt in den östlichen Appalachen, besuchte Sequoyah aber häufig genug, so dass die Trockenfleischvorräte nie zur Neige gingen. Sequoyah war ein zwiespältiger Mensch: Einerseits lebte er einsiedlerisch abseits der Dörfer, mied den Kontakt, um ›die innere Verbindung zum Großen Geist herzustellen‹, wie er es bezeichnete. Andererseits gab es kaum eine Gelegenheit, ihn allein anzutreffen. Es war immer Besuch in der Hütte. Er hielt gegenüber Freunden lange Reden über autarkes Leben, wie es eines Cherokee geziemt, während draußen John, Gallegina und ich seinen Garten versorgten. Mit Gulkalaski und Corn Tassel saß er die Nächte am Feuer, trank Maisschnaps und aß Bohnenbrot. All das, was die mitgebracht hatten. Sie wetterten vereint gegen die Stammespolitik, dass sie sich auf dem falschen Weg befänden und die Abkehr von den Traditionen fehlgeleitet sei. Die althergebrachte Kultur müsse erhalten bleiben, predigte Sequoyah und kleidete sich in edle, farbige Stoffe mit stolzem Turban auf dem Kopf. Zu welcher Kultur die Kleidung gehörte, blieb sein Geheimnis. Die US-Einflüsse verabscheute er und beherrschte gleichzeitig deren Schmiedetechniken besser als die meisten Schmiede in Georgia und Tennessee. Seine Lebensweise wies kaum Ähnlichkeit mit der aus den eigenen Geschichten auf. Er verkroch sich im Winter nicht in einem Asi, einem Erdhügel, sondern hauste in einem Blockhaus, das aus Holzstämmen gebaut war. Es wurde mit einem Felssteinkamin beheizt und war eingerichtet mit Mobiliar, das sogar den europäischen Teil seiner Ahnen beeindruckt hätte. Der Schmuck hingegen, der an seinem Körper und an den Wänden des Hauses hing, entsprach in Material, Verarbeitung, Farben und Mustern genau der Tradition, die er predigte. Neben den Schmuckstücken fiel noch etwas anderes in der Hütte sofort ins Auge: Überall lagen Holztafeln mit Symbolen. Auf dem Boden, auf dem Tisch, sogar im Bett. Hunderte, vielleicht Tausend. Der Versuch einer Schrift, behauptete er, als ich ihn danach fragte. Mehr als ein Versuch war es nicht, verstand ich. Im Haus lagen verstreute Stapel und Haufen dieser Symboltafeln. Überall. Niemand hätte sich so viele Zeichen merken oder gar unterscheiden können. Das Einzige, was sie bewirkten, war das Haus in Chaos und Unordnung zu bringen. Dass er in dem nicht allein wohnte, erfuhr ich erst mit der Zeit. Amayeta, seine Frau, und Galihali, seine Tochter, lebten mit ihm dort. Doch anzutreffen waren sie selten. Amayeta so gut wie nie. Sie sei bei ihren Eltern, bekam zur Antwort, wer nach ihr fragte. Auch Galihali begegnete ich erst wesentlich später, und es wirkte, als sei sie selbst nur zu Besuch.
Zeitgleich kam es zu einer anderen Begegnung. Der zwischen Sequoyah und meinem Vater. Sequoyah hatte mir aus Dankbarkeit für die Hilfe im Garten ein edles Schmiedestück geschenkt. Er besaß große Mengen von denen. Eine bis zum Rand gefüllte Truhe stand im Haus. Mit Schmiedestücken, die er selbst hergestellt hatte und die er niemandem anbot. Und niemand mehr für ihn anbot. Amayeta hatte es in der Zeit getan, bevor die Idee einer Cherokee-Schrift ihn beschäftigte. Oder verhexte, wie Amayeta es nannte. Im gleichen Maß, wie seine Arbeit an der Schrift zunahm, ging ihre mit den Tauschgeschäften zurück. So wie ihre Zeit im gemeinsamen Haus im Wald. Irgendwann begann er, die Objekte zu verschenken. An Gulkalaski, Tassel, Nanye-hi, Gallegina, John und mich. Als dankbare Gegenleistung für unsere Hilfe und um Platz zu schaffen für die Symboltafeln. Ich erhielt von ihm ein Medaillon an einem Lederband, etwa halb so groß wie meine Hand. Rund und silbern wie ein Mond, auf dem ein Wolf brüllte. Die Augen des Wolfes, kleine blaue Steine, brachen das Sonnenlicht derart, dass auf dem Metall des Medaillons ein grünlicher Schimmer reflektiert wurde. Als ob der Wolf mitten im Wald stünde. Seit Amayeta seine Frau war, gehörte er dem Wolfsclan an, sagte Sequoyah, deshalb sollte ich das Medaillon in Ehren halten. Als ich es abends mit nach Hause brachte, fiel es Vater alsgleich auf. Die Form zeichnete sich durch den Stoff meines Hemdes ab. Das Misstrauen im Blick meines Vaters wechselte sofort zu Habgier, als er es in Händen hielt.
»Von wem hast du das?«, fragte er, während er fasziniert das Metall abtastete.
»Gefunden«, log ich.
»Von wem?«, knurrte er zunehmend ungeduldiger.
»Das war mein Lohn«, antwortete ich ängstlich.
»Das war nicht meine Frage«, hakte er unwirsch nach und zog mich dicht an sich heran. Es bedurfte keiner weiteren Drohung. Ich erzählte ihm von Sequoyah, und er tat etwas, was er nie zuvor getan hatte. Er tätschelte meine Wange. Seine Zuneigung galt genauso wenig dem Schmuck wie mir.
»Stell mich diesem Sequoyah vor«, bestimmte er.
»Aber er spricht nur Cherokee, und du, du …«
Damit endeten meine Ausreden, und Vaters kurze Zeit des Handels mit Sequoyah begann. Er zwang mich, ihn sofort zu Sequoyah zu führen. Mir blieb keine Wahl. Als wir bei ihm eintrafen, war der, wie so oft, nicht allein. Ein schmales Mädchen, etwa fünf Jahre alt, mit dunklen Zöpfen und fast schwarzen Augen öffnete die Tür. Zaghaft wie ein Gast. Aber warum sollte Sequoyah ein Kind besuchen kommen? Ich starrte sie verwirrt an. Sie war mir unbekannt und gleichzeitig irritierend vertraut. Ich hatte sie nie zuvor gesehen und trotzdem den Eindruck, sie zu kennen.
»Oh, Adahy, schön, komm herein«, rief Sequoyah von drinnen heraus, als er mich in der Türöffnung sah. Die Wörter kamen zögerlicher, als er Vater neben mir erblickte. »Meine Tochter Galihali kennst du wohl noch nicht.«
»Deine Tochter, ja klar.« Ich verstand das Offensichtliche, die Vertrautheit und Ähnlichkeit. Wenige Tage zuvor hatte mir Gallegina von ihr und ihrer Mutter erzählt, als ich fragte, warum Sequoyah allein im Wald lebte. Die Geschichte mit den Morden an den Kindern der Nachbarn war da bereits zur Anekdote über meine Leichtgläubigkeit verkommen. Galihali, die Schöne? Tatsächlich war sie ein ausgesprochen hübsches Kind. Verwirrt sah ich von Sequoyah zu seiner Tochter und zurück. Bislang war ich Amayeta nicht begegnet, doch im Angesicht der gemeinsamen Tochter stellte ich mir eine Frau vor, die von Mutter Erde selbst geschaffen worden war. »Ist deine Frau denn auch hier?«
»Und wer ist das?«, ignorierte er missgelaunt die Frage.
»Mein Vater«, antwortete ich entschuldigend auf Cherokee. Ob er wegen der indiskreten Frage nach seiner Frau oder wegen der ebenso indiskreten Anwesenheit meines Vaters ungewohnt gereizt reagierte, war gleichgültig. Ich war mir sicher, dass ihm der Grund des Besuchs meines Vaters noch weniger gefallen würde.
»Dein Vater? Was bringst du ihn her?«, knurrte Sequoyah und zeigte abfällig auf meinen Vater.
»Was sagt er? Redet er über mich?«, fauchte mein Vater, als er Sequoyahs abfälligen Fingerzeig bemerkte.
»Was sagt er? Redet er über mich?«, fragte Sequoyah, der kein Wort Englisch sprach.
Ein Familientreffen hatte ich mir anders vorgestellt. Genauer gesagt, hatte ich es mir gar nicht vorgestellt, hätte alles unternommen, um es zu verhindern. Und hatte nichts getan, um Vater von hier fernzuhalten. Erneut lehrte mich das Leben, dass die Menschen und die Zukunft unberechenbare Partner sind. Im positiven wie im negativen Sinne. Entgegen meiner Erwartung zeigte sich Sequoyah keineswegs abgeneigt Vaters Vorschlägen gegenüber. Er witterte vielmehr ein Geschäft, um das er sich selbst nicht kümmern musste. Alle Traditionen hin oder her, er erkannte seine Möglichkeit. Vater schlug vor, die Silberwaren nach Übersee zu verschiffen. In Europa seien echte indianische Preziosen, vom Tomahawk über Schmuck bis zur Pfeife, beliebte Accessoires in den vermögenden Haushalten, versicherte Vater. Woher er sein Wissen hatte, war mir ein Rätsel. Ich übersetzte für ihn. Somit sei es eine Art der Völkerverständigung, redete Sequoyah sich den Handel schön. Zwiespältigkeit war Sequoyahs Natur. Um die Echtheit des Schmucks zu beweisen und den Wert zu garantieren, müsste er mit den Waren nach Europa reisen, verlangte Vater. Dazu war Sequoyah nicht bereit. Er wollte seine Heimat nicht verlassen. Außerdem könnte er dann keinen weiteren Schmuck schmieden. Das war ein Argument, das Vater widerwillig einsah.
»Das macht die Waren leider billiger«, erklärte er, während er mit den Fingern und Augen die Schmuckstücke taxierte. »Mit einer Beurkundung jedoch oder einem Signet kann es trotzdem funktionieren.« Hier kam meine Übersetzung ins Stocken. Weder verstand ich, was Vater damit andeuten wollte, noch wusste ich es zu übersetzen.
»Der Name von ihm auf jedem Stück«, erklärte er und deutete mit dem Daumen auf Sequoyah. »Das sollte funktionieren, denke ich. Schrift gibt Vertrauen.«
Sequoyah war begeistert von der Idee, seinen Namen als Zeichen auf die Silberarbeiten zu gravieren, zum Beweis der Herkunft. Es war ein ökonomischer Aspekt der Idee, die er dem Stammesrat immerzu vorschlug. Eine Schrift für das Cherokee, als ›Zeichen der Wahrhaftigkeit‹, wie Sequoyah sie nannte. Die Symbole, die überall in der Hütte herumlagen. Eines für den eigenen Namen zu ersinnen, daran hatte er bislang nicht gedacht. Sofort kritzelte er etwas auf die Rückseite einer Tafel, die er vom Boden auflas, und reichte sie Vater. Für den war damit das Problem gelöst. Er sah die möglichen Gewinne des Geschäfts und ging vergnügt nach Hause. Dort wollte er Briefe an Freunde in der Hauptstadt aufsetzen, die in Übersee Handel trieben. Von welchen Freunden er sprach, war mir schleierhaft. Der einzige, dem ich je begegnet war, war Wilhelm Wirt, der Anwalt. Dass der gleichzeitig als Händler, gar Silberschmuckhändler, in Übersee Geschäfte betrieb, schien mir ausgeschlossen. Außer Wilhelm Wirt war ich bei Vater ausschließlich Leuten wie James Vann, Abraham Steiner und Gottlieb Byhan begegnet. Die als Freunde zu bezeichnen, erschien zumindest fragwürdig. Meine Zweifel behielt ich für mich. Vaters Stimmung war zu gut. Als er gegangen war, warf Sequoyah zufrieden die Tür hinter ihm zu. Um weder ihn noch seine Tochter anzugucken, blickte ich auf das Symbol auf der Tafel, die Vater beim Verlassen des Hauses nachlässig auf den Tisch geworfen hatte.
»Ähm?« Zu meinen Füßen lag ein Holzstück mit dem gleichen Symbol. »Kann es sein, dass du das schon einmal benutzt, also erfunden hast?«
Sequoyah sah mich fragend an, und ich deutete von dem Holzstück auf dem Tisch zu dem am Boden. Sein Blick folgte dem Hinweis. Er hob das Holztäfelchen auf, verglich das Zeichen mit dem auf dem Tisch, warf es deprimiert auf den Zwilling und ließ sich zwischen all die anderen Symbole zu Boden fallen. Sie waren bloß noch nutzlose Kerben auf Hölzern. Das vernichtende Urteil stand in Sequoyas Gesicht geschrieben, was jeder lesen konnte, der ihn kannte. Galihali kicherte unbekümmert, griff nach den beiden Brettchen auf dem Tisch und schmiss sie in das Feuer im Kamin. Ihr Lachen und ihre Art, mit Rückschlägen umzugehen, gefielen mir.
»Ich fürchte, du solltest eine einfachere Schrift erfinden. Eine, die du dir merken kannst.« Galihali nahm ein Holzstück, das neben ihren Füßen lag, und schob es zu den beiden anderen im Kamin. Sequoyah warf seiner Tochter einen finsteren Blick zu, verzog entnervt das Gesicht, stand auf und drehte ihr den Rücken und mir sein Antlitz zu.
»Adahy.« Er zog mich verschwörerisch beiseite. »Du lernst doch in dieser Schule eure Schrift. Zeig mir mal, wie die funktioniert. Könnte man damit meinen Namen schreiben?«
Nichts einfacher als das. Dachte ich. Was sich schnell als Fehleinschätzung erwies. ›Sequoyah‹ zu sagen, war einfach, es in mein Schulalphabet zu übersetzen, schien unmöglich. Als ob die eine Sprache die Schrift der anderen verspottete. So wie Galihali meine gescheiterten Versuche. Um mich nicht vollends lächerlich zu machen, gab ich lieber auf. Sequoyah hingegen nicht. Dass es mit meiner Schrift nicht funktionierte, hieß schließlich einzig, dass es eben mit ihr nicht funktionierte. Das Grundprinzip der Schrift könnte trotzdem hilfreich für seine Experimente sein. Er bat darum, ihm die lateinischen Symbole zu erklären. Dass sie Laute darstellten, faszinierte ihn, obwohl er die Funktionsweise anfänglich nicht verstand. Zum Beweis zeigte ich ihm unsere deutsche Familienbibel, die ich in den nächsten Tagen von zuhause mitbrachte. Ob es Englisch oder Deutsch war, war gleichgültig. Sequoyah war die eine wie die andere Sprache unbekannt. Aber die Symbolreihen gefielen ihm. Zumal sie zwei Sprachen mit ähnlichen Lauten abzubilden vermochten.
»Diese Zeichen dort …« Mit dem Finger wies er auf die Seite. »… sind eure Sprache? Laute?« Er nahm mir das Buch staunend aus der Hand, blätterte um und rieb das Papier zwischen den Fingern. »Sprechende Blätter, erstaunlich! Kann ich dieses Ding mit den Zeichen für ein paar Monde behalten?« Mit dem Ding meinte er das Buch, und ich gewährte ihm die Bitte. Das Fehlen der Bibel würde meinem Vater nie auffallen.
Das Problem mit der Signatur der Silberarbeiten löste Sequoyah ohne das Buch. Vielmehr löste Charles Hicks es für ihn. Auf seine Art. Hicks war ein angesehener Häuptling und der Oberste Verwalter des Cherokeevermögens. Er stammte aus einer reichen Familie, die ebenso europäisch wie cherokee war. Seine Eltern lehrten ihn früh die englische Sprache. In seiner Generation gehörte er zu den wenigen, die nicht nur Englisch sprachen, sondern auch lesen und schreiben konnten. Weshalb er vom Stammesrat zum Sekretär und Verantwortlichen für den Schriftverkehr mit Washington und den US-Nachbarn ernannt worden war. In seinem Haus gab es eine Bibliothek mit zwei, drei Dutzend Büchern.
»Niemand kann Sequoyah schreiben. Und wenn, wäre es zu lang, um es auf den Silberschmuck zu gravieren«, stellte Hicks fest. »Den Namen, den dein Vater dir gab, George Gist, den kann man schreiben. Benutze doch einfach die ersten zwei Buchstaben, die passen auf die Medaillons. GG – Ganz einfach.« Sequoyah verstand zwar nicht recht, was Charles Hicks ihm sagte, doch die beiden Gs, die seinen Namen darstellten, gefielen ihm.
Aus dem Geschäft wurde trotzdem nichts. Die Handelspartner, die angeblichen Freunde, denen Vater Briefe geschrieben hatte, zeigten kein Interesse an Sequoyahs Silberschmuck. Die Imitate aus den Manufakturen des Nordostens seien kostengünstiger, behaupteten sie. Mein Vater gab mir die Schuld an der, wie er sagte, »blödsinnigen Idee«. Die Hiebe steckte ich ein wie das Medaillon, das für Vater wertlos geworden war. Er warf es mir an den Kopf, als die letzte Absage eines Handelspartners ihn erreichte. Die dünne Narbe an der Stirn gehört seither zu mir, wie das Medaillon, obgleich ich es einst verlor und irgendwann begrub. Sequoyah kam der Fehlschlag sehr gelegen.
»Ach, schön! Dann hab ich mehr Zeit, mich mit meiner Aufgabe zu beschäftigen«, entgegnete er, als ich ihm die vermeintlich schlechten Nachrichten mitteilte. Begeistert durchschnitt er mit dem Jagdmesser die Luft vor meinen Augen.
»Welche Aufgabe?«
»Zeichen für unsere Sprache zu finden. Schrift, wie ihr es nennt«, erklärte er und zeigte mir ein Stück Baumrinde, auf dem er mit dem Messer neue Symbole eingeritzt hatte. Einige davon waren mir vertraut: Das G, wie er erklärte, bedeute ›Sequoyah ‹. »Bald werden wir sprechende Blätter zeichnen. Genau wie die in dem Ding von dir«, prophezeite er, wobei er mit dem Messer auf die Hildebrandsche Bibel deutete, die auf einem Tisch in der Ecke der Hütte lag. »Blätter als Gedächtnis. Das brauchen wir. Nur bin ich mir immer noch unsicher, ob ich das mit den Lauten machen soll. Oder weiter ganze Wörter ritze?« Wieder deutete er auf das G in der Baumrinde. »Oder beides? Cherokee können sich jeden Baum im Wald merken, warum nicht ein Zeichen für jeden Baum? Ähm, und für alle anderen Sachen, die wir kennen. Möglicherweise wird es etwas länger dauern.« Diese Prophezeiung wurde wahr.