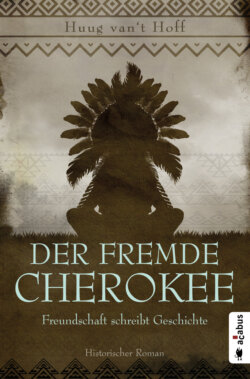Читать книгу Der fremde Cherokee. Freundschaft schreibt Geschichte - Huug van’t Hoff - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aufbruch
ОглавлениеDer Red-Stick-Anführer Menawa war am Tohopeka schwer verletzt worden. Ein Gerücht besagte, er wäre tot. Ein anderes, er sei von den vom Schlachtfeld flüchtenden Red-Sticks gerettet und in die Seminolen-Gebiete gebracht worden. Es bedeutete keinen Unterschied, welches der beiden Gerüchte wahr war. Im Sommer nach Tohopeka unterschrieb Häuptling Lamochettee den Friedensvertrag mit den USA. Die Creek verloren einen Großteil ihres Landes, sogar viele derjenigen, die mit Andrew Jackson und der US-Armee gekämpft hatten. Für die Cherokee erwies sich der Krieg vorerst als vorteilhaft. Einerseits hatten sie diesmal auf der richtigen Seite gekämpft, hatten für Washington den Sieg erstritten und für die Loyalität neue Gebiete erhalten. Andererseits wirkte die vernichtende und blutrünstige Niederschlagung des Ghostdance-Aufstands nicht bloß bei den Kriegern abschreckend, die mitgekämpft hatten. Der Ausgang des bewaffneten Widerstands der Red-Sticks war eine tödliche Warnung an alle Cherokee. Sie hieß Vernichtung oder Wandel, heroisch sterben oder sich lebendig anpassen. Die Vorbehalte und der Widerwille gegen den ›weißen Weg‹ erstarben nicht, aber die bedrohliche Alternative gab der Vernunft die Oberhand. Es war nicht der letzte Krieg, in dem Major Ridge kämpfte, aber er hatte nie wieder die Seite gewechselt. Kulturelle Annäherung, friedlicher Widerstand und Heldenmut mussten keine Gegensätze sein, sogar wenn es bedeutete, für die Verbündeten in eine Schlacht zu ziehen, die man ablehnte. Der Wandel war nicht aufzuhalten, und die Cherokee mussten beweisen, dass sie anständige Bürger und Krieger waren. Als Andrew Jackson gegen die Seminolen ins Feld zog, oder vielmehr in den Sumpf, griff auch Major Ridge loyal zur Waffe. Als Zeichen der Freundschaft zu den US-Nachbarn. Aber vor allem, weil er General Jackson für einen gefährlichen und unberechenbaren Mann hielt, dem er eine große Karriere in Washington zutraute. Er kämpfte mit ihm, obwohl, oder gerade weil er wusste, dass Andrew Jackson zeitgleich mit seinem Freund Joseph McMinn, dem Gouverneur aus Tennessee, versuchte, den Cherokee ihr Land zu nehmen. Einige Häuptlinge hatten bereits Verträge mit ihnen zum Verkauf und zur Umsiedlung ihrer Dörfer unterschrieben. Es war verboten, nicht erst seit Etowah, doch der Druck war zu groß geworden, und es war unmöglich, alle Häuptlinge dafür zu verurteilen. Die Stammesführer im Rat und National-Komitee hofften, dass die Verträge wegen ihrer Loyalität im Krieg vom Senat und Repräsentantenhaus in der US-Hauptstadt abgelehnt werden würden. Darauf vertrauen wollten sie nicht. Sie suchten sich weitere Verbündete. Obwohl John Ross und Major Ridge ahnten, dass ihre Verbündetenwahl neuen Unmut im Stamm verursachen würde, wandten sie sich an das American Board of Commissioners for Foreign Mission. Es war wichtiger, Land und Leben zu sichern als den Glauben. Außerdem war es nicht das erste Bündnis mit christlichen Missionaren. Auch die Schule in Springplace, die gleichzeitig als Kirche genutzt wurde, hatte einst Streit im Stamm und Stammesrat hervorgerufen. Jedoch waren sie gestärkt daraus hervorgegangen. So erlaubten die Häuptlinge abermals wieder anderen Missionaren, eine Schule zu bauen. Diesmal in Chickamauga, in der Nähe von Ross’ Plantage. Dafür setzten sich ihre befreundeten Senatoren und Abgeordneten im US-Kongress für die Cherokee ein. Die neue Schule bedeutete zudem eine zusätzliche Chance auf Ausbildung der Kinder. Dem gleichen Motiv folgend wie bei den anderen Schulen: Wer die Waffen des Feindes beherrscht, kann sie gleichfalls gegen ihn verwenden. Deshalb kämpfte Major Ridge für General Jackson. Deshalb tolerierte er den Wandel im Stamm nicht bloß, sondern trieb ihn voran. Trotzdem: Um zu verhindern, dass aus den einzelnen Verträgen eine Welle an Verträgen würde, die den Stamm zu spalten drohte, mussten er und Pathkiller rascher und umfänglicher handeln. Der gesamte Stamm der Cherokee musste sich den neuen Herausforderungen anpassen. Dringlicher, als sie es ohnehin taten.
Tatsächlich veränderte sich die Welt am Conasauga River. Bloß nicht in dem Maße und der Geschwindigkeit, wie es Pathkiller, Major Ridge und John Ross für das Überleben im Stammesgebiet für notwendig hielten. Georgias gerodete Wälder näherten sich genauso unaufhaltsam der Cherokeegrenze wie die Farmer, Pelz- und andere Glücksjäger, die diese täglich überschritten. Egal, ob sie von den Lighthorse-Patrole und Major Ridge aufgegriffen und zurückgeschafft wurden, sie kamen immer wieder.
Es gab schriftliche Gesetze, fixiert in englischer Sprache, die das Passieren der Grenze regelten. Cherokee-Gesetze. Der Oberste Häuptling hatte die Berechtigung, in Absprache mit National-Komitee und Stammesrat, Entscheidungen für das ganze Land zu treffen. Die Landwirtschaft breitete sich zunehmend aus. Viele Familien besaßen Webstühle. Dutzende Kornmühlen verarbeiteten die Getreideernten zu Mehl. Fast in jedem Dorf standen für die Baumwolle, die überall an den Sträuchern auf den Äckern wuchs, Engreniermaschinen, mit denen per Handkurbel rasch die Fasern von den Samen und deren Fruchtständen zu lösen waren. Einige Farmen dehnten sich zu Plantagen aus, der Baumwollertrag stieg genauso wie die Abhängigkeit von der Arbeit der Sklaven. Nah des Fährbetriebs über den Tennessee River westlich von Red Clay bepflanzten Dutzende von ihnen für John Ross weite Äcker mit Tabak und Baumwolle. Sein Reichtum und Ansehen im Stamm wuchsen wie der Ort um die Plantage und seinen Fährbetrieb. Bäume wurden gefällt, aus deren Stämmen neue Häuser errichtet, Ross Landing war bald eine Kleinstadt. Vielerorts breiteten sich die Veränderungen aus. Aber nur an wenigen so drastisch wie in Ross Landing. Von einem allgemeinen Wandel zu sprechen, oder gar Fortschritt, wäre unwahr gewesen. Es waren vor allem die Halbblut-Familien wie die Familie Ross, die schon früh mit dem Wandel ihres Lebensstils begonnen hatten, die nun noch mehr Vieh besaßen, noch mehr Flächen bewirtschafteten, noch mehr Sklaven für sich arbeiten ließen, noch mehr Kornmühlen betrieben und noch reicher wurden. Auch Major Ridge und seine Familie gehörten zu denen, die ihre Lebensweise änderten und von dem Wandel profitierten. Wie auch die von Joe Vann. Für Krieger und Jäger wie Tsali, Corn Tassel, Gulkalaski, White Path und viele der anderen hingegen blieb das Leben nahezu unverändert. Sie gingen zur Jagd, und ihre Kinder besuchten keine Schule. Ihre Zustimmung zu den Entscheidungen des Stammesrats, National-Komitees und des Obersten Häuptlings war gering. Obwohl John Ross und Joe Vann noch jung waren und beide über enormen Zuspruch und Respekt im Stamm verfügten, so taugten sie trotzdem nicht, um einer neuen Cherokee-Generation als Vorbild zu dienen. Ihre Herkunft stand ihnen im Weg. Nicht weil sie und ihre Familien ein weißes Leben führten, sondern weil unter ihren nächsten Verwandten zu wenige Cherokee und zu viele Weiße waren. Sie waren die Veränderung qua Geburt, was sie als gute Beispiele für Nutzen und Ansehen der Veränderung disqualifizierte. Eine neue Generation brauche es zum Vorbild und Vorreiter für den Stamm, da waren sich Ridge, Ross und Pathkiller einig. Eine Jugend, die genügend Cherokee war und gleichzeitig, wie sie meinten, eine bessere und vor allem überlebenswichtige Zukunft nach Art der USA darstellte. Ansonsten würden alle Versuche der Reformation der Cherokee bald gescheitert sein und der Stamm untergehen. Jugendliche waren notwendig, die nicht bloß dazugehörten, sondern durch die Anerkennung der Gleichaltrigen und Älteren das Potential für spätere Anführer hatten. Für den möglichen Weg in eine sicherere Zukunft müssten sie das Leben der US-Nachbarn studieren, um auf alles vorbereitet zu sein. Da traf es sich gut, dass Elias Cornelius vom American Board of Commissioners for Foreign Mission den Fortschritt des Schulbaus in Chickamauga beaufsichtigte. Er bot an, jungen Stammesmitgliedern ein Studium in Connecticut zu ermöglichen. Technischen Unterricht, Philosophie, Land- und Viehwirtschaft und die Lehre amerikanischer Kultur versprach er. Außerdem christlichen Unterricht. Dass Missionierung der Schüler einen Großteil der Lehre ausmachen würde, kannten die Häuptlinge von den Schulen im Stammesgebiet. Amerikanische Kultur beinhaltete alle Aspekte, die mit den Schiffen bei ihnen gelandet waren. Überleben war nur mit ihr möglich, nicht gegen sie, wussten die Häuptlinge, und in Abwägung der strategischen Vorteile einer derartigen Ausbildung nahmen sie alles andere in Kauf. Glaube war unwesentlicher als das Überleben. Und wenn ihre Kinder konvertierten, wäre es für den Erhalt der Cherokee auf dem Stammesgebiet gewiss nicht von Nachteil. An welche jungen Männer Pathkiller und Major Ridge dabei dachten, war naheliegend. Die Umsetzung des Plans wurde umso dringlicher, als die Landkaufverträge mit den abtrünnigen Dorf-Häuptlingen trotz der Hilfe der Missionare von beiden Häusern im Washingtoner Kongress ratifiziert wurden. General Andrew Jackson und Gouverneur McMinn erhöhten den Druck auf den Stamm, sie unterbreiteten neue Angebote und stellten neue Forderungen.
Sequoyah verriet mir nie, wann und wie es zu der Ehe mit seiner neuen Frau Sally gekommen war. Soweit ich es wusste, wie ich es in der Zeit zuvor erlebt hatte, verließ er seine Hütte nicht. Außer zu den Kämpfen gegen die Red-Stick. Ansonsten verbrachte er jeden Augenblick mit seinen Symbolen. Sein Körper saß in der Hütte, während sein Kopf anderswo schwebte. Wie solch ein Mann eine Frau umwerben und gewinnen konnte, war uns allen ein Rätsel. Aber es war geschehen. Sally lebte bei ihm in der Hütte im Wald, und kein Jahr später gebar sie eine Tochter. Ayoka. Wie ich erfuhr, änderte diese Tatsache jedoch nichts an Sequoyahs Verhalten. Oder vielmehr Nicht-Verhalten. Seine Häuslichkeit wurde Sally irgendwann zu häuslich, da er zwar stets daheim war, doch nie für das Heim oder Auskommen sorgte. Ohne Sally wären seine Felder verwaist geblieben. Für Wildbret sorgte Tsali, was wiederum Sally nicht gefiel. Weder mochte sie den hünenhaften Krieger, noch sagte ihr die Tatsache zu, dass er für ihren Mann und ihre Familie jagen ging. Sie schimpfte und zeterte, nannte Sequoyah einen Faulpelz. Die Vorwürfe prallten an ihm ab wie ein Pfeil an einer Felswand. Er hockte im Haus und grübelte über die Sprachsymbole, während Sally von Symbol zu Symbol streitlustiger wurde. Er hatte eine Mission, und der blieb er treu. Noch treuer als vor dem Krieg und treuer als seiner Familie. Wie es schon Amayeta vor ihr getan hatte, behauptete auch Sally irgendwann, ihr Mann sei von einem bösen Zauber besessen. Als Tsali erwiderte, dass Sequoyah vielmehr vom Großen Geist berufen sei, um den alten Zauber der Cherokee-Schrift zu empfangen, womit sein Verhalten eine normale prophetische Trance darstellte, beschloss sie, zukünftig auf die Unterstützung und die Fleischpräsente des Kriegers zu verzichten. Ob böser oder guter Zauber war einerlei, ich hielt Sallys Einschätzung von Sequoyahs verwirrtem Geisteszustand für richtig. Bei einem der selten gewordenen Besuche bat sie mich, mit ihm zu reden, ihn zur Vernunft zu bringen, ihn wachzurütteln, ihn zu warnen, dass ihr Zusammenleben unmöglich so weitergehen könnte. Vom bösen Zauber sprach sie nicht, doch Anzeichen für guten fand ich genauso wenig. Er reagierte auf meinen Besuch einzig mit Schweigen. Wie seit Monaten, ja, mittlerweile wie seit Jahren. Als stünde kein Freund und Mensch neben ihm, sondern nichts und niemand. Weniger als Luft war ich, denn die benötigte er noch zum Atmen. Für mich war in seiner Welt, in seinem Kopf, kein Platz mehr. Sofern doch, fehlten mir die Gelassenheit und die Zeit, um solch einen Platz zu suchen. Mein eigenes Leben gestaltete sich bereits viel zu kompliziert. Also ließ ich Sally und Ayoka allein mit ihm zurück.
Nach den Kriegsmonaten hatte mein Vater aus Washington größere Vollmachten für die Verhandlungen übertragen bekommen, die ihm jedoch nicht mehr Erfolge beim Landkauf einbrachten. Es gelang ihm nur sehr vereinzelt, neue Verträge abzuschließen. Und die waren den Cherokee schon zu viel, wusste ich. Sie bedrohten die Gemeinschaft. Vater erkannte hingegen mein Potential in dieser Gemeinschaft, mein Potential für seine Geschäfte. Er müsse neu planen, sagte er, und die neuen Pläne beinhalteten mein Mitwirken. Weil die Zeit in Springplace, die er mir ermöglicht habe, nun zu Ende gehe und meine Kontakte zu den Cherokee so vielversprechend seien, legte er mit befehlender Stimme fest: »Mein Sohn tritt nun in meine Fußstapfen.« Im beidseitigen Interesse sei das. Von wessen Interesse er sprach außer dem eigenen, fragte ich ihn nicht. Von meinen Interessen hatte er keine Ahnung. Meine Freundschaft zu Gallegina und John Ridge war ungebrochen, wir saßen täglich in der Schule beisammen, und den Rest der Zeit verbrachte ich ebenfalls mit ihnen. Mittlerweile war mir die Sprache der Freunde vertrauter als die meines Vaters. Ich fühlte mich den Cherokee mehr als irgendjemandem sonst zugehörig. Mehr als ihm schon gar. Meine Interessen hatten nichts mit seinen gemein. Ich war nicht wie er und wollte es gewiss nie werden. Ganz gleich, ob die Zeit in Springplace bald endete, es würde mein Verhältnis zu den Freunden nicht verändern. Zwar dachte ich zuletzt häufiger über die Zukunft nach, dabei ging es aber ausschließlich um meine Zukunft bei den Cherokee. Ich war einer von ihnen. Dass ich Vater widersprach, lag auf der Hand. Es überraschte ihn offenbar trotzdem.
»Du hast zu machen, was ich sage!«, befahl er. »Ich weiß, was du für Möglichkeiten bei den Wilden hast. Eine gute Zukunft. Nutze sie, verdammt! Ich bring dir bei, wie man das Beste und Meiste aus deinen Verbindungen herausholt.« Seine Forderungen widerten mich an. Die Freundschaft zu Gallegina und John auszunutzen, um die Cherokee um ihr Land zu bringen, schloss ich genauso aus, wie meinem Vater als Lehrling zu dienen. Das bereitete mir ebenso sehr Angst wie Ekel vor der Zukunft. Als ich ihm widersprach, kehrte die Gewalt zurück. Brutaler als je zuvor. Mehrere Schläge auf den Körper und einige ins Gesicht. Ein Zahn brach heraus, und das Nasenbein gab ein ächzendes Geräusch von sich, bevor mein Kopf sich anfühlte, als ob er von einem Beil getroffen worden wäre. Schmerz breitete sich aus, von der Schädeldecke bis zum Kinn. Blut überall. Als er mich zu würgen begann, seinen Arm gegen meinen Hals drückte, mir die Luft nahm, biss ich zu. Ihm in die Hand. Aus Reflex, nicht aus Mut. Kurz kam ich frei. Zum ersten Mal hatte ich mich seiner Schläge erwehrt. Weil es ebenso überraschend für mich wie für ihn geschah, ließ er einen Moment von mir ab und starrte verdutzt auf die Wunde, die meine Zähne in seinem Handballen hinterlassen hatten. Eine Atempause, dann ging er umso härter auf mich los. Diesmal war es kein Reflex, sondern die Verzweiflung, die mich wie ein Puppenspieler führte. Als ob ich an unsichtbaren Fäden hinge, fuchtelte und ruderte ich mit den Armen durch die Luft. Die Verzweiflung erwies sich als treffsicherer Puppenspieler. Ein harter Aufprall traf meine Fingerknochen. Dumpf, ganz ohne Schmerzen. Ein Scheppern und ein hölzernes Krachen hallten durch die Hütte. Vater musste zu Boden gestürzt sein. Die Holzdielen vibrierten beim Aufschlag seines Körpers unter meinen Füßen. Als ich meine Augen öffnete, sah ich ihn aus der Nase blutend vor dem Kamin liegen. Kalter Hass starrte mich aus seinen Augen an, und ich rannte davon. Durch die Tür, hinaus auf die Lichtung und weg. Fort aus meiner Kindheit. Es war endgültig. Mir würde keine Wahl mehr bleiben, glaubte ich.
In jener Zeit träumte ich häufig von Vaters Tod. Unter uns knackten die Knochen der Freunde, ihr Blut, in dem Vater und ich uns gegenüberstanden, verwandelte das Knacken in ein torfiges Matschen, wie von den brechenden Ästen auf dem Waldboden beim Chungke-Spiel. In den Gesichtern der Freunde, über die wir hinweg kämpften, fehlten die Nasen, und ich drosch auf meinen Vater ein. Immer und immer wieder. Er oder ich, darauf lief es hinaus. Im Albtraum wie im wahren Leben. Zwangsläufig, so schätzte ich die Lage ein, unvermeidbar wäre es. Die Wirklichkeit war eine andere. Zuweilen überrascht uns das Leben. Nachdem die äußeren Wunden verheilt waren, schlich ich zurück zu Vaters Haus. Mit einem Messer bewaffnet rechnete ich mit meinem ersten echten Kampf. Bewusst, nicht den Reflexen folgend. Gejagt hatte ich mit den Freunden, Krieg gespielt ebenfalls, jemanden angegriffen oder mich gezielt verteidigt hatte ich nie. Heute weiß ich, oder glaube zu wissen, dass es für jede Situation eine Alternative gibt. Damals sah ich keine.
Erst nach meinem letzten Tag in Springplace kehrte ich zurück. Ins Haus der Kindheit, meiner Vergangenheit, auf die Lichtung unter der Platane. Um mich von dem Mann zu lösen, der mich zwingen wollte, die Freunde zu hintergehen, der mich fortwährend tyrannisiert hatte, der meine Träume beherrschte, der mich beherrschte, solange ich und er lebten. Bis dahin. Dort in der Hütte meiner frühen Jahre traf ich ihn, meinen Vater. Nüchtern wie selten. Er hielt einen Brief in der Hand und zog bemüht eine freundliche Grimasse. Das Messer in meiner Hand übersah er, ignorierte es. Er nickte mir zu, bot mir einen Platz am Tisch an, an dem er saß.
»Gut, dass du kommst. Setz dich zu mir, ich muss mit dir reden«, überrumpelte er mich mit bitterer Höflichkeit. Ich sah ihn an, auf das Messer in meiner Hand, zu ihm und zum Messer. Mein Mut löste sich in bedrückende Beklemmung auf. Ich ging auf ihn zu. Kein Angriff folgte. Eine Geste von ihm forderte, dass ich mich zu ihm setzte. »Ich habe lange nachgedacht.« Was wollte er mit alldem bezwecken? Was wollte er von mir? »Ich trage dir nichts nach.« Das war mir neu. In Erwartung von Schlägen blickte ich auf das Messer, das ich vor mir auf die Tischplatte gelegt hatte. Es wirkte plötzlich so klein und stumpf. »Undank ist der Kinder Lohn. Wenn du deine Kontakte nicht nutzen willst, dann sind sie zu nichts Nutze. Ich habe beschlossen, du wirst zu einem Freund nach Richmond gehen. Bei ihm sollst du dann etwas Anständiges lernen. Ein Handwerk, fern deiner wilden Freunde.« Jetzt verstand ich: Da ich ihm bei seinen Geschäften die erhoffte Hilfe versagte, war ich wertlos, ja, hinderlich für ihn geworden. Schweigend sah ich ihm ins Gesicht, auf eine schiefe Nase. Nicht nur meine war gebrochen gewesen. Er sah meinen Blick. Gab unsere letzte Begegnung mir zwar nicht mehr Mut, so ließ sie ihn zumindest zögern. Er war sich seiner Macht nicht mehr sicher, erkannte ich. Wer einmal zurückschlägt, konnte es wieder tun. Er sah zu dem Messer, nickte matt und schob mir den Brief an der Klinge vorbei über den Tisch entgegen. »Hier, da gehst du hin. Leider hat Wilhelm im Moment nicht viel Zeit für dich. Irgendetwas ist dazwischengekommen, worüber er nicht sprechen will, wie er schreibt.« Wilhelm Wirt war es, zu dem ich gehen sollte. Das klang für mich schon besser. Aber wann hatte mein Vater den Brief an Wirt geschrieben, wenn er schon die Antwort in Händen hielt? Der Streit lag nicht lang genug zurück für eine Antwort. Hatte Vater bereits vor dem Streit geahnt, dass ich seinem Weg nicht folgen würde? Waren der Kampf und die Wunden unnötig gewesen? Ich öffnete den Brief, las ihn und war traurig. Es würde allemal schöner bei Wilhelm Wirt werden, als es hier jemals gewesen war. Bei Vater. Doch ihn zu verlassen, bedeutete auch, die Freunde zu verlassen. Womöglich für immer.
»Aber meine Freunde«, jammerte ich. Wie ein Kind, das ich kaum mehr war. Das Messer auf dem Tisch war vergessen.
»Bis zur Abreise kannst du so lange und so oft du willst zu denen gehen. Ein langer Abschied«, entschied er und grinste mich hämisch an, im Bewusstsein des Sieges. Wortlos legte ich den Brief neben das Messer auf den Tisch, ging und blieb fort.
Zuerst suchte ich Sequoyah in der Hoffnung auf guten Rat und Unterstützung auf. »Folge dem«, sagte er, tippte mir an die Stirn und sank zurück zwischen seine Symbole. »Bei uns kannst du unmöglich bleiben«, sagte Sally und wies mit einem Rechen, mit dem sie gerade den Hausacker von allen Pflanzen befreite, zu Ayoka, die daneben mit den Symbol-Holzstücken ihres Vaters spielte.
Von Head of Coosa den Oostanaula ein Stück flussaufwärts, in einer seichten Bucht, in der die Strömung langsamer war, die Bäume hilfreiche Schatten auf das Wasser warfen und trotzdem selten jemand vorbeikam, weil es abseits der Pfade lag, war der Treffpunkt der Freunde und der Platz, den sie aufsuchten, um allein und zusammen zu sein. Gallegina saß, wie meist, in der Sonne auf einem Felsen, fünf Schritte vom Ufer entfernt, mitten in der Strömung, während John mit einem Speer in seiner wurfbereiten Hand neben ihm im Fluss stand. Die Schatten der Bäume wehrten die Reflexionen der Sonnenstrahlen auf dem Wasser ab. Der sandig-steinige Grund des Oostanaula lag klar unter seinen Füßen, kein Fisch konnte seiner Aufmerksamkeit entkommen. Normalerweise. Einzig dem Wurf des Speers konnten sie ausweichen. Wenn auch selten. John war normalerweise ein geduldiger und treffsicherer Jäger. Anders als Gallegina. Den interessierte das, was sein Cousin da im Wasser trieb, wenig. Mit verschränkten Beinen hockte er auf dem warmen Granit des Felsens, blickte in Johns Richtung, und seine Gedanken waren weit entfernt. In der Zukunft. Die Schultage in Springplace gehörten der Vergangenheit an, für Planungspausen hatte er keine Muße und Zeit. Ihr Leben würde sich ändern. Bald. Nur in welche Richtung? Gallegina hatte Gerüchte gehört, dass der Oberste Häuptling Pathkiller und sein Onkel Major Ridge planten, aus den Reihen der Schüler in Springplace einen wegzuschicken, um das Leben der Weißen zu studieren. Elias Cornelius hatte ihnen seine Unterstützung zugesagt, wusste Gallegina. Hinter Elias Cornelius stand das American Board of Commissioners for Foreign Mission. Die besaßen Möglichkeiten der Ausbildung, die ein Cherokee nie zuvor gehabt hatte. Für eine neue Generation an Häuptlingen, wie Gallegina vermutete. Wen der Major als Obersten Häuptling der Zukunft vorsah, war logisch: den eigenen Sohn, John Ridge. Es war deprimierend, denn John würde den Plan des Vaters nur erfüllen, weil es sein Befehl war. Er würde mies gelaunt reagieren, so wie er es jeden Morgen tat, seit sie zur Schule ritten. Auf Befehl des Vaters nahm er am Unterricht teil. Aus eigenen Stücken tat er nichts. Zudem reagierte er sauer. Nicht, weil er keine Wahl hatte, sondern weil man ihm keine Wahl ließ. Doch wer John kannte, wusste, sofern er eine Wahl gehabt hätte, er hätte sich einer eigenen Entscheidung entzogen. So erfolgreich er für andere streiten konnte, so unentschlossen war er, wenn er entscheiden musste, wofür er streiten sollte. Wer konnte es Major Ridge folglich verdenken, dass er seinem Sohn den Weg in die Zukunft befehlen würde, dachte Gallegina und blickte schmunzelnd zu John, der gerade seinen Speer in das Flussbett donnerte. Um zu wissen, dass er nichts getroffen hatte, musste er den Speer nicht aus dem Wasser ziehen. Die unbeherrschte Wucht, mit der er zustieß, sprach für sich.
»Weißt du was? Ich denke, ich werde der Oberste Häuptling werden. Wie findest du das?«, stichelte Gallegina. Für seine Chance auf eine große Zukunft hatte er den Spott verdient, und Gallegina wusste genau, wie er seinen Cousin am meisten ärgern konnte. John war immer der Liebling unter den Mitschülern und Nachbarn gewesen. Dazu ein treffsicherer Jäger. Die ideale Voraussetzung für einen zukünftigen Häuptling. Jeder mochte ihn und würde ihn wählen. Sogar ohne die Ausbildung, die der Major für ihn plante, stand John der Weg offen, der Oberste Häuptling der Cherokee zu werden. Sofern er jemals beschloss, den Weg zu gehen. Was aus eigenen Stücken unwahrscheinlich war. Aber Major Ridge würde sicherlich dafür sorgen, schätzte Gallegina neidvoll. Wie richtig er mit seiner Einschätzung lag, konnte Gallegina nicht wissen. Es war der Grund, warum John dermaßen ziellos mit dem Speer auf das Wasser einstieß. Am Morgen hatte der Major die Zukunft des Sohnes verkündet. Dem Sohn verkündet. Mit John Ross’ Unterstützung hatte sein Vater Pathkiller und den Stammesrat davon überzeugt, John zur Ausbildung wegzuschicken. Die Ausbildung vom American Board. Ihm blieb keine Wahl. Die Pläne seines Vaters zu boykottieren, wäre töricht und gefährlich gewesen. Vor allem als sein Sohn. Außerdem waren die Pläne sinnvoll und klug. Das wusste John, und es verdross ihn. Den Verdruss bemerkte Gallegina, obwohl er ihn falsch deutete, und er erhöhte den Spaß, den es ihm bereitete, den Freund zu necken.
»Du?«, fauchte John, riss den Speer aus dem Flussbett und rammte ihn gleich wieder hinein. »Nee, klar. Ein Häuptling, der verhungern wird, weil er mit seinem Gerede die Fische vertreibt, anstatt sie zu fangen.«
»Fische, pah«, entgegnete Gallegina spöttisch und ließ seine Beine ins Wasser plumpsen. »Du kannst das doch so toll. Das lass ich dich dann machen! Für mich.« Galleginas Füße ruderten durch das Wasser, bis John ihn entnervt ansah. Ein breites und herausforderndes Grinsen blickte ihn an.
»Das würd dir gefallen, wie?«, zischte John aufgebracht, woraufhin Gallegina belustigt nickte. Mit einem wütenden Ruck zog John den Speer aus dem Wasser und warf ihn auf seinen Cousin. Obwohl er bloß eine Handbreit an ihm vorbeizischte, gab er John nicht die Genugtuung, sich erschrocken wegzuducken. Wenn John warf, traf er, was er treffen wollte. Und ihn wollte er gewiss nicht treffen, zumindest nicht verletzen, da war sich Gallegina sicher. Selbstgefällig grinste er ihn an. Wegducken wäre gefährlicher gewesen. Gallegina paddelte voller Spott mit den Füßen in der Strömung, während John an ihm vorbeiging, um den Speer aus dem Gebüsch am Ufer zu bergen. »Stimmt. Jemand mit deinen Riesenflossen ist zu blöd und zu tollpatschig, um Fische zu fangen. Aus Versehen tottrampeln oder besinnungslos quasseln liegt dir. Sogar Adahy kann besser als du mit dem Speer umgehen.«
Eine gemeinsame Kindheit kennt keine Geheimnisse. Auch John wusste, womit er den Cousin reizen konnte. Obwohl Gallegina selbst gern Witze über seine eigene Unzulänglichkeit bei der Jagd riss, durfte die Tatsache nur für ihn als Ausrede dienen, aber nicht gegen ihn verwendet werden. Die Eitelkeit war sein wunder Punkt. Die Behauptung, jemand könne etwas besser als er, sogar wenn es ums, seiner Ansicht nach, bescheuerte Jagen ging, machte ihn nervös. Ganz gleichgültig, ob das Gesagte der Wahrheit entsprach oder nicht. Obwohl er genau wusste, dass John es gezielt einsetzte, traf es ihn.
»Was? Adahy bewegt sich mit dem Speer im Fluss so tapsig wie ein Bär auf dem Eis.«
Jetzt war es John, der überheblich grinste. Er war treffsicher gewesen, wie immer. Was Gallegina ärgerte. Umso mehr, weil er ahnte, dass John es nicht dabei belassen würde. Hinter Gallegina zog er den Speer aus den Ästen des Gebüschs und machte sich auf den Weg zurück in die schattige Mitte des Flusses. Im Vorbeigehen klopfte er ihm auf die Schulter. Mist, haderte Gallegina mit sich selbst, warum habe ich bloß damit angefangen, ihn zu ärgern?
»Ein tapsiger Bär ist immer noch ein Bär und kann gefährlich werden!«
Weil ihm die Argumente ausgingen, weil er Johns Sieg der Worte partout nicht zulassen wollte, weil er zitterte vor Wut und vor Neid und weil es an der Zeit war, so zu handeln, sprang Gallegina auf ihn. Gemeinsam stürzten sie in den Oostanaula River.
Warum ich überhaupt bei Sequoyah als erstes eine Zuflucht und Verständnis suchte, obwohl es offensichtlich weder Sinn ergab noch Hoffnung bot, hatte einen simplen Grund. Es sollte gegen die Angst helfen, dass alles vorbei sein könnte, was ich immer als sicher erachtet hatte. Es war klar, dass es für mich in seiner Hütte keinen Platz gab. Warum ich mich trotzdem gleich nach der verstörenden Planung meiner Zukunft durch Vater und dem damit zwangsläufig verbundenen Abschied von meiner Vergangenheit im Cherokeegebiet auf den Weg zu Sequoyah gemacht hatte, lag in der tiefen Hoffnung auf Verlässlichkeit. Nicht jener Verlässlichkeit, dass er mich bei sich aufnehme, sondern der, dass sich bei ihm nichts verändert hatte. Trotz und wegen der Obsession, trotz und wegen der neuen Frau, die mich im Haus niemals lange duldete, trotz und wegen des kleinen Kindes, neben dem ich keinen Platz finden konnte. Genau das trat ein. Es beruhigte mich und gab Sicherheit in der allgegenwärtigen Unsicherheit. Denn bei den beiden, die mir am vertrautesten waren, wusste ich nicht, was mich erwartete. Nach der letzten gewaltsamen Auseinandersetzung mit Vater, nach der gebrochenen Nase, war es leicht gewesen, bei ihnen unterzukriechen. Seit wir uns kannten, war es immer so gewesen. Es entsprach der Gewohnheit der Kindheit. Sobald das Zuhause zu gefährlich wurde, boten ihre Familien mir eine sichere Heimat. Jetzt war die Kindheit plötzlich vorbei. Es hatte für die Veränderung nur wenige Tage gebraucht. Zuvor war alles noch direkt und unmittelbar gewesen, klar und eindeutig. Die Gewalt war körperlich gewesen, die Gefahren hautnah. Mit dem Abschied in Springplace begann die neue Zeit. Vaters Plan, mich nach Richmond zu Wirt zu schicken, war der Anfang. Die unüberschaubare Zukunft bedrohte die Gegenwart. Unaufhaltsam war sie angebrochen und zu einem unbekannten Gegner herangewachsen. Einem, der nie zu besiegen war, weil man ihm erst begegnete, wenn alles entschieden und vorbei war.
Weil John und Gallegina am gleichen Punkt im Leben standen, fürchtete ich, dass unser aller Leben zukünftig womöglich an Gemeinsamkeit und Gemeinschaft einbüßen würde. Das Ende der Kindheit. Wie ihre Zukunft aussah, wusste und ahnte ich nicht. Ebenso wenig wie, ob ich weiterhin ein Teil davon sein würde. Für ein paar Tage konnte ich möglicherweise bei ihnen in Head of Coosa und Oothcaloga unterkommen. Aber was würde nach den wenigen Tagen, die blieben, kommen? Hatte ich in den Dörfern der Cherokee eine Zukunft? Gab es für mich eine Chance, nicht nach Richmond in die Ungewissheit zu gehen? Ohne die Hilfe von John und Gallegina gewiss nicht. Es schien ausgeschlossen, dass uns der gleiche oder auch nur ein ähnlicher Weg bevorstünde. Wenn ich nicht umhinkommen würde, nach Richmond zu gehen, würde die gemeinsame Welt spätestens dann enden. Und nach der Zeit würde es für mich vermutlich kein Zurück mehr geben. Für Gallegina und John hingegen war in der Cherokee-Heimat immer ein Platz. So sah es jedenfalls damals für mich aus.
Ich ritt nach Head of Coosa, ohne zu wissen, wohin es für und mit uns weitergehen würde. Nachdem ich sie dort nicht vorfand, trieb ich Schneeball das kurze Stück nach Oothcaloga an, zum Hof von Galleginas Eltern. Als ich sie dort ebenfalls nicht antraf, blieb nur noch ein Ort übrig, an dem sie sich vermutlich befinden würden. Sofern nicht alles anders war.
Ich ritt Richtung Ustanali, verließ die Trasse und zügelte das Pony dem Oostanaula River entgegen, um die beiden an unserem Platz im Fluss anzutreffen. In meiner Vorstellung stand John da mit dem Speer auf Fischfang, reglos und gespannt wie ein Reiher, während Gallegina auf dem flachen Granitfelsen mitten im Fluss hockte und Pläne schmiedete. So wie es immer gewesen war. Als ich diesmal Schneeball zum Oostanaula führte, durchfuhr mich ein Schrecken. Niemand war dort. Jedenfalls war niemand zu sehen. Hinterm Felsen, auf dem Gallegina gewöhnlich saß, stob Wasser auf. Was Gefahr bedeuten konnte. Leise saß ich auf Schneeball auf, bereit zur Flucht. Traurig und ängstlich, weil ich die Freunde an unserem Platz nicht antraf und weil ihn offenbar stattdessen ein Bär für den Fischfang erobert hatte. Er jagte nicht auf Johns stille Art, auf Reiherart, sondern auf Bärenart. Wasser aufstiebend. Wo waren sie? John und Gallegina? Lagen unsere Zeit und der Platz endgültig in der Vergangenheit? Hatten neue Bewohner unsere Jagdgründe in Besitz genommen? Richmond wurde immer realer, meine Zukunft immer unausweichlicher. Lautlos schluckte ich meine Resignation und wendete das Pony. Ein mir bekanntes Schreien und Lachen stoppte meine leise Flucht. Ein Blick zu Galleginas Felsen, und ich entdeckte Johns Kopf, der nass aus dem Fluss hinter dem Granitbrocken hochfuhr. Zeitgleich sah er mich, mir direkt in die Augen, überrascht und breit grinsend. Nicht lange, denn da zog ihn bereits etwas zurück ins Wasser. An einen Bären glaubte ich nicht mehr. Nicht einmal John hätte mit bloßen Händen, und vor allem lachend, gegen einen Bären gekämpft. Ich schwang von Schneeballs Rücken und schritt zum Ufer. Gemächlich, sehr langsam. Weil ich mich auf das, was ich zu erblicken erwartete, freute. Ich stieg in den Fluss, durch ihn hindurch, bis zum Felsen in der Mitte. Setzte mich auf ihn, tauchte meine Füße ins Wasser und sah dem Treiben der Freunde zu. Für Augenblicke kehrte die Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Mit den derart kindisch ringenden Freunden tauchten die Erinnerungen aus dem seichten Wasser des Oostanaulas auf. An das, was bald enden würde. War die Zukunft erst mit Vaters Plan ausgesprochen geworden, so hatte sie sich schon länger angekündigt. Nur hatte ich die Vorboten nie erkannt, nie sehen wollen. Auch wenn wir uns, wie gerade John und Gallegina, gelegentlich noch wie Kinder verhielten, unbedarft, waghalsig und im Vertrauen, unsterblich zu sein, waren wir schon lange keine mehr.
Es hatte zwei Sommer zuvor begonnen, jedenfalls für John und mich. Für Gallegina war es da schon lange nicht mehr neu. Seit ich ihn kannte, schwärmte er von der Schönheit irgendwelcher Mädchen. Mädchen, die John und mich vor allem nervten. Mal waren es die schönen Augen von Salali, bald die geschmeidigen Bewegungen von Ayita, später die mitreißende und so entzückende Tatkraft von Tayanita, um tags drauf zu den rabenschwarzen Augen von Salali zurückzukehren, die Gallegina begeisterten. Vollkommen unverständlich. Die schönen Augen und geschmeidigen Bewegungen gab es für John und mich nicht, sie gehörten zu den seltsamen Spinnereien des Freundes. Bis eines Morgens Adsila das Objekt von Galleginas Schwärmereien war und er uns damit ansteckte. Plötzlich, den genauen Moment weiß ich nicht mehr, und ganz unabhängig davon, wie gleichgültig ich Adsila war, wurde sie zum begehrenswertesten Geschöpf der Welt. Für Tage. Erst ein Kribbeln im Bauch, dann war es um mich geschehen. Genauso wie um Gallegina und John. Möglicherweise war es der Freundschaft oder der jugendlichen Rivalität geschuldet – wir buhlten alle drei um Adsilas Aufmerksamkeit, und keiner von uns erhielt sie. Sie war die erste einer längeren Reihe von Umschwärmten, die unsere Herzen beherrschten und für die wir uns jederzeit zum Trottel machten. Wir waren junge Männer geworden, was uns überforderte. Wir hätten sicher Tsali um Rat bitten können, es hieß, er lebe mit drei Frauen zusammen. Außerdem war er nie um Antworten verlegen. Aber war das ein Leumund für uns bezüglich Verständnis und Hilfe? Er war ein alter Zyniker, gleichzeitig abgeklärt und aufbrausend. Sein Humor hätte uns vielleicht helfen können, seine Erfahrung sicherlich, doch seine Stimmung wirkte seit der Schlacht am Tohopeka zu bedrückend, um uns als hilfreich zu erscheinen. Weil wir unsere Eltern ebenso wenig befragen mochten und konnten – die Vorstellung, Vater darauf anzusprechen, war noch absurder, als Tsali meine intimsten Gedanken zu offenbaren –, blieb für John und mich einzig Gallegina als Ratgeber übrig. Ein Ratgeber, der selbst ratlos war. Aber zumindest erfahrener mit dem verwirrenden Gefühl. Die Liebe blieb für uns eine schmerzhafte Reihe unerwiderter oder unversuchter Absichten.
Zur gleichen Zeit wurden unsere Stimmen erst krächziger, dann tiefer. Die Adsilas und Tayanitas in unserem Umfeld lachten. Über uns. So fühlte es sich zumindest an. Die Schultern wurden breiter, und die Kraft nahm zu. Gegen die Schüchternheit oder Kopflosigkeit half es nicht. Es verwirrte umso mehr. Denn mit den Körpern veränderten sich unsere Träume und Wünsche. Neue, befremdliche Gelüste traten in unser Leben und blieben zunächst unerfüllt.
Und irgendwann geschah es, dass wir begannen, an eine Zukunft zu denken. Uns sie auszumalen. Jeder die eigene, alle zusammen eine. Auch in der Hinsicht war Gallegina uns voraus. Je näher das Ende unserer Tage in Springplace rückte, desto entfernter lag die sonst alles bestimmende Gegenwart. Das Morgen obsiegte über das Heute. Den Freunden standen Möglichkeiten offen, die ihren Ahnen verwehrt gewesen waren, ja, von denen die nie eine Vorstellung gehabt hatten. Waren ihre Vorfahren noch zwangsläufig Jäger, Krieger, Häuptlinge oder heilende Didanawisgi geworden, boten sich John und Gallegina ganz neue Chancen. Zukunftschancen. Bislang noch fern. Plötzlich stand der Augenblick der Entscheidung nahe. Zu nah für mich.
Der Stein war durch die Sonne angenehm erwärmt, ein wohliges Gefühl durchfuhr mich. Fontänen schossen über mich mit kühlen Tropfen. Von John, der Galleginas Kopf unters Wasser drückte, und von Gallegina, der sich dagegen wehrte. Kalte Schauer aus Wehmut hinterließen sie auf meiner Haut. Würde es zum letzten Mal so sein? Was hielt die Zukunft für mich parat? Vielleicht dürfte ich in den Dörfern der Cherokee eine Farm besitzen und bewirtschaften. Ackerbau wäre etwas für mich, überlegte ich, als John erneut Galleginas Kopf unter die Wasseroberfläche drückte. Feldarbeit hatte ich von Nanye-hi gelernt. Bei Sequoyah. Das lag mir. Schaufeln, sähen, zupfen, warten und ernten, das entsprach meinen Fähigkeiten. Farmer, entschied ich, wäre eine gute Wahl, wenn ich eine Wahl hätte. Der Kampf im Fluss nahm offenbar eine Wendung, ein Ende zeichnete sich ab. Galleginas Hand schoss nach oben, die Geste des Ergebens. John ließ von ihm ab, sprang jedoch einen weiten Satz zurück. Sicher war sicher. Für einen Jäger, Krieger oder Häuptling bot er die besten Voraussetzungen. Für Vorsicht gab es diesmal keinen Grund. Gallegina stand es nicht nach Rache. Prustend stob sein Kopf aus dem Oostanaula, er spukte aus und rang nach Atem. Da kletterte John bereits zu mir auf den Felsen.
»Verstehe ich das richtig, du willst also nicht Jäger und Krieger für mich sein?«, fragte Gallegina schnaufend und hielt ihm die Hand hin, damit er ihn auf den Felsen zog.
»Such dir einen anderen Sklaven, wenn du ihn dir leisten kannst.« Verächtlich schlug John die Hand weg.
»Was ist los? Nicht Sklave, freier Jäger«, hakte Gallegina nach. »Du wolltest doch unbedingt Jäger sein. Wenn ich erst der Oberste Häuptling der Cherokee bin, dann darf jeder das sein, was er will. Farmer, Fährmann, Müller oder eben auch Jäger. Wo ist dein Problem?«
»Dass sogar, wenn ich wüsste, was ich wollte, ich es nicht entscheiden dürfte.« Mit dem Fuß schoss John einen Schwall Wasser über den Fluss. »Von wegen Freiheit. Mein Vater schickt mich nach Connecticut, damit ich da weiter zur Schule gehe. Um seinem Plan zu folgen. Soweit zur Freiheit!«
»Also doch. Du gehst nach Cornwall, Connecticut, richtig?« Gallegina stand neidvolles Verstehen ins Gesicht geschrieben. Egal, wovon John sprach, Gallegina wusste, worum es ging. Im Gegensatz zu mir. Cornwall, Connecticut? Was hatte das zu bedeuten? Lag Johns Zukunft doch nicht im Cherokeeland? Aber warum nicht?
»Auf eine blöde Akademie für blöde Indianer, die irgendein blöder Idiot von den blöden Schlaumeiern, die aus Chickamauga ein Springplace machen wollen, in Connecticut gegründet hat. Einer dieser blöden Missionare ist gerade hier und hat Vater den blöden Floh ins Ohr gesetzt. Das kommt alles von Ross, dem blöden … ach egal«, schnaubte John abfällig. »John Ross geht mir ohnehin auf die Nerven. Der sitzt warm und trocken im blöden Ross-Landing, leitet das blöde National-Komitee und mischt sich jetzt auch noch in mein Leben ein. Alle finden ihn ja ach so toll. Ich finde ihn …!«
»… blöd?«, riet ich ironisch schmunzelnd, woraufhin John mich mit einem seichten Hieb vom Felsen in den Fluss schubste. Niemand lachte, weder Gallegina noch John. Gallegina schob sich stumm neben seinen Cousin auf den Stein und begann, sich mit schmollender Miene das Wasser aus der Kleidung zu drücken.
»Connecticut? Wieso? Was sollst du da?«, hakte ich nach, als ich aus dem Wasser zurück auf den Felsen kletterte.
»Lernen zu sein, wie die sind. Wie du es bist«, blaffte John und deutete mit dem Daumen auf mich. Ich warf ihm einen beleidigten Blick zu und schwieg.
»Das ist doch toll«, erwiderte Gallegina sichtlich betrübt.
»Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei!« John sprang wütend ins Wasser, um seinen Speer zu holen, der ein paar Schritte entfernt am Ufer trieb. »Lernen ist deine Wunschvorstellung vom wahren Leben, nicht meine.«
»Du weißt genau, dass das nicht möglich ist«, rief Gallegina ihm mit Verzweiflung in der Stimme hinterher.
»Klar, du kommst schließlich mit!« Auf halber Strecke drehte sich John um und grinste breit, als er Galleginas verdutzte Miene erblickte.
»Kaum. Dein Vater ist Major Ridge und reich. Meine Familie hingegen … Du weißt, dass wir uns das nicht leisten können, meinen Bruder oder mich nach Cornwall zu schicken, um dort … Wie lange wird das dauern?«
»Mehrere Winter«, stöhnte John deprimiert und ging weiter in Richtung des Speers, der abseits der Bucht bedrohlich schräg in der Strömung am Ufer auf der anderen Seite des Flusses lag. Kurz davor, mitgerissen zu werden.
»Sag ich ja, keine Chance«, schnarrte Gallegina missmutig nun zu mir, da John ihn nicht hören konnte, weil der gerade versuchte, in der brausenden Strömung das Gleichgewicht zu halten. Kurz sah Gallegina schweigend zu ihm, wie er sich abmühte, um sich auf den Beinen zu halten. »Und der … blöde Major-Ridge-Sohn darf nach Connecticut.«
»Hm.« Mehr Aufmunterungen fielen mir nicht ein. Mir fehlten die aufbauenden und tröstenden Worte. Mein Schicksal sah nicht besser aus. Das alles wurde mir langsam zu … blöd. Ich selbst hätte Aufmunterung benötigt. Eine Perspektive, die nicht … Da verlor John, als er nach dem Speer griff, endgültig den Halt, fiel ins Wasser und wurde von der Strömung des Oostanaulas ein wenig davongetragen. »Sollten wir ihm nicht helfen?«
»Ach, was! Das härtet ab, das braucht er. Als großartiger Krieger.« Gallegina und ich lachten. John japste in einiger Entfernung, hielt sich an einem der Felsen fest, zog sich an ihm wieder auf die Beine und spie einen langen Wasserstrahl aus. Ungewohnt schwerfällig stakste er durch die Strömung zu uns zurück. Hinter ihm trieb der Speer davon. »Und was ist mit dir? Gehst du auch nach Connecticut?«
»Nichts ist mit mir«, behauptete ich, während John wieder zu uns auf den Felsen kletterte. »Meine Chancen stehen schlechter als eure. Entweder ich nutze meine tollen Kontakte zu euch, um Geschäfte zu machen, und werde so wie mein Vater. Reich könnte ich werden, sagt er …«
»Das ist nicht dein Ernst?« Ein ungewisser Zweifel starrte mich aus Galleginas Augen an.
»Oder ich muss nach Richmond zu einem Freund von ihm gehen, der mir einen Meister suchen soll, damit ich ein ordentliches Handwerk fern von hier erlerne.«
»Soll das heißen«, hakte Gallegina nachdenklich nach, »es geht entweder gegen uns oder gegen dich?«
»So schlimm ist er nicht«, erwiderte ich matt. »Wilhelm Wirt ist ein netter Mann, soweit ich weiß. Es wird nicht allzu arg werden. Hoff ich …«
»Und ich bleib allein hier, oder was?«, jammerte Gallegina und warf schwermütige Blicke über den Fluss.
»Wenn du nicht aufhörst, zu jammern, werde ich sicher dafür sorgen!« John knuffte spöttisch gegen Galleginas Oberarm. Er genoss die Situation offensichtlich. »Begreifst du es immer noch nicht, oder was? Du bist doch sonst Häuptling Ich-weiß-alles. Die brauchen uns. Uns! Verstehst du? Einer kann ja immer mal draufgehen, nicht wahr?«, lachte John. »Und weil du so ein Streber bist, alles immer toll gelernt hast, hat die Stammesführung beschlossen, Geld für deine Ausbildung zu sammeln, damit du …«
»Ich? Ehrlich?« Gallegina sah John zweifelnd an, als der ihn mit einem Nicken vom Felsen ins Wasser stieß.
»Auch wenn du es, meiner Meinung nach, nicht verdient hast! Aber wer hört schon auf mich!«
Sie würden ohne mich gehen. Weit weg. Egal, ob ich hierbliebe oder nach Richmond ginge, ich wäre allein. Die gemeinsame Zeit war vorbei und würde nach Jahren der Trennung vermutlich nicht wiederkommen. Die Erkenntnis durchbohrte mein Herz wie ein Pfeil. Traurig sah ich zu den Wipfeln der Bäume, die im Wind seicht hin und her wehten. Über ihnen zog eine dunkle Wolke gen Himmel. Glückselig tauchte Gallegina aus dem Wasser wieder auf.
»Was ist das?« Ich zeigte zu der Wolke, die sich aus einer kleinen Rauchsäule darunter bildete. »Es brennt!«