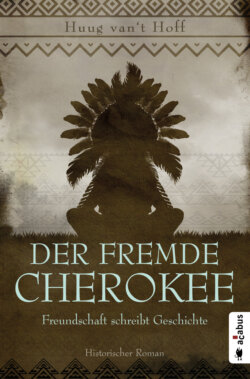Читать книгу Der fremde Cherokee. Freundschaft schreibt Geschichte - Huug van’t Hoff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dämmerige Lichtung
ОглавлениеAls sich unsere Wege trennten, dämmerte es bereits. Gallegina schlief und sein Bruder hielt ihn auf dem Rücken des Ponys. Keine Reaktion in meine Richtung. Kein Abschied, nichts. John nickte mir zu, sagte kein Wort. Jetzt war ich der Einzige, der sprach, obwohl ich bis dahin zumeist geschwiegen hatte. Doch plötzlich war mir nach Reden, wollte ich mich nicht von ihnen trennen, wollte nicht nach Hause, wollte nicht, dass der Tag endete, wollte ihre Bestätigung, dass andere wie dieser folgen würden, dass wir auch morgen wieder Freunde, Verbündete seien. John nickte bloß und ritt neben Degataga und Gallegina davon. Das war alles. Tränen drückten mir in die Augen, wegen der Ungewissheit der kommenden und der Gewissheit der nahen Zeit. Mein Vater wartete zu Hause, Steiner hatte ihn vermutlich von meinem Betragen in der Schule unterrichtet. Sollte ich ihm alles gestehen und die Folgen hinnehmen? Es zu verheimlichen, führte zwangsläufig zu härteren Vergeltungsschlägen von ihm. Einzig mit Verzögerung. Ich hatte die Wahl zwischen schmerzhaften und höllischen Strafen. Schneeball trug mich unaufhaltsam den Waldpfad entlang. Ein Hirsch brach durch das Unterholz, sah mich und lief davon, eine Eule, die ihre nächtliche Jagd mit Rufen ankündigte, lugte aus einer Fichte, ein Flughörnchen glitt vorbei. Die Zeit blieb nicht stehen, und der Weg wurde nicht länger, sondern immer kürzer. Bevor ich die Lichtung erreichte, glitt ich vom Rücken des Ponys, um zumindest leiser mein Ziel zu erreichen. Und dort erwartete mich der nächste Schrecken. Nicht nur Vaters Pferd äste vor dem Haus. Unter der Platane stand eine Kutsche, ein schicker Einspänner, den ich nie zuvor gesehen hatte. Soweit ich mich erinnerte. Aber mir wollte auch nicht einfallen, ob Abraham Steiner gewöhnlich mit einem Pferd oder einer Kutsche unterwegs war. Obwohl er meinen Vater gelegentlich aufgesucht hatte, entsann ich mich nicht mehr, womit er zu uns kam. Aber wer, außer ihm, sollte an diesem Abend zu meinem Vater fahren? Einzeln waren sie schon gefährlich genug, aber gleichzeitig wollte ich den beiden nach den Vorfällen meines ersten Schultages gewiss nicht begegnen.
Ich blickte zur Krone des Baumes, wünschte mir den Nachmittag mit der Kermesbeerenschlacht zurück und schlich mit Schneeball am Haus vorbei zum Bach in der Senke. Dorthin, wo ich Monate zuvor einen Damm angelegt hatte. Mit Steinen, Lehm, Gras und einigen Ästen hatte ich es geschafft, das flache Wasser auf vier Fuß aufzustauen. Anfänglich hielt das matschige Fundament der Strömung nicht stand. Immer neue Steine legte ich in das Bachbett und versuchte, die Lücken, durch die das Wasser drang, mit Ästen und Lehm abzudichten. Mehrmals schreckte ich dabei eine der grün-braunen Schlammechsen auf, die unter den Steinen im Bach lebten. Eine Elle lang, mit seitlichen Fransen am Mini-Drachen-Leib, getragen von kurzen Beinen. Wer von uns erschrockener reagierte, sie oder ich, sei dahingestellt. Ob man sie wirklich als Schlammechsen bezeichnet, weiß ich nicht. Ich nenne sie so. Sie sind überall. In jedem Flussbett. Nach den ersten fortgetragenen Dammbauten kam ich auf die Idee, mit Zweigen einen Doppelzaun im Bach zu errichten, in dessen Mitte ich weitere Äste und Steine platzierte, um alles mit Lehm und Grassoden vom Ufer eng und fest zu bedecken. Endlich begann sich das Wasser zu stauen. Stolz stand ich im trockenen Bachbett hinter meiner Lehmmauer. Am folgenden Morgen, als ich zum Damm ging, war er gebrochen. Ich hatte die Schlammechsen im Verdacht, ihn zerstört zu haben, und begann von neuem. Auch der nächste Versuch brach über Nacht. Daraufhin übernachtete ich in der Nähe meines Dammes in einem Baum, um die Echsen auf frischer Tat zu erwischen und zu verscheuchen. Oberhalb des Damms hielt ich in einer Astgabel Wache. Mitten in der Nacht weckte mich ein Knacken, fast wäre ich aus dem Baum gefallen. Nichts war zu sehen. Es war Nacht, der Bach lag dunkel unter mir. Sogar wenn die Schlammechsen dort gewesen wären, hätte ich sie im Wasser und auf dem Damm niemals erkennen können. Ich … Ja, ich weiß: Warum erzähle ich so lange von dem Damm? Hatte er eine Bedeutung für den Verlauf des Endes meines ersten Schultages? Nein, er dient nur dazu, um zu zeigen, wie groß meine Angst vor dem Zusammentreffen im Haus meines Vaters war. Wie sehr ich mich bemühte, diesem aus dem Weg zu gehen. Wie viel Zeit ich mit Nebensächlichkeiten verbrachte, um der Begegnung zu entgehen. Wie sehr ich die Rückkehr zum Haus hinauszögerte. Der Damm stand an dem Abend unversehrt im Bach. Viel Aufschub brachte er mir nicht. Um es kurz zu machen: Der Damm brach einst wegen meiner Dummheit. Keine Echse war daran schuld. Das Wasser selbst war es gewesen. Es brauchte nur zwei Abläufe für die Stauung, und er brach nie wieder. Die Lösung war so banal wie die Angst, die mich an dem Abend zu meinem Damm trieb. Es war nichts an ihm zu reparieren, er war vollkommen intakt. Und sogar wenn er es nicht gewesen wäre, war die Dämmerung zu weit fortgeschritten, um daran zu bauen. Es gab keinen Ausweg, ich musste mich meinem Vater stellen. Im schlimmsten Fall mitsamt seinem Besuch, mitsamt Abraham Steiner. Kaum näherte ich mich dem Haus, hörte ich schon Vaters Stimme. Suchte er mich? Da war noch eine zweite zu hören. Steiner? Es gab kein Zurück mehr. Vorsichtig pirschte ich mich näher an das Haus heran, um vorher zumindest zu erfahren, wer auf mich wartete und wie bedrohlich die Lage war.
Was ich dann erblickte, wirkte verwirrend harmlos. Dort unter der alten Platane vor unserem Haus stand zwar mein Vater, doch nicht mit Abraham Steiner. Neben ihm ragte ein großer, elegant gekleideter Herr auf. Er sah überraschend sympathisch aus. Wie ein heiterer Eindringling in unserer düsteren Lichtung. Seine krausen, blonden Haare kringelten sich über lächelnden Augen. Ein Fremder. Ich tippte auf einen Regierungsbeamten, einen wie Colonel Meigs, den Cherokee-Agenten. Der Einspänner vorm Haus, dem deutlich die Spuren des Trampelpfades anhafteten, war für das Leben in Städten gebaut. Es sprach dafür, dass der Mann von weit her angereist war, ohne zu bedenken, wie die Wege in dieser Gegend beschaffen waren. Aus einer größeren Stadt. Wer könnte das sein? Nur jemand, der Vater wegen seines Auftrags befragen und kontrollieren wollte. Also definitiv ein Regierungsbeamter. Einzig der vertraute Tonfall der beiden störte den Eindruck. Derart sprach mein Vater nicht einmal mit Steiner und Byhan. Und im Gegensatz zu denen trug dieser Mann ein Lächeln im Gesicht. Einnehmend und nett. Gesichtern ist nicht zu trauen. Klar, das wusste ich, und ich hatte gute Gründe, Vater nicht in die Arme zu laufen. Wobei der Moment, jetzt, im Beisein des Regierungsbeamten, vielleicht nicht der schlechteste war. Für mich und für mein Dilemma. Vater müsste seinen Zorn zügeln in Anwesenheit des Besuchs, von dem er so abhängig war. Womöglich war das meine Chance. Während ich noch am Lichtungsrand im Gebüsch hockte und über Vor- und Nachteile grübelte, traf mein Pony für mich die Entscheidung. Schneeball rannte wiehernd auf den Fremden zu.
»Oh«, staunte der. »Was für ein hübsches Pferd. Sehr klein. Ein Pony? Wem gehört es?«
»Meinem Sohn«, antwortete mein Vater, sah sich suchend um und rief: »Mattheus? Mattheus, komm und begrüße unseren Gast!«
Die Auswahl an Möglichkeiten war auf eine einzige geschrumpft. Kleinlaut kroch ich aus meinem Versteck. Der Fremde grinste, als er mich erblickte. Meine Hände waren lehmverschmiert, die Arme gebüschzerkratzt, und unter meinem rechten Auge wölbte sich blau ein Veilchen, das ich mir beim Chungke geholt hatte. Immerhin hatte ich dafür einen Punkt gegen John errungen.
»Matt«, seufzte mein Vater und wies in meine Richtung.
»Ich seh’s. Die Akkulturation schreitet voran«, erwiderte der Mann belustigt, schritt mir entgegen und zupfte mir ein paar Blätter aus dem Haar. »Nicht ganz das, was Washington sich vorgestellt hat, irgendwie die falsche Richtung, aber … es scheint eine Menge Spaß zu machen.«
»Mhm«, antwortete ich halb entschuldigend, halb erleichtert über die gelassene Reaktion des Mannes. Sehr sympathisch für einen Regierungsbeamten.
»Du bist Matt?«, staunte er. »Du erinnerst dich vermutlich nicht an mich. Das letzte Mal sahen wir uns in Cedar Shoals. Du warst drei oder vier. Und jetzt …« Er maß staunend mit der Hand meine Kopfhöhe und verdrehte die Augen. »Jetzt kling ich wie ein alter Mann. Entschuldige, ich bin Wilhelm.« Er reichte mir die Hand, die kurz zuvor noch die Höhe meines Kopfes gemessen hatte.
»Wilhelm Wirt«, ergänzte mein Vater. »Ein alter Schulfreund aus Bladensburg.« In Bladensburg in Maryland war Vater geboren worden. Nach dem Unabhängigkeitskrieg war mein Großvater dort kurz stellvertretender Bürgermeister gewesen.
Ich weiß nicht, was mich mehr überraschte, dass Vater Freunde hatte oder dass die sogar nett sein konnten. Vorsichtig griff ich nach der Hand, drückte sie schweigend und ließ sie gleich wieder los.
»Puh, was für ein Händedruck, ganz der Vater«, staunte der Mann, den Vater Wilhelm Wirt nannte, und knetete übertrieben seine Hand, als schmerzte sie. Wenn es auch nur vorgetäuscht war, so gefiel es mir trotzdem. Er zeigte auf Schneeball. »Das da ist dein … Schimmel? Ein Schimmel mit Flecken. Und klein.«
»Er heißt Schneeball«, erklärte ich, und Wilhelm Wirt lachte wieder. Er lachte gern, wie man sah. Breite Sicheln zogen sich um den Mund. Tief und wunderschön. Von Moment zu Moment gefiel er mir besser. Wie konnte so ein Mensch mit meinem Vater befreundet sein?
»Du kommst spät heim«, stellte der fest. »Es ist dunkel.«
»Ich …«, stotterte ich, ohne zu wissen, was ich antworten sollte. Was hatte Vater von Steiner erfahren? Was konnte ich verschweigen, ohne dass er es je erfahren würde? Was konnte ich vom Tag erzählen?
»Ja? Wo warst du? So lange kann das heute unmöglich gedauert haben!« Die Worte meines Vaters klangen ehrlich unwissend. Ohne erkennbaren Hintergedanken in der Stimme. Das war eine Alternative, die ich für unmöglich gehalten hätte. Er wusste von nichts. Abraham Steiner hatte geschwiegen, und, was ich zu dem Zeitpunkt niemals geglaubt hätte: Er würde es auch in Zukunft tun. Weder meinem Vater noch dem Kollegen Gottlieb Byhan verriet er die Ereignisse meines ersten Tages in Springplace. Weder von Galleginas Widerworten noch von dem Fichtenzapfen, den ich ihm in den Nacken warf, noch von dem Pfeil, den John ihm in den Hintern geschossen hatte, sprach er ein Wort. Wahrscheinlich war es ihm zu unangenehm, um es zuzugeben.
»Ich war mit zwei Freunden … unterwegs, die ganze Zeit.« Halbe Wahrheiten sind oftmals die besseren Nachrichten als die ganze Geschichte. Neugier breitete sich in Vaters Gesicht aus.
»Cherokee?«
»In Springplace sind nur Cherokee. Außer mir.«
»Na dann, sehr gut.« Da wir beide mit der Antwort zufrieden waren, beschloss ich, ansonsten den Mund zu halten. Was mir gelungen wäre, mit Steiners Schweigen. Gelungen wäre, ohne den fremden Freund. Wilhelm Wirt musterte mich eindringlich. Ob das zittrige Kneten meiner Hände, das nervöse Zucken meiner Augenlider oder die kleinen Schweißperlen unter meiner Nase mich verrieten, weiß ich nicht. Zugegeben, es gab Anzeichen. Und Wilhelm Wirt erkannte sie. Er war geübt, einen ungeübten Schwindler sofort zu durchschauen. Als Anwalt in Virginia und als Angestellter im Abgeordnetenhaus erkannte er Ausreden und Flunkereien, Lügner und Simulanten mit einem Blick. Er grinste mich verschwörerisch an, und ich verstand, dass er verstand. Meine verräterischen Anzeichen spielten verrückt: Händekneten, Schweiß und Liderzucken. Die Angst vor der Offenbarung durch den Freund meines Vaters. Doch beließ er es unkommentiert. Im Beisein meines Vaters verriet er mich nicht. Als der für einen Moment zurück ins Haus ging, zog Wilhelm Wirt mich neugierig zur Seite, um mich in ein mildes Kreuzverhör zu nehmen.
»Es bleibt unser Geheimnis. Ich schwöre es«, versprach er, und mir fiel es leicht, alles zu gestehen. Insgeheim gierte ich danach, von den Erlebnissen des Tages zu berichten. Von all dem, von dem ich selbst nicht glauben mochte, dass es real war, dass es möglicherweise meine Zukunft sein könnte. Obwohl er als Freund meines Vaters normalerweise eine Gefahr hätte sein müssen, die Gefahr, verraten zu werden, traute ich ihm. Es gab keinen Grund für dieses Vertrauen, außer, dass er mir sympathisch war. Das reichte aus. Er öffnete auf einnehmende Weise die Herzen der Menschen, was ihn, wie ich später erleben durfte, zu einem großartigen Anwalt machte. An dem Tag, an meinem ersten Tag, war er ein fairer Richter.
»Mit einem Blasrohr, autsch!« Er lachte herzhaft. »Das hätte so mancher meiner Lehrer ebenfalls verdient. Nur war ich dafür zu feige! Leider!« Abermals lachte er, dermaßen dröhnend, dass Vater uns im Haus hörte und herausgelaufen kam.
»Dein Sohn! Was für ein Spaßvogel!«, prustete Wilhelm Wirt geistesgegenwärtig. Offensichtlich war er genauso geübt darin, Schwindler zu erkennen wie selbst die Wahrheit zu verdrehen. Kaum hatte er die Behauptung aufgestellt, erzählte er schon einen Witz. Nicht irgendeinen, nein, einen wirklich lustigen. Keine Ahnung, worum es darin ging, was die Pointe war, ich weiß nur noch, dass Vater lachte. Befreit. Es war erst das dritte Mal, dass ich ihn dermaßen gelöst erlebte. Zuvor bloß bei James Vanns Tod und einmal, ich weiß nicht mehr, wann das gewesen war, als er Post aus der Hauptstadt erhielt. Mit guten Nachrichten. Er nahm mich in den Arm, fast väterlich, drückte mich, dass ich es mit der Angst bekam, und schenkte mir sogar sein Messer. Eines mit genieteten Geweihgriffschalen und einer schartigen Klinge. Immerzu piekste ich mir die leicht gebogene Entenschnabelspitze in den Finger, bis winzige Bluttropfen aus der Haut troffen. Nie hatte ich einen vertraulicheren Moment mit ihm erlebt, weder zuvor noch danach. »Das ist so eines, wie es Jim Bowie benutzt hat, ein Messer für Gewinner«, erklärte er ehrfürchtig und ritzte eine Fratze in den Stamm der Platane neben dem Haus. Es war der größte Schatz der Welt. Für einen Tag, an dem seine Stimmung vergleichbar ausgelassen war wie an dem, als Wirt zu Besuch kam. Das Messer holte er sich zurück. Auf die gewohnte Weise. Doch am Tag der Begegnung mit Wilhelm Wirt gab es nichts, was er später zurückfordern konnte. Nicht jede Lüge oder Halbwahrheit wird bestraft.