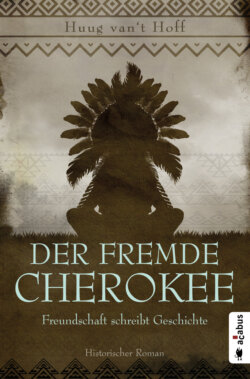Читать книгу Der fremde Cherokee. Freundschaft schreibt Geschichte - Huug van’t Hoff - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kein Weg zurück
ОглавлениеIm Inneren der Schulhütte erwartete mich die gebückte Statur von Abraham Steiner. Bedrohlich wog er in seinen knochigen Händen ein in Holz und Leder gebundenes Buch, schwarz mit goldenem Kreuz darauf.
Einzig der Name meines Vaters hatte mich wohl vor der Strafe Steiners gerettet. Denn seine Miene sagte etwas anderes als seine Worte: »Ah, der junge Mattheus Hildebrand. Schön … Na, endlich. Dann setz dich mal! Dahin!«
Vom ausgestreckten dürren Zeigefinger wurde ich vorn in der ersten Reihe platziert, was die Rangordnung unterstrich. Ich war ein Neuer. Mit mir saßen noch acht weitere Schüler in dem beengten Raum. Die jüngeren, vorderen folgten Steiners Worten konzentrierter, die älteren, hinteren waren nicht so eifrig. An der Wand hinter ihm hing ein helles Brett, auf dem mit Kohle etwas geschrieben stand. Steiner schluckte den Unmut, den ich auf seinem Gesicht, anders als die Symbole auf dem Brett, zu lesen vermochte, mit murmelnden Worten und Flüchen hinunter. Auf Deutsch. In Zukunft hörte ich die Sprache meiner Ahnen häufiger. Ebenso wie Abraham Steiner benutzte Gottlieb Byhan das Deutsche, sobald kein anderer sie verstehen sollte. Wenn sie über uns Schüler redeten, wenn sie sich mit meinem Vater unterhielten und wenn sie einfach ihre Überlegenheit zeigen wollten. Anders als das Cherokee durfte die deutsche Sprache gesprochen werden. Von den Lehrern. In der Schule. Dass ich die beiden verstand, ahnten sie wohl nicht.
An meinem ersten Unterrichtsmorgen krallten sich die Finger Steiners fester und fester um das Buch, während er stumm einen Schritt auf uns zuging. Seine Nägel knirschten wie trockene Äste über den Einband. Er war nicht groß, aber sein zorniges Wesen machte die geringe Größe des Lehrers wett. Keiner wagte, etwas zu sagen.
»Also, noch einmal von vorn: Ich wünsche einen gesegneten Morgen«, zischte er verkrampft weihevoll, um die Situation sofort wieder zu entweihen und seinem Frust freien Lauf zu lassen. »Gott schuf Himmel und Erde«, brüllte er in den Raum. Ein etwas gedrungen aussehender Junge mit schwarzen Haaren neben mir in der ersten Reihe nickte zustimmend, als wüsste er genau, wovon Steiner redete. »Und den Menschen nach seinem Ebenbild. Sogar euch. Irgendwie. Wer diesen gelobten Weg geht, der geht mit Gott.« Der Tonfall klang wenig verheißungsvoll, eher wie eine Drohung. Zum Beweis der Worte schwang er das dicke Buch in seinen Händen durch die Luft und deutete mit der anderen Hand auf den Einband. Der eifrige Junge neben mir nickte weiter. »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden …« Der Junge lächelte und nickte. Göttlich-werdende Worte schienen ihn zu begeistern. Steiner verstimmte die Begeisterung zunehmend. Sein Daumen trommelte einen langsamen, leisen und unruhigen Marsch auf dem dunklen Buchdeckel. »Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.« Begeistertes Nicken neben mir für etwas, was für mich ebenso schräg wie paradox klang. Was sollte das bedeuten: Wurde nichts, was geworden ist? War es nun geworden oder nicht? Außerdem was überhaupt? Dass dieser Widerspruch auf Zuspruch und Verständnis eines Schülers stieß, war Abraham Steiner offensichtlich auch nicht geheuer. Abfällig musterte er den Jungen.
»Ah, der junge Oowatie weiß mal wieder besser Bescheid als alle anderen. Will er mit dem widerlichen Genicke etwa sagen, er kenne die Heilige Schrift sogar genauer als ich?«, knurrte Steiner. Seine Augen blitzten hämisch auf. Womit das Nicken ein Ende hatte. Der Blick des Jungen fiel zu Boden, es folgte beschämtes Kopfschütteln. Der Lehrer war augenscheinlich froh, ein Opfer gefunden zu haben. Genüssliche Aggressivität lag in Steiners Stimme. »Und wie endet es?«, fauchte er.
»Und … und … und das Wort ist zu Fleisch geworden und … und hat unter uns gewohnt, und … und …«
»Falsch, junger Buck«, spuckte Steiner mit dem schmähvollen Tiervergleich dem Jungen die Verachtung für seine Abstammung entgegen. Obwohl die Fleisch gewordenen Worte, die unter uns wohnen, für mich gleichfalls total falsch anmuteten, sagte die Reaktion des Jungen etwas anderes aus. Er hob den Kopf und sah den Lehrer irritiert an.
»Aber … aber … gestern hatten Sie es genauso gesagt. Es sei aus dem Johannesevangelium, behaupteten Sie.« Der Junge sprach leise. Trotzdem war er deutlich zu verstehen. Was Steiner gar nicht gefiel. Gelerntes im Wortlaut des Lehrers wiederzugeben, gehörte wohl nicht zur Ausbildung der Schüler. Schweigen hieß die Überlebensregel, das hatte ich in den ersten Augenblicken in Springplace bereits gelernt. Und Widerspruch stand unter Strafe, das lernte ich als nächstes.
»Der kleine Buck-Klugscheißer will mich herausfordern? Wie sieht es aus mit den zehn Geboten? Wo und von wem wurden sie empfangen? Sprich!« Ungebremst donnerte Steiner die Fragen mit hochrotem Kopf und in unheiligem Tonfall durch den Raum. Der Angeschriene zitterte und murmelte Unverständliches. Warum konnte er nicht einfach schweigen, wie wir anderen auch? Sein Blick senkte sich. »Was? Eine Antwort? Na, dann aber lauter! Ich hab nicht recht verstanden.« Ich mochte es kaum glauben, aber der Junge versuchte tatsächlich, erneut eine Antwort zu geben. Was nicht gelang, weil der Lehrer ihn vorher am Ohr auf die Beine zog, um hineinzuschreien. »Also …?« Die Stimme des Lehrers überschlug sich.
»Ich … weiß … es … nicht«, gab der Junge so widerstrebend zurück, als würde er sich lieber die Zunge abbeißen. Eine Lüge aus Angst geboren, die Steiner jedoch keineswegs besänftigte.
»Ach, das weiß der kleine Buck also nicht? Warum nickt er dann? Man soll nicht falsch Zeugnis geben«, zitierte Steiner die Bibel nach Gutdünken, um die falsche Lüge zu ahnden.
»Ich … ich …«
»Also doch eine Antwort? Aha, na gut. Du sollst eine zweite Chance haben«, erklärte der Lehrer und räumte chancenlos die zweite Chance ein. »Und? Wie hießen die ersten Menschen, die der Herr schuf?«
»Das … das hatten wir noch nicht. Und … und … und wir haben keine eigene Bibel. Daher konnte ich es nicht …«
»Stimmt. Endlich hast du es gelernt. Du kannst nichts. Ihr alle könnt nichts. Dann tu nicht so, als wüsstest du etwas.«
Steiner ließ das Ohr des Jungen los, der sackte zurück. Damit sollte der Unterricht für den Schüler noch nicht beendet sein. Der Lehrer blickte aufgebracht von dem Buch in seiner Hand zu dem Jungen, atmete tief durch und … Bevor er mit der Lektion fortfahren konnte, hörte ich eine feste, leise Stimme neben mir.
»Kana’ti und Sehu.«
Als hätte jemand den Teufel beschworen, fuhr Abraham Steiner wutschnaubend herum. Stille trat ein, seine Lider flackerten nervös. Mit einem Blick hatte er den Schuldigen gefunden, er hockte ebenfalls in der ersten Reihe: ein hochgewachsener, sehniger Junge. Gleichzeitig zart und muskulös-geschmeidig. Ein panterhaftes Eichhörnchen. Kühner, als ich es je gewagt hätte, erwiderte er den Blick des Lehrers. Dass Kana’ti und Sehu nach ihrem Glauben die ersten Cherokee auf Erden waren, verstand ich damals noch nicht. Im Gegensatz zu Steiner, was ihm deutlich anzusehen war. Aufsteigender Zorn überbrückte die Zeit, tränkte die Stille mit Hass. Der Lehrer schritt auf den Schüler zu, holte mit der heiligen Schrift aus, die in seinen Knochenklauen vibrierte, und hieb den Jungen mit dem hölzernen Buchrücken zu Boden. Die Botschaft des friedlichen Bekehrens, von der mir in späterer Zeit andere Missionare berichteten, wandte Steiner in Springplace selten an.
»Adam und Eva!«, brüllte er. »Deine heidnischen Dämonen gab es nie! Alles Aberglaube und Blasphemie!« Es war schrecklich. Schlimmer als jeder Albtraum. Es war real, und … trotzdem weiß ich bis heute nicht, warum ich mich einmischte. Wie gesagt: Ich bin normalerweise zurückhaltend, vorsichtig, ja ängstlich. Alle anderen Schüler verhielten sich so, wie ich es von mir erwartet hätte. Nur kam es anders. Als Abraham Steiner den vor ihm Liegenden die fehlende Tugend mit Fußtritten beibrachte, griff ich nach dem Erstbesten, was in der Nähe lag, und warf es ihm in den Nacken. Es war ein Fichtenzapfen, von dem ich bis heute nicht weiß, warum er auf dem Boden des Klassenraums lag. Steiner kreischte auf und verharrte mit aufgerissenen Lidern. Kurz. Dann blickte er sich um. Wie ein Kojote auf der Jagd setzte er sich in Bewegung, streifte durch den Raum, musterte jeden Schüler, suchte nach Anzeichen von Schuld. Ohne Verdacht, dass ich der Werfer gewesen war. Noch nicht. Ich fürchtete, sobald er mir ins Gesicht blickte, würde er alles erkennen. Scham und Schuld. Keine Reue. Allerdings kam er nicht bis zu mir. Mitten im Rachefeldzug durch den Schulraum erstarrte er jäh, und die Bibel fiel ihm aus den Händen. Ihr Rücken brach krachend auf den Holzdielen, die Blätter lösten sich aus der Bindung, und die Gesichtsfarbe des Lehrers wechselte von rot zu weiß. Am Boden hinter ihm sah ich den Schüler, wie er ein dünnes, kaum anderthalb Spannen langes Röhrchen unter dem Hemd verschwinden ließ. Der Lehrer trudelte bis zum Brett mit den Kohlezeichen an der Wand und stützte sich daran ab, während die andere Hand seinen Rücken hinunterfasste. Stöhnend hielt er sich fest und tastete sein Hinterteil ab, bis ein schmerzverzerrtes Kneifen der Augen und eine dünne Träne das Ende der Suche verrieten. Mit einem kurzen Ruck riss er etwas heraus, und seine Beine gaben ein wenig nach. Dann starrte er auf einen winzigen Pfeil zwischen seinen Fingern. Die Wut war zurückgekehrt. Bedrohlich beäugte er uns Schüler, einen nach dem anderen. Niemand rührte sich.
»Wer war das?« Mit tödlicher Miene und anklagendem Schweigen schritt er, nun humpelnd, vor uns auf und ab. Meine Schuldgefühle waren gewichen. Jetzt konnte ich seinem Blick standhalten. Nachdem er mich erreicht und eindringlich beäugt hatte, zog er weiter durch den Raum. Im Angesicht des Rückens erkannte ich, was so ein kleiner Pfeil ausrichtete. Blut rann durch die Leinenhose des Lehrers, und ein dicker, dunkler Fleck breitete sich auf dem Stoff aus. Als sich wieder niemand freiwillig meldete, machte er kehrt und schritt zurück. Wobei ich auch nicht weiß, wer außer mir den Täter beobachtet hatte. Anstatt den alten Schuldigen ebenso als neuen auszuwählen, was logisch gewesen wäre, weil er weiterhin exakt in Schusslinie am Boden lag, hielt Abraham Steiner auf mich zu. Wut und Schmerz gaben der Logik einen anderen Sinn. Für Steiner war ich nicht nur ein möglicher Augenzeuge, sondern ein natürlicher Verbündeter.
»Mattheus Hildebrand«, raunte er durch zusammengekniffene Zähne. »Du hast was gesehen, das weiß ich! Also: Sprich! Ich kenne deinen Vater. Sehr gut!«
Trotz aller Ängste schwieg ich. Oder gerade wegen der Ängste. Gern würde ich prahlen, dass ich kein Denunziant und der Schlaksige am Boden mir sofort sympathisch gewesen wäre, weil sein Handeln meinen Wurf und meine Schuld vergessen ließ. Verbündete des Schicksals, vereint im Schweigen. Nur so war es nicht: Ich traute mich einfach nicht, auch nur einen Laut von mir zu geben! Stumm und starr vor Angst blickte ich auf den Pfeil in Steiners Händen.
»Du weißt, wer es war, nicht wahr? Also: Zeig auf ihn. Und dir wird nichts passieren.« Er presste seine Zeigefinger und Daumen über die beiden Enden des Pfeils. Eine Weile hielt der dünne Schaft dem Druck stand, dann brach er entzwei. Die Teile fielen hinab. Steiner zeigte wahllos in den Raum. »War es der da? Oder der da? Jener? Oder der dort? Oder warst du es selbst?« Während ich nur mit dem Kopf schüttelte, egal, auf wen er zeigte, ob schuldig oder nicht, kochte sein Gemüt über. Die Hautfarbe des Gesichts wechselte erneut ins Rotblau, die Augen quollen hervor, und Speichelbläschen bildeten sich auf den bebenden Lippen. »Du verfluchter Lügner! Du sollst reden, damit dem Recht des Herrn … Ahh!« Bevor seine knochigweißen Hände mich ergreifen und hochreißen konnten, hatte der nächste Pfeil des Schlaksigen sein Ziel getroffen. Diesmal schreckte Abraham Steiner hoch, hüpfte schreiend und fluchend durch die Hütte, willens und fähig, jeden für den Schmerz zu bestrafen. Was er vermutlich getan hätte, wenn wir nicht in dem Moment die Flucht ergriffen hätten. Wir alle preschten aus der Schule auf den Dorfplatz hinaus. Für die Ponys blieb keine Zeit. Wir ließen sie stehen und liefen davon, begleitet vom höhnischen Beifall der Männer auf den Stufen des Hauses nebenan.
»Si-yo Guwisguwi, si-yo Andrew und Joe«, rief der schlaksige Junge der kleinen Gruppe seinen Gruß zu, rannte vorüber und bekam Gelächter zur Antwort. Unbeirrt lief er weiter. Um zu fragen, wer die drei waren, blieb keine Gelegenheit. Steiner humpelte schreiend aus der Schulhütte.
»Hallo, Herr Steiner, seit wann lehren Sie jagen?«, hörte ich die Stimme des Wortführers der Gruppe. War es bei meiner Ankunft noch der gegen mich gerichtete Spott, war es jetzt der Spott gegen den einenden Feind, der unverhoffte Nähe zwischen uns schuf. »Oder wird es ihnen gelehrt?«
Die drei Männer auf den Stufen verfielen in Gelächter. Wie der Lehrer reagierte, sah ich nicht. Ich hörte es nur, während wir entlang der eingezäunten Felder bis zu den nahen Bäumen des Waldes rannten. Diesmal folgten uns die Blicke der schwarzen Arbeiter aufmerksam.
»John Ross, solltest du nicht in den Dörfern am Mississippi sein? Aber wenn ihr schon da seid, sitzt nicht einfach so rum, sondern helft mir gefälligst …« Den Rest verschlangen die dichten Äste des Waldes.
Was hatte sich Skahtlelohskee bloß dabei gedacht? Konnte er sich nicht einmal im Zaume halten? Ich kann es ja schließlich auch, haderte Gallegina. So schwierig ist das nicht. Das würde ihnen Abraham Steiner nie verzeihen, schoss es ihm durch den Kopf, während er hinter seinem Cousin herrannte. Der lachte. Toll. Morgens kriegt er kaum sein Maul auf, und jetzt feiert er die Dämlichkeit seiner Aktion. Dass ihr Lehrer besonders übler Stimmung gewesen war, stand außer Frage. Normalerweise war Gallegina nie das Hauptziel der Angriffe. Schließlich war er einer der wenigen Schüler, die ihm zuhörten und lernten. Wenn es Skahtlelohskee nicht gäbe, er nicht sein Freund und Cousin wäre, sähe die Welt in Springplace für ihn definitiv leichter aus. Mit ihm musste er rennen. Jetzt auch noch mit dem Neuen an der Backe, der sich ebenso idiotisch verhalten hatte. Einstecken, zustimmen und abwarten bringt insgesamt weniger Blessuren, hatte Gallegina die Erfahrung gelehrt. Was sein Cousin nicht lernen wollte. Egal, ob Skahtlelohskee oder John genannt, er war und blieb die leibhaftige Unvernunft. Und Gallegina hegte wenig Hoffnung, dass sich das je ändern würde. Trotzdem folgte er ihm. Wieder und wieder. Keuchend, außer Atem und ungebremst. Über schmale Bäche, durch das Geäst der Fichten, Pinien und Robinien. Sie durchbrachen in wilder Hatz das Gebüsch und umschlängelten im Zickzack die knorrig-glatten Stämme der hohen Platanen. Ob sie weiterhin verfolgt wurden, war mittlerweile gleichgültig geworden. Hauptsache er verlor ihn nicht aus den Augen. Was leicht passierte, weil John eben John war und viel schneller als er. Wenn er lief, das wusste Gallegina, nahm er auf niemanden mehr Rücksicht. John sprang über Hindernisse, als wären es Fichtenzapfen, lief und lief und lief. Erst wenn ihm die Puste ausging, war das Rennen beendet. Oftmals hatte Gallegina frühzeitig aufgegeben, weil John nicht aufhörte zu laufen. Da half kein Flehen, Brüllen oder Kreischen. Diesmal war es anders. Der neue Schüler war ihnen auf den Fersen. Obgleich er morgens noch gewettet hätte, dass sein Cousin ihn hassen würde, weil er ein Eindringling, weil er der Sohn des Landhändlers, weil er anders als sie war, hatte der Tag in der Schule offenbar einen Wandel in John bewirkt. Dass dieser von Vorteil war, bezweifelte Gallegina. Der Neue hatte die ohnehin miese Situation bloß verschlechtert. Vor der nächsten Platane ließ John seine Schritte austrudeln, lehnte sich gegen den breiten Stamm und glitt an ihm hinab. Mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht. Das nicht ihm, sondern dem Idioten hinter ihm galt.
»Danke«, jubelte John, etwas außer Atem und in englischer Sprache, die er äußerst selten und ungern sprach. Eindeutig war der Dank nicht an den Cousin gerichtet. »Das war knapp!«
Hinter sich hörte Gallegina den Neuen keuchen. Als er sich zu ihm umdrehte, rannte der schon an ihm vorbei.
Hatte der schlaksige Junge sich wirklich bei mir bedankt? Oder hatte ich ihn falsch verstanden? Soweit ich erinnerte, hatte sich noch nie jemand bei mir bedankt. Wer auch? Mein Vater sicherlich nicht. Und für Alice gab es keinen Grund, dankbar zu sein. Vielleicht hatte ich mich verhört, und es war nur ein ähnliches Wort in seiner Sprache gewesen. Was dagegen sprach, war der Satz, der folgte. Ebenso in Englisch. Obwohl fremd in der Melodie. Es klang merkwürdig verspielt und gleichzeitig guttural hart, trotzdem war es eindeutig dieselbe Sprache. Kein Zweifel. Vielleicht redete er gar nicht mit mir, sondern mit dem anderen Jungen. Als ich schnaufend am Baum, wo er saß, zum Halten kam und mich erschöpft am Stamm abstützte, war ich mir sicher: Der andere war gemeint. Wofür sollte der Junge sich bei mir bedanken? Ich hatte nichts gemacht. Das, was ich getan hatte, war ohne meinen Willen geschehen, ohne Entscheidung. Im Gegensatz dazu gab es Gründe, ihm zu danken: Er hatte mich schließlich vor Steiner gerettet, nachdem ich mich gedankenlos eingemischt hatte. Sein Pfeil hatte mich gerettet.
»Mein Name ist John«, sprach er weiter, nachdem ich ihn bloß nach Atem ringend angestarrt hatte. Ich war doch der Adressat seines Dankes gewesen. Ich musste lächeln.
»Ja, John Riesenarsch«, meckerte der gedrungene Junge, der kurz nach mir an der Platane ankam, schnaufend. In der Stimme lag die gleiche Grundmelodie, nur um Schönheit und Korrektheit bei der Aussprache bemüht. Das war schon im Unterricht aufgefallen. So zögerlich und ängstlich er dort auf Steiner auch reagiert hatte, er legte Wert darauf, verstanden zu werden.
»He, du undankbare Nuss, ich hab dich gerettet!« Um seiner Empörung Nachdruck zu verleihen, versuchte der am Baumstamm Hockende, dem gedrungenen Jungen die Beine wegzutreten. Was nicht gelang, da der es offenbar nicht anders erwartet hatte. Er hielt sich am Stamm fest und blickte ihn vorwurfsvoll an.
»Gerettet?«, spuckte er die Worte zu Boden. »Wie? Indem du mit deinem blöden Gequatsche die miese Stimmung noch anheizt?« Wütend trat er gegen einen Zweig, der zu seinen Füßen lag.
»Was geklappt hat. Es hat ihn von dir abgelenkt.«
»Dass ich nicht lache. Idiot! Deine Unüberlegtheit bringt meine Zukunft in Gefahr. Ich habe meinen Eltern ewig in den Ohren gelegen, um in die Schule gehen zu dürfen, und was machst du …?«
»Ich hol dich aus der Schusslinie«, sprang der andere Junge auf und stupste ihn herausfordernd an. »Denn dieser widerliche Kerl, der seinen Gott bloß anbetet, um einen Anlass zu haben, uns zu quälen, der wollte dich gerade …!«
»Egal, was er wollte. Verstanden? Ich bin dort, weil ich etwas will. Also, Blasrohrmeister John, misch dich nächstes Mal nicht ein!«
Nach »Pah« klang das, was John erwiderte, bevor er dem anderen einen Stoß versetzte. Der trudelte rückwärts, hielt sich aber weiterhin auf den Beinen und streckte ihm die Zunge aus. Was John gar nicht gefiel. Er stürmte auf ihn zu, und der andere rannte weg. Ihn verfluchend, jetzt in ihrer Sprache. Was sehr leicht zu verstehen war, sogar ohne Kenntnis der Wörter. Sie beleidigten sich gegenseitig auf Cherokee und jagten in einem wilden Hin und Her um die Platane. Linksherum, rechtsherum und wieder zurück. Ich ließ mich auf den Boden fallen und sah ihnen zu. Kurz, denn es war ein unfaires Rennen. Bald schon hatte derjenige, der sich mir als John vorgestellt hatte, den gedrungenen Jungen ausgetrickst, eingeholt und rücklings in einen der Kermesbeerensträucher geschubst, die in der Nähe der Platane wuchsen. Womit der Streit nicht beendet war. Der Junge in den Büschen raffte einige der schwarzroten Beeren zusammen, sprang auf und bewarf damit John wiederum. Überall auf der Kleidung hinterließen die Früchte dicke rote Flecke. Was nicht ungesühnt blieb. John riss seinerseits händevoll Kermesbeeren vom Strauch und warf sie mit wildem Geschrei in das Gesicht des Jungen. Die matschige rote Masse troff ihm wie Blut und Eiter von den Wangen. Ein Augenblick des Verharrens, und es entbrannte eine Schlacht. Um sicher vor den Querschlägern aus Ästen, Laub und Beerenmatsch zu sein, war ich aufgestanden und zur Seite ausgewichen. Was die beiden Kämpfenden unbeeindruckt ließ. Vorerst. Erst mein Lachen unterbrach die Schlacht. Oder lenkte sie vielmehr um, auf einen neuen, einen gemeinsamen Gegner. Auf mich. Johns letzte Beerenladung landete mitten in meinem Gesicht und die des anderen Jungen in meinen Haaren am Hinterkopf. Von meiner Stirn plumpste der Fruchtbrei auf meine Schuhe, hinten rutschte der Matsch den Rücken hinab. Mir war die Schlichtung gelungen, ohne sie beabsichtigt zu haben.
Wir verbrachten den Tag miteinander, wie die meisten in den nächsten Jahren. Ich erfuhr, dass der Schlaksige der beiden John Ridge hieß, wobei er bis vor kurzem noch Skahtlelohskee genannt wurde, was so viel wie gelber Vogel bedeutete. Und der andere wurde in den Cherokee-Dörfern Gallegina gerufen, weil die Lehrer den Namen verweigerten, sagten sie Buck zu ihm. Was ich für eine demütigende Bezeichnung in der aufgeheizten und aggressiven Stimmung meines ersten Schultags gehalten hatte, war die reine Übersetzung seines Namens gewesen, Hirschbock. Die Doppeldeutigkeit war Gallegina ebenso bewusst wie zuwider. Er grübelte oftmals darüber nach, wie er sich zukünftig nennen wolle, sagte, ein großer und bedeutender Name solle es sein, und bot uns fast täglich neue Vorschläge an, von denen keiner sich durchsetzte. George Washington, beispielsweise. Was mir lächerlich und anmaßend erschien, hielt er für eine Option. Dass man sich einfach einen neuen Namen aussuchte, wirkte verwirrend auf mich. Niemand tat das. Dachte ich. Bei den Cherokee war es normal, lernte ich. Der Name wechselte im Laufe des Lebens bei den meisten. Weil man erwachsen wurde, weil man wegzog, weil man sein Verhalten änderte, wegen einer Heldentat oder wegen eines Unglücks, das einem widerfuhr. Oder einfach, weil man lieber einen anderen Namen tragen wollte. Gallegina hatte sich bislang noch nicht entschieden, welcher dies sein würde. George Washington kam nicht in die engere Auswahl. John hatte nie eine Wahl gehabt, wie ich erfuhr. Sein Vater hatte für ihn entschieden. Nachdem ich The Ridge kennenlernte, hätte ich ebenfalls jeden Namen akzeptiert, den er mir gegeben hätte.
Gallegina und John waren Cousins, beide Mütter waren nur zur Hälfte Cherokee, und Oconostota war ihr gemeinsamer Großvater. Beide Familien genossen hohes Ansehen im Stamm. Galleginas Eltern bewirtschafteten jedoch im Verhältnis zu Johns Familie einen bescheidenen Hof. Die Jagd gehörte zum Alltag. Nie zu Galleginas Alltag. Weder als Kind noch später. So geschickt und wendig John war, wobei er nie als Jäger arbeiten musste, so ungeschickt war Gallegina im Umgang mit den traditionellen Waffen. Schon als Kind war seine schärfste Waffe der Verstand gewesen. Was dem Stammesrat ebenso wenig verborgen geblieben war. Normalerweise hätte er, anstatt zur Schule zu gehen, auf dem Hof der Eltern helfen, die nachbarschaftlichen Gemeinschaftsäcker versorgen oder mit auf Jagd gehen müssen. So wie es die meisten Kinder taten, zumal die ältesten Söhne. Für Gallegina sah nicht mal sein Vater Oowatie darin seine Zukunft.
Später, als ich nach Oothcaloga zog, lebte ich anfänglich in einer der Lehmhütten, in denen einstmals die meisten Cherokee hausten. Zu dem Zeitpunkt nur noch die ärmsten. Es war beengt, dunkel und karg. Das Land hingegen war fruchtbar. Hunger war selten ein Problem. Und sogar wenn, wie meine Hausernte vorm ersten Winter, der Ertrag knapp ausfiel, halfen die Nachbarn aus. Die Gemeinschaftsflächen, die von dem Dorf bewirtschaftet wurden, halfen jedem aus dem Dorf über die kalte Jahreszeit. Von großen Häusern und Reichtum war die Art zu leben jedoch weit entfernt. Jeder wird gebraucht, für die eigenen Felder und die der Dorfgemeinschaft. Die Kinder sind unentbehrlich.
Johns Eltern konnten es sich leisten, ihn daheim zu entbehren. Sein Vater war der Häuptling von Head of Coosa. Sie gaben dem Ort genug zurück, um den Jungen zur Schule zu schicken. Gegen seinen Willen. Im Gegensatz zu Gallegina. Der bekam den Willen durch, weil der Stammesrat ihm und seiner Familie half, damit er die Schule in Springplace besuchen konnte. Und sogar sein Vater, der sonst den Lehrern und Lehren der Schule misstraute, stimmte zu, nachdem er einsehen musste, dass die Wissbegierde des Sohnes nicht mit Jagen, Feldarbeit, Pflanzenkunde und den traditionellen Kenntnissen zu sättigen war. Was eine ebenso gute wie richtige Entscheidung war. Gallegina war anders als John und ich. Gallegina wollte alles lernen und wissen, er war zielstrebig und erreichte das anvisierte Ziel. Ohne Blasrohr, sondern mit Verstand und Planung. Und mit Wissen. Ihm entging keine Information. Nie. Ich brauchte mich ihm auch nicht vorzustellen. Er wusste bereits, wer ich und wessen Sohn ich war. Sie beide, John und Gallegina, stimmten mit dem Bild, das ich von denjenigen hatte, denen ich in Springplace zu begegnen fürchtete, überhaupt nicht überein. Sogar trotz des Blasrohr-Einsatzes von John. Oder wegen des Blasrohr-Einsatzes. Die wenigen Berichte meines Vaters und der erschreckende Eindruck der tätowierten Jäger verhießen anderes. Wobei das Spiel, mit dem wir den Rest des Tages verbrachten, zu den Jägern passte. John und Galleginas jüngerer Bruder Degataga, der irgendwann wie aus dem Nichts auftauchte und mitspielte, bewiesen dabei, wie überlegen sie Gallegina und mir waren. Zumindest im Chungke, der aufreibendsten Beschäftigung, der man sich freiwillig aussetzen kann. Unfreiwillig könnte es als Strafe gelten. Es besteht aus pausenlosem Gerenne und Gewerfe. Mit Regeln, die mir Gallegina zwar gewissenhaft und ausführlich erklärte, an die sich im Detail aber niemand halten wollte, wie mir schien. Das Feld, auf dem gespielt wird, muss möglichst eben sein. So Gallegina. Diesbezüglich muss ich zustimmen, denn es war eine Voraussetzung, die mein erstes Chungke-Feld nicht erfüllte. Es lag im Wald, mitten im Wald. Bäume sind für den Spielverlauf hinderlich. Guter Rat: Spielt auf ebener und hindernisloser Fläche. Das macht Chungke leichter. Aber nicht weniger anstrengend. Chungke heißt übersetzt: ›laufende harte Arbeit‹. Bis zum Abend wusste ich, warum.
Als John Ridge mit Gallegina und dem Bruder hinter sich auf dem Pony den Weg zurück nach Head of Coosa und Oothcaloga ritt, sprach nur Degataga. Jeden Moment, jeden Spielzug und jeden Fehler diskutierte er kleinlich durch. Mit sich selbst, einzig mit sich selbst. Weder Gallegina noch John war nach Gesprächen zumute. Der eine war zu müde, der andere in Gedanken. Bei dem Neuen. Wer war dieser Mattheus Hildebrand? Eine Fehlbesetzung beim Chungke. Zweifelsfrei. Außerdem war er der Sohn des Landhändlers. Insgesamt unbrauchbar, lautete Degatagas Einschätzung. Nur hatte Galleginas Bruder den Morgen nicht miterlebt. Erst im nächsten Frühjahr würde er, wenn überhaupt, die Schule in Springplace besuchen. Gern hätte John Gallegina nach seiner Meinung über den neuen Mitschüler gefragt. Doch der schlief, während sein kleiner Bruder ihn festhielt, damit er nicht vom Pony fiel. Hätte man John vor dem Schultag um ein Urteil gebeten, wäre es noch unerbittlicher ausgefallen als das von Degataga. Da hatte ihm der unbeholfen anmutende Junge noch nicht aus der Patsche geholfen. Mattheus Hildebrand? Vielleicht gehörte die unerwartete Hilfe ja zum Plan seines Vaters, des Landhändlers. Schulbildung war gewiss nicht der Grund für ihn gewesen, den Sohn nach Springplace zu schicken. Was war, wenn Mattheus ihm als Spion dienen sollte? Oder als interner Vertrauter? Dann war es ein guter Einstieg gewesen. Perfekt. Einerseits diskret und unaufdringlich. Andererseits fast freundschaftlich loyal. Sogar als sie zur Schule zurückschlichen, um die zurückgelassenen Ponys zu holen, wirkte es, als sei er auf ihrer Seite. Als sei er einer von ihnen. Die stille Zuversicht, das ängstliche Umsehen, das Zusammenzucken bei ungewöhnlichen Geräuschen und gleichfalls die Begegnung mit Joe, Andrew und John, die noch immer vor Joes Haus in Springplace saßen, als sie dorthin zurückkehrten. Das alles wirkte sehr überzeugend. Aufrichtig und echt. Die schüchterne Reaktion auf John Ross’ höhnische Sprüche und das Misstrauen in den Augen bei der Erklärung, dass Joe der Sohn von James Vann, aber eigentlich ›harmlos‹ sei. Wer James Vann betrunken erlebt hatte, der würde auch den Sohn mit Argwohn betrachten.
Mattheus’ Misstrauen sprach von gesundem Menschenverstand. Das bewies die Panik bei der Flucht ebenfalls, nachdem sie auf den Ponys saßen. Plötzlich stand Steiner vor der Schulhütte. Als er auf sie zustürmte, drohte er Mattheus mit der Strafe des Vaters. Nicht des Vaters im Himmel, sondern des Vaters, der zuhause auf ihn wartete. John sah die Tränen in den Augen, das verzweifelte Blinzeln, um sie zu unterdrücken. Den anderen waren sie nicht aufgefallen, aber ihm. Als sie sich am Pfad verabschiedeten, der vom Weg nach Head of Coosa zum Hildebrand-Haus abzweigte, wischte Mattheus die letzten feuchten Spuren fort. Wegen der hektischen Flucht und vom Wind in den Augen rührten sie, sagte er, als er Johns Blick sah. John wusste es besser. Es war die Angst. Würde sein Vater auf ihn warten, mit Strafen, er hätte alles unternommen, um das Zusammentreffen hinauszuschieben oder zu vermeiden. In Mattheus’ Lage wäre er vermutlich solange nicht nach Hause zurückgekehrt, bis die Sorgen seiner Mutter den Zorn von The Ridge verdrängt hätten. Soweit John wusste, gab es in Mattheus’ Leben keine Mutter mehr, die den Vater hätte milde stimmen können. Sein Verhalten wirkte dermaßen echt, dass John glauben mochte, es sei echt. Dass Mattheus wirklich ein netter Kerl war. Ein Freund?
Möglicherweise. Irgendwann. Trotzdem mochte John dem eigenen Glauben nicht recht trauen. Was war, wenn er bloß als Spion des Landhändlers fungierte und das Ganze einem perfiden Plan folgte? Wie so häufig, wie in den Geschichten des Großvaters Oconostota. Wie John es manchmal schon selbst erlebt hatte.