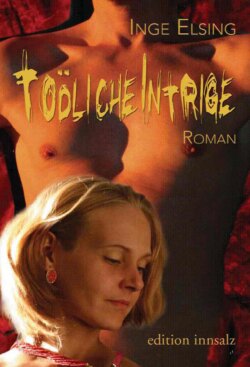Читать книгу Tödliche Intrige - Inge Elsing-Fitzinger - Страница 8
„La Violencia“
ОглавлениеEin Schreckgespenst, das ganz Kolumbien erschütterte.
Ein zäher Machtkampf skrupelloser Politiker. Ein Kräftemessen. Ein brutales Spiel mit der Macht. All das über den Köpfen der hungernden Bevölkerung. Die Menschen waren der Gnade, der Willkür, den Launen der Mächtigen ausgeliefert.
Die Jahre waren geprägt von gnadenlosen Schandtaten der Guerillatruppen, die sich in den Bergen zusammenrotteten, ihre Mitstreiter selbst aus entlegensten Bergdörfern requirierten. Kampffähige Männer wurden freiwillig oder mit Gewalt zu ihrem vermeintlichen Glück gezwungen, aber auch Kinder, Jungen, die mit hartem Drill zu tüchtigen Soldaten herangezüchtet wurden. Die Verluste der Truppen mussten wettgemacht werden. Die Tradition, die Sehnsucht der Unterdrückten nach Macht, forderte ihren Tribut.
Parallel dazu blühte der Drogenhandel, wuchs die Macht der Kartelle mit jedem Tag. Gemeinsam terrorisierten beide Organisationen Regierung und Bevölkerung mit Attentaten, Mord und Totschlag. Sodom und Gomorra in der neuen Welt, dem Erdteil, von dem ganz Europa als Schlaraffenland träumte. In einem Reich, in dem nur Milch und Honig fließen hätte können floss nun Blut in Strömen. Armut und Hunger breitete sich aus. Hoffnungslosigkeit und Verbrechen. Die Macht gehörte den Reichen und Korrupten. Wer sich nicht unterwarf, wurde kurzerhand beseitigt.
In den Bergen wurden Gold und Smaragde gefördert, auf verschlungenen Wegen geschmuggelt. Je größer der Profit, je einflussreicher die Position, je weit reichender das Ansehen eines Beamten, umso stattlicher die Schmiergelder. Man durfte nichts sehen, nichts hören und musste schweigen können.
Korruption wurde zur stillen Selbstverständlichkeit. Endlos war die Liste der Beschäftigten aller Branchen und Dienstgrade, die auf den Gehaltlisten der Dons angeführt waren. Sie waren die eigentlichen Herren der Stunde. Ihr langer Arm reichte über das ganze Land und weit über die Grenzen hinaus.
In einem der elenden Bergdörfer schleppte sich Emanuela Cortez mit letzter Kraft den steilen Hügel hinauf. Mit beiden Händen hielt sie ihren schweren Bauch. Schmerzvolle Wehen durchfluteten den schwachen Körper. Keuchend wand sie sich auf ihrem Lager aus Lumpen. Ein unbekanntes Feuer brannte in ihrem Körper. Eine alte Nachbarin trocknete ihre Tränen, kühlte die heiße Stirn. Stundenlange Qualen. Grauenvolle Erinnerungen an die Vergewaltigung vor neun Monaten. Ein Schmerz durchzuckte wie damals ihre Lenden. Ein markerschütternder Schrei. Zwischen ihren Beinen fühlte sie etwas Glitschiges, Warmes. Ekel kam hoch in ihr. Der kräftige Schrei des Neugeborenen riss sie aus ihren Alpträumen.
„Un niño, mi pequeña!“ kreischte die Alte.
In der Hütte war Frieden.
Roberto saugte gierig aber vergeblich an der schlaffen Brust seiner Mutter. Schrie fordernd. Wurde gewiegt und beschwichtigt. Nacht um Nacht, Tag um Tag. Doch der Junge schrie, anhaltend, kraftvoll. Der Rebellion zum Trotz. Dem vernichtenden Regime zur Warnung.
Die ausgemergelte Mutter erbettelte Ziegenmilch, Eselsmilch von Nachbarn und Freunden. Der Knabe sog die kräftige Nahrung auf, als wollte er schon jetzt im Alter von zwei Monaten der Welt seinen Willen aufzwingen.
Roberto Cortez war ein Kind dieser Zeit. Fragen nach seinem Vater blieben unbeantwortet. Die Züge der Mutter verschlossen sich stets zu einer ausdruckslosen Maske.
Onkel Pedro, Mutters Bruder, kam vorbei. Er bewirtschaftete einen kleinen Hof in den Hügeln unweit der Stadt Medellin. Brachte Fleisch und Früchte und Unfrieden. Endlose Diskussionen der Erwachsenen endeten jedes Mal mit Flüchen und Verwünschungen übelster Art.
Die fromme Mutter lehrte ihn beten, erzählte von Gottes Barmherzigkeit. Sein Geist lehnte sich gegen dieses sinnlose Geschwätz auf. Hunger, Not, Verzweiflung. Wo war die Barmherzigkeit? Die tiefe Frömmigkeit der Mutter unterlag kläglich.
In seinen Genen aber pulsierte das Böse. In seiner Seele tobte die Erbmasse des Vaters. In seinem Herzen lagen die Keime von Verderbtheit, Härte, Grausamkeit.
Im Laufe der Jahre versickerte der Krieg langsam im steinigen Boden, dem Emanuela mühselig Essbares abzuringen versuchte.
Ein Teufel hatte ihr den Sohn in den Schoß gepflanzt. Viele Male hatte sie das Ungeborene verflucht, neun Monate lang. Wie oft bat sie den Herrn ihr diese Sünde zu vergeben.
Emanuelas inbrünstige Bitten prallten an den rauen Felsen ab. Ein schrecklicher Traum verfolgte sie Nacht für Nacht:
Dieses Ungeheuer von Mann aus der Stadt, in seiner stinkenden Uniform. Riesig, mächtig, stark. Er hetzt sie durch dorniges Gestrüpp, durch Felsspalten. Sie strauchelt, stürzt, reißt sich Hände und Knie wund. Weiter, weiter, nicht anhalten. Sie greift ins Leere. Der Boden gibt nach. Sie fühlt seinen stickigen Atem auf ihrer Haut, seine brutale Umarmung. Ein stechender Schmerz in ihren Lenden. Blut fließt in einem kleinen Rinnsal die Steine entlang. Seine mächtige Gestalt, seine offene Hose. Breitbeinig steht er über ihr, stopft sein erschlafftes Glied in den Schlitz. Sein Grinsen. Sein zynischer Blick.
Furcht schlich in ihr Herz. Roberto. Die gleichen stechenden Augen, der gleiche zynische Mund, die gleichen stolzen Züge wie dieser namenlose Mann. Damals.
Es folgten Jahre der Furcht, des Entsetzens. Jahre ohne Hoffnung. Guerillakrieger kamen, verschleppten Freunde, Nachbarn, deren Söhne, die nur wenig älter waren als ihr Roberto.
Ein Loch im harten Küchenboden. Dort hinein steckte sie ihren Jungen, wenn Gefahr drohte.
Draußen tobt das Jüngste Gericht. Brennende Planken, Schreie. Entsetzte Augen. An einem Ast baumeln zwei Männer, splitternackt, übersät mit Wunden. Leblose Augen stieren aus verzerrten Gesichtern. Frauen, halb tot, die Seelen aus dem Leib gevögelt, verrückt. Die Männer tot. Die Söhne in den Klauen der Kämpfer.
Roberto überlebte.
In diesem Elend erschien Bruder Pedro als Retter, Erlöser. Emanuela sank vor ihm auf die Knie, weinte inbrünstig. Pedro nahm sie mit sich. Zwei billige Arbeitskräfte unter dem Deckmantel brüderlicher Nächstenliebe. An der Intensität ihrer Arbeit änderte sich nichts. Nur die Sonne schien etwas wärmer. Blumen blühten an den Hängen. Schwarze Wolken zerschellten an düsteren Felswänden. Das Leben schien erträglicher. Die Schmach löste sich auf.
Der gute Onkel war für Roberto ein rücksichtloser Tyrann. Er halste dem siebenjährigen Jungen Arbeiten auf, die ein erwachsener Mann kaum bewerkstelligen konnte. Todmüde schleppte er sich spät abends in die große Stube, ausgelaugt, ausgepumpt.
„Und! Hast du alles geschafft?“, dröhnte die mächtige Stimme des Hausherrn.
„Nicht ganz. Ich versuche gleich morgen den Zaun fertig zu machen. Ich bin zu klein. Ich kann die Pfosten nicht alleine so hoch stemmen. Die fallen immer wieder herunter.“
„Faul bist du. Ein Tölpel. Ein Taugenichts. In deinem Alter habe ich noch ganz andere Dinge bewältigt.“ Die drohende Hand holte zum Schlag aus. Rasch schob Roberto eine Brotkante in die Tasche, duckte sich, erhaschte einen Becher Milch und humpelte eilig zu seinem Strohsack. Sein zorniges Weinen, sein Stampfen, seine Wut über die Ohnmacht, die Hilflosigkeit machte ihn rasend.
„Es kommt der Tag, an dem ich diese schmerzenden Fangeisen abstreife.“ So sprach Roberto im Stillen zu sich. Er presste seine kleinen Fäuste so heftig zusammen, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Die Schule zu besuchen war Gesetz. Eine Tatsache, über die sich selbst Pedro nicht hinwegsetzen konnte, wenn er es auch für absolute Zeitverschwendung hielt.
Im Gegensatz zu vielen seiner faulen Freunde besuchte Roberto den Unterricht regelmäßig. Lernte begierig. Hörte aufmerksam zu. Die große Landkarte. Er suchte Städte in der näheren und weiteren Umgebung, schrieb ihre Namen auf, trachtete Neues zu erfahren.
Das Fest in Medellin, von den Bewohnern der Region mit Ungeduld erwartet. Stierkämpfe, Reiterspiele. Einige Male im Jahr fanden diese Fiestas statt, immer an einem anderen Ort. Immer war Roberto dabei.
Die Fiestas waren die Höhepunkte seines sonst so trostlosen Daseins. Söhne reicher Gutsherren aus der Gegend, kamen mit herrlichen Pferden und farbenprächtigen Gewändern angeritten. Edle Kleider, mit Bändern und silbernen Spangen verziert. Das glänzende Fell der Tiere. Wesen aus einer anderen Welt. Die jungen Männer, aufrecht und elegant. Siegessicher, selbstbewusst, unbezwingbar.
Roberto war begeistert. Keinen Blick ließ er von den stattlichen Reitern. Nur ein Ziel war in seinem Kopf.
„Ich werde auch einmal ein solches Pferd haben, ich will es, ich muss es haben.“ Stumm stand er da, mit glitzernden Augen, offenem Mund. Der Wunsch setzte sich in dem schwarzen Lockenkopf fest. „Ich will es. Was man wirklich will, kann man auch erreichen.“
Seine Kumpane verlachten ihn, nannten ihn einen unverbesserlichen Träumer, einen Irren.
Um das Gesicht nicht zu verlieren, beteiligte sich Roberto an nächtlichen Kämpfen mit den Jungen aus der Stadt. Steine dienten als Waffen. Die Meute stürmte durch nächtliche Straßen, zerschmetterte Auslagenfenster, schlitzte Autoreifen auf, montierte Räder von Autos und Karren ab. Verschwanden im Nichts, wenn die Feinde brüllend nahten.
Die Jungen der Stadtbande verletzten seinen Freund Gregorio schwer. Wimmernd blieb er liegen. Eine tiefe Wunde klaffte in seiner rechten Wade. Pfiffe der Guardia Civile. Die Stadtjungen waren so schnell verschwunden, wie sie vorher aufgetaucht waren. Roberto zerrte mit seinen Freunden den Verletzten aus der Stadt. Aus der Ferne hörten sie das schwächer werdende Geschrei und Geknatter der Garde.
Er fand es zwar toll seinen Mut unter Beweis zu stellen, doch was brachten diese Heldentaten tatsächlich?
Am nächsten Morgen begleitete eisiges Schweigen das Frühstück. Ehe Onkel Pedro den Raum verließ, schrie er Roberto an.
„Lass dir eine solche Torheit nicht noch einmal einfallen. Das nächste Mal fliegst du vom Hof. Da kann deine Mutter betteln, wie sie will.“
Ein prächtiges Auto stand im Hof. Neugierig betastete er mit verschwitzten Händen den glänzenden Lack, hinterließ hässliche Flecke auf der spiegelglatten Fläche.
Hinter seinem Rücken hörte er eine helle Kinderstimme: „Mach dir keine Gedanken. Zu Hause wird er ohnedies wieder gewaschen!“ Der Junge näherte sich ihm mit lachendem Gesicht. Er trug einen schicken Anzug, feine Lederschuhe, hatte saubere Hände. Roberto blickte in stumm an. Der Knabe war einen Kopf kleiner als er und wirkte sehr kindlich.
„Ich heiße Julio Maria Torres, und wie heißt du?“ Kinderaugen trafen sich, neugierig, aufgeweckt, ohne Vorurteil.
„Roberto Cortes“, kam zögernd die Antwort.
„Was machst du hier auf dem Hof. Wo ist dein Vater?“
„ Ich habe keinen Vater!“ war die kurze Antwort.
„Blödsinn! Jeder Mensch hat einen Vater. Kann sein, dass du ihn nicht kennst, aber haben musst du einen. Wie hätte deine Mutter dich sonst bekommen.“
Er hatte Recht. Doch darüber wollte sich Roberto schon lange nicht mehr den Kopf zerbrechen.
„Mein Onkel ist der Bauer Pedro. Meine Mutter und ich arbeiten auf dem Hof.“
„Mein Vater spricht jetzt mit deinem Onkel. Geschäftlich“, meinte er altklug. Die wollen irgendetwas Neues versuchen. Du verstehst sicher. Etwas, das mehr Geld einbringt, als die dreckige Landwirtschaft.“
Der feine Pinkel, was weiß der schon von Arbeit. Außer seiner Katze hat er bestimmt noch kein Tier mit den Händen berührt, und Zäune hat er sicher auch noch nie aufgestellt, dachte er trotzig. Trotzdem war ihm der Junge sympathisch.
„Hast du Lust mit auf den Heuboden zu kommen. Dort hab ich mein Versteck. Einen Schatz.“
„Klar, machen wir.“
Begeistert kletterten die beiden Knaben die hohe Leiter hinauf und verschwanden hinter Bergen von Heu. Zwischen zwei breiten Holzbalken zog Roberto ein großes Klappmesser und eine prächtige Steinschleuder hervor.
„Alles selbst gekauft, von meinem selbst verdienten Geld. Stolz schwang in Robertos Stimme mit. Die Schleudern macht ein Kumpel von mir. Wenn du eine willst, kann ich das organisieren.“
„Wie viel kostet so ein Ding?“
„Drei Pesos, wenn ich sie für einen Freund brauche.“
„Abgemacht. Aber wann kann ich sie dann haben. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder komme.“
In weiser Voraussicht hielt ihm Roberto großzügig die eigene Schleuder hin. Sein erster Deal.
„Nimm inzwischen meine. Wenn du das nächste Mal kommst, bringst du einfach das Geld mit.“
„Du bist ein echter Freund, Roberto. Das vergesse ich dir nie.“
Julio drückte Robertos schmutzige Hand. Er strahlte vor Begeisterung.
„Mein Vater kommt. Ich muss mich beeilen. Danke nochmals, mein Freund!“
Flink kletterte er die Leiter hinunter und sprang mit der gleichen Selbstverständlichkeit in das feine Auto, wie Roberto auf einen Heuwagen. Glückliches Winken. Er verschwand im Straßenstaub.
Tränenspuren hinterließen helle Streifen auf Robertos verdreckten Wangen. Eifersucht loderte in seinem kleinen Herzen. Eifersucht auf den vornehmen, reichen Jungen, und Jähzorn. Wut über die Ungerechtigkeit dieser verfluchten Welt. Trotzig verrichtete er seine Arbeit, kämpfte mit seinen aufgewühlten Gefühlen, wie einst Don Quichotte gegen Windmühlen. Ohnmächtiger Groll tobte im Herzen des Jungen.
Am nächsten Tag kam ein großer Lastwagen mit Landarbeitern, die Felder abernteten, umpflügten und neu bepflanzten. Onkel Pedro lief mit hochrotem Kopf durch die Reihen der neuen Arbeiter. Schrie Befehle, organisierte wie ein Feldmarschall.
Pedro wurde der erste Rauschgiftpflanzer der Region. Ein neues Zeitalter hatte begonnen. Zur Erntezeit kamen Dutzende Lastwagen und brausten voll beladen wieder davon. Dieser Vorgang wiederholte sich einige Male im Jahr. Felder von Nachbarn wurden gekauft. Immer mehr gewinnbringende Ladungen verließen den Hof. Pedros Reichtum mehrte sich ebenso wie sein Geiz und seine Härte.
Julio war noch einmal zurückgekommen. Stolz überreichte er Roberto drei Pesos, und einen Talisman, einen goldenen Skorpion mit drei Smaragden am Stachel. „Behalte ihn. Wenn du in Not bist, schick ihn mir. Dann werde ich da sein, mein Freund.“
Roberto wusste den eigentlichen Wert der Nadel nicht zu schätzen, wohl aber das Siegel der Freundschaft. In ein altes Tuch gewickelt, versteckte er das Kleinod in seinem Geheimfach am Heuboden. Das erste Mal in seinem Leben hatte er etwas Wichtiges in Erfahrung gebracht. Vertrauen, Ehre, Familie.
Die Zeit war reif, das Leben grundlegend zu ändern. Einen Hungerlohn und Almosen brauchte er nicht. Nie wieder wollte er ein Nichts sein. Nie mehr wollte er vergessen werden im Morast ungerechter Eintönigkeit, betäubender Sinnlosigkeit. Er wollte den trägen Strom durchschwimmen. Ausdauernd, zielstrebig. Überzeugte Beharrlichkeit flößte ihm Furcht ein. Furcht vor einer Zukunft, der er dennoch ungeduldig entgegenstrebte, die er bewältigen musste, die sein künftiges Leben bestimmen sollte. Der Kampf ums Überleben nahm seinen Lauf.
Eines Morgens war Roberto verschwunden. An seinem zwölften Geburtstag. Ohne ein Lebewohl für die Mutter, die sich von Pedro weiter ausnutzen lassen würde. Er war zu Größerem geboren!
Im Morgengrauen kletterte er den steilen Hügel hoch. Beschwingt und voller Tatendrang blickte er der aufgehenden Sonne siegessicher entgegen. In seiner Tasche das Klappmesser, die Schleuder. Ganz unten, am Boden seines Beutels, Julios Talisman. Ein Griff in Pedros wohl gehütete Geldschatulle gab ihm das Gefühl, ein reicher Mann zu sein.
Er kaute an einem Stück Brot. Den geklauten Schinken wollte er für später aufbewahren. Vor ihm lag das ersehnte, unbekannte Land. Schon sah er sich als vornehmer Patron, als Herr über viele Sklaven, denen er mit Härte und Macht begegnen wollte. Macht war der Inbegriff für Reichtum und Stärke. Rache wollte er nehmen für all das Leid, das ihm widerfahren war. Seine verbitterte Seele kannte weder Menschenwürde noch Nächstenliebe.
Die kühle Morgenluft spornte ihn an, trieb ihn weiter. Spät abends schlief er unter einer knorrigen Pinie ein. Ein Stück Freiheit hatte er schon erobert.
Am nächsten Morgen weckte ihn der knurrende Magen. Nach Stunden fand er einige Beeren. Eine Quelle löschte den quälenden Durst. Seine Schleuder hatte er verloren. Zorn und Missmut erfüllten ihn. Ein Mann, der seine Waffe verliert, muss bestraft werden.
Je weiter von zu Hause weg, je müder, umso verdrossener wurde er. Geschunden verzweifelt gelangte er in fruchtbares Gebiet. Seine hochtrabenden Gedanken waren gewaltig zusammengeschrumpft, sein Stolz fast gebrochen. Schafe und Rinderherden grasten im saftigen Gras, endlos. Seine Kehle war ausgetrocknet.
„Wo kommst d u her, Amigo“, lachte der Reiter, der aus der Weite der Steppe plötzlich aufgetauchte war. Das vom Wetter gegerbte Gesicht war von tiefen Falten durchzogen.
„Aus den Bergen, Senor, in der Nähe von Medellin.
Sein wirkliches zu Hause hatte keinen Namen. Keiner hatte sich je die Mühe gemacht, den wenigen Lehmhütten, die verstreut in den Mulden herumlagen, einen Namen zu geben. Medellin hieß der Ort, wo er von Onkel Pedro ausgenutzt und gequält worden war.
„Und warum kommst du jetzt hierher“, fragte der Reiter neugierig weiter.
„Ich suche Arbeit“, log Roberto.
Es schien ihm glaubwürdiger, mit fester Absicht seine Heimat verlassen zu haben, als von Abenteuerlust oder Unzufriedenheit zu reden.
„So. So, Arbeit suchst du“, meinte der Mann. Er wiegte bedenklich den kleinen Kopf, der unter dem riesigen Hut fast verschwand.
„Ich kann ordentlich zupacken. Lasst es mich nur versuchen. Ich schaffe mehr als ihr denkt.“ Sein Lebenswille besiegte Hunger, Durst und Müdigkeit.
Der Reiter blickte abschätzend den Jungen an. Warten war noch nie Robertos große Stärke gewesen.
„Na dann komm, du Ausreißer. Bist wohl einer, der auszog, das Fürchten zu lernen.“
„Angst habe ich bestimmt nicht“, antwortete Roberto nun etwas zuversichtlicher.
Nach einstündigem Ritt erreichten sie eine riesige Hazienda. Mächtig lag das flache Haupthaus inmitten saftiger Sträucher und hohen Pinien. Die Wände waren blütenweiß getüncht. Wilde Blüten rankten sich an der breiten Hausmauer empor. Zahlreiche Hütten und Scheunen standen in der Nähe. Aus einigen stiegen schwache Rauchwolken zum Himmel. Vor anderen saßen Arbeiter und verzehrten ihr Abendbrot. Lustiges Geschnatter und Gelächter erhob sich, als sie den Reiter samt Sozius ankommen sahen.
„Einen seltsamen Kojoten hast du da heute gefangen, Michele“, rief ein älterer Mann und wandte sich dann wieder seinem Stück Fleisch zu, das er gierig in den zahnlosen Mund schob.
Der Cowboy setzte Roberto vor einem der mächtigen Eingangstore ab und deutete ihm, vorwärts zu gehen. Mit großen Lettern stand da „OFICINA“.
„Keine Angst, hast du gesagt. Also geh hinein und sprich mit unserem Vorarbeiter. Mehr kann ich für dich nicht tun“, sagte er, und ritt gemächlich zurück zu den Herden. „Wie heißt du eigentlich?“, rief er noch zurück.
„Roberto Cortez, Senior“, lachte der Junge, und nahm allen Mut zusammen.