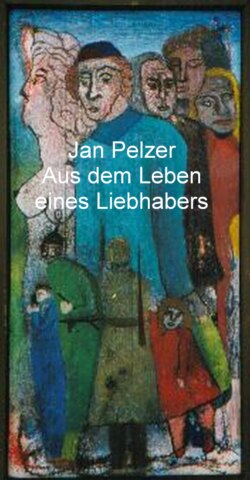Читать книгу Aus dem Leben eines Liebhabers - Jan Pelzer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein origineller Opa
ОглавлениеMeine gegenwärtige Sprachlosigkeit gegenüber anderen Menschen (mit Ausnahme deiner Person), die dir vielleicht unverständlich ist, hat außer dem „besonderen“ Grund auch noch den Grund, dass ich die moderne Welt nicht mehr verstehe. Verhaltensweisen von Glaube, Liebe, Hoffnung und Muße werden in der Sackgasse scheinbar überholter Lebensanschauungen abgeladen und durch Lebensvollzüge von Sex, Produktivität, Profitabilität, Events, Effektivität und Rationalität ersetzt. Die Folge sind Einstellungen von Misstrauen, Aggressivität und Profitgier, von Verherrlichung der Leistungsfähigkeit wie der einer Maschine. Die vorherrschenden volkstümlichen Wertbezeichnungen sind die Worte „cool“ und „geil“. Damit werden Kälte der zwischenmenschlichen Beziehungen und übertriebene egoistische Lustsucht zu vorherrschenden Leitbildern für unser Verhalten. Wie kann mit solchen Menschenmaschinen eine Verständigung über wesentliche Lebenswerte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Individualität, Glück und die mögliche Existenz einer göttlichen Dimension des Daseins stattfinden? Aber nur diese Verständigung garantiert die Lebensbedingungen einer individuellen menschlichen Seele. Ohne individuelle Kommunikation bewegen wir uns im Kreis genormter Begriffe und können kein Eigenleben entfalten. Wir werden reduziert auf Aparatschiks, Funktionäre, Mitläufer, Genossen, Massenmenschen. Die Sprache wird zur Schablone, zur Formel von Nichtssagendem. Wozu soll man also noch mit jemandem sprechen?
Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die für mich als Kind zum einen von dieser modernen Welt geprägt war, die aber auch voller Wunder, Träume, Zauber, Fantasie und Verspieltheit war. Und diejenigen, die mir diese andere Welt vermittelten, waren meine Großeltern. In den folgenden Geschichten spielt daher mein Opa, der dir schon aus einer früheren Geschichte bekannt ist, die Hauptrolle. Er hatte als Eisenbahner beim Ankoppeln zweier Waggons einen Fuß verloren und musste eine Prothese tragen. Er versuchte die Prothese zu ignorieren und bewegte sich zwar etwas mühsam, aber ohne Krücke oder Stock. Die Reichsbahn konnte ihn dennoch nicht länger beschäftigen, und so musste er sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Er bekam eine Stelle als Platzmeister auf einer Zeche und wurde sogar verbeamtet. Trotzdem war sein Einkommen gering und meine Oma musste durch Einrichtung eines Mittagstisches für Herren in „gehobenen Positionen“ oder durch die Vermietung von Zimmern mit Vollpension ein „Zubrot“ verdienen. Durch Tierhaltung und einen großen Gemüsegarten konnten sie zudem einen Teil ihrer Lebensmittel selbst produzieren, lebten aber nach heutigen Anschauungen bis auf die Ausnahme von wenigen Jahren dauernd an der Armutsgrenze. Sie selber empfanden das nicht so, sondern fühlten sich als Angehörige der Mittelschicht.
Politisch identifizierte sich meine Oma auch noch in der Zeit der Weimarer Republik mit den „höheren Ständen“, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und nationalstaatlichen Tendenzen der Kaiserzeit. Sie war stramm „deutschnational“ und unterstützte damit die Großindustriellen und Großagrarier, die reaktionären Monarchisten und Nationalisten, eine Partei also, die für die Interessen der „kleinen Leute“, zu denen meine Großeltern gehörten, auch nicht die geringste Affinität hatte. Meine Oma war sogar aktives Parteimitglied und rückte durch ihr Engagement als Kassiererin in den lokalen Vorstand der Partei auf.
Mein Opa dagegen zeigte in seinem Alltagsverhalten eine anarchistische Distanz und souveräne innere Freiheit von staatlichen Autoritäten oder nationaler Großspurigkeit, die ihn dazu verleitete, durch sein Verhalten die von der deutschnationalen Partei propagierten Werte geradezu ad absurdum zu führen. Das tat er aber nicht aus einer bewussten politischen Einstellung, sondern weil er im Grunde seines Wesens ein unpolitischer Mensch war, ein Schalk, ein Eulenspiegel, ein Hauptmann von Köpenick, ein Spieler, der den Theaterdonner des Kaisertums unbewusst durch sein Komödiantentum, das Sein und Schein bruchlos miteinander verband und von den staatlichen Organen häufig als Sein begriffen wurde, als solchen entlarvte.
Er besorgte sich ins Auge fallende Kleidungsstücke oder Uniformzubehör staatlicher Amtsträger, z.B. eine Polizeiuniform samt Helm, oder reaktivierte seine Eisenbahnermontur, die er mit der Kelle und Kopfbedeckung eines Stationsvorstehers noch veredelte. Er bezahlte von da an auch keine Zugreise mehr, sondern durchquerte meistens unbehelligt in seiner Eisenbahnerlitewka die Kontrollstellen zu den Bahnsteigen und besetzte die Zugbegleiter-Kabine, die von dem Dienst tuenden Personal so gut wie nie benutzt wurde. Am Zielort angekommen, durchquerte er in seiner Uniform die Kontrolle ebenso unangefochten wie in seiner Heimatstadt. Auf diese Art und Weise hielt er Kontakt zu seiner ländlichen Heimat im Westfälischen und hamsterte dort von befreundeten Bauern Fleisch, Fisch, Schinken, Speck und Mettwürste, durch deren Verarbeitung meine Oma ihren Mittagstisch sehr attraktiv gestalten konnte.
Es konnte ihm aber durchaus passieren, dass er mit seiner „Hamsterbeute“ und seiner Leidenschaft für das Skatspiel auf dem Heimweg irgendwelchen Skatbrüdern in die Hände fiel, die ihn so ausnahmen, dass er Fleisch, Fisch, Schinken, Speck und Mettwürste zur Bezahlung seiner Spielschulden herausrücken musste und mit leeren Händen nach Hause kam. Eine solche Heimkehr gestaltete sich dann äußerst unangenehm für ihn, weil die tatkräftige Oma die Hamstersachen bereits für den nächsten Mittagstisch eingeplant hatte und nun mit virtuosen Kochkünsten aus einem Hering eine falsche Forelle und aus einem geschlachteten Huhn eine Portion Kalbsfrikassee zaubern musste. Den Pensionsgästen schmeckten diese „Delikatessen“ zwar auch gut, aber die lautstarke Philippika, die sich Opa anhören musste, verleidete es ihm doch sehr, sich mit gefülltem Hamstersack noch einmal auf ein unsicheres Skatvergnügen einzulassen. Er hielt sich zwar zu Recht für einen der besten Skatspieler der Stadt, aber gegen die ausgefuchsten Tricks eines eingespielten Duos war er machtlos. Er selber spielte ehrlich und rechnete auch aufgrund seiner Arglosigkeit nicht mit den schmutzigen Methoden seiner Mitspieler. Außerdem hängt der Erfolg beim Skatspiel ja auch von einem „guten Blatt“ ab, und Opas Leidenschaft für das Spiel war so groß, dass er auch kein Ende fand, wenn er einen ganzen Abend lang kein „gutes Blatt“ bekam.
Seine Leidenschaft für das Skatspiel war auch der Grund, warum er mit seiner Familie in der Zeit vor seinem Unfall eine Wohnung über einer Kneipe bezogen hatte. Denn hier konnte er sicher sein, dass er abends immer einige Skatbrüder vorfinden würde, die zu einem Spielchen bereit waren. Meistens kam er aus diesem „Revier“ mit einem kleinen Gewinn nach Hause, aber es gab, wie das Beispiel mit den verlorenen Hamstersachen zeigt, auch Pechsträhnen für ihn, so dass Gewinn und Verlust sich in etwa die Waage hielten.
Um aber eine Legitimation für sein Abendvergnügen zu haben, verbreitete er stur die Legende, dass er durch seine abendliche „Nebenerwerbstätigkeit“ zu dem gemeinsamen Haushalt ein nicht zu verachtendes Sümmchen beisteuere. Wahrscheinlich steckte auch in dieser wie in jeder anderen Legende ein Körnchen Wahrheit, denn er nutzte seinen abendlichen Kneipenaufenthalt nicht zum übertriebenen Konsum von Alkohol oder Rauchwerk und war daher in fortgeschrittener Stunde seinen meistens angesäuselten Partnern durch Nüchternheit und Vernunft selbst bei einem „schlechten Blatt“ überlegen. Bei den Spielen um einen Zehntelpfennig konnte aber von „Nebenerwerbstätigkeit“ keine Rede sein, selbst wenn er eine Glückssträhne gehabt hatte. Und das Wort „Nebenerwerbstätigkeit“ entlarvte sich als Alibi, das er zu brauchen glaubte, weil seine Frau wie eine Berserkerin tags und nachts schaffte und tatsächlich bald mehr verdiente als er – trotz seines Beamtenstatus und seiner ununterbrochenen „Nebenerwerbstätigkeit“.
Omas Tatkraft und seine Solidität hatten denn auch einen kurzfristigen finanziellen Reichtum zur Folge, der es ihnen ermöglicht hätte, eine Kneipe auf eigene Rechnung zu kaufen und zu betreiben. Aber Opas Biedersinn und sein mangelnder politischer und wirtschaftlicher Weitblick verhinderten das Projekt, und so verloren sie in der Zeit der Inflation ihr gesamtes Barvermögen; d.h. sie konnten sich für die entwerteten Zigtausender in letzter Minute noch einen echten Teppich kaufen.
Die Gäste und die Wirtsleute „seiner Kneipe“ mochten ihn, weil er ein verlässlicher Ansprechpartner für alle war und mit seiner ehrlichen Meinung nicht zurückhielt, wenn ihn jemand danach fragte. Zwar waren nur „harte Arbeit“, „Anständigkeit“, auch „Treue“ und „Fürsorge“ für seine Familie seine etwas dürftigen Lebensfixpunkte, aber jede Anschauung, die er dazu äußerte, war authentisch und hatte er in seinem Leben hundertfach bewährt. Außerdem war er für alle Skatspieler des Stadtviertels, in dem er wohnte, ein Mitspieler, mit dem man abends immer rechnen konnte und der durch seine Spielleidenschaft viele andere Kneipenbesucher ansteckte, so dass zur Freude der Wirtsleute ihre Kneipe fast jeden Abend mit Skatbrüdern und „Kiebitzen“ gefüllt war.
Wenn sie gelegentlich bis zur Polizeistunde mit der Abwicklung ihrer Turniere nicht fertig wurden, verschaffte Opa ihnen noch eine ausreichende Verlängerung, indem er aus seiner Wohnung die Polizistenuniform holte und anzog und den anrückenden „Kollegen von der Polizei“, die für pünktliche Schließung des Gewerbebetriebes sorgen wollten, versicherte, dass er bereits dabei sei, das Lokal zu räumen. Diese zogen dann auch weiter zum nächsten Lokal und überließen es Opa, den „Laden dicht zu machen“. Wenn er selber nicht mehr an einer Endausscheidung beteiligt war, gelang ihm dies meist nach einer halben Stunde; wenn es aber anders war, mussten die um ihre Lizenz besorgten Wirtsleute Oma holen, der es dann mit Hinweis auf ihre Müdigkeit infolge ihrer vielen am Tage geleisteten Arbeit relativ schnell gelang, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Die echten Polizisten, die seine Köpenickiaden erkannt haben müssen, wussten, dass die „halbe Stunde“ Polizeistundenüberschreitung zuverlässig eingehalten würde, und zogen die konfliktfreie kurze Fristverlängerung einer gewalttätigen lang dauernden Auseinandersetzung vor und bekamen mit dieser Strategie auch nicht ein einziges Mal Schwierigkeiten.
Opa hatte ihnen zudem wiederholt riskante Einsätze abgenommen, wenn betrunkene Gäste zu später Stunde in der Kneipe zu randalieren begannen. Er lief dann schnell nach „oben“, in seine Wohnung, warf sich in die Polizistenuniform, setzte den zugehörigen Helm auf, zog einen Polizeiprotokollblock aus seiner Schreibtischschublade, bewaffnete sich mit einem Bleistift und erschien in dieser dienstlichen Aufmachung mit grimmiger Miene auf dem Schauplatz der Ereignisse. Meistens brauchte er nur in dieser Montur aufzutauchen, um die Streithähne zu panikartiger Flucht aus dem „Etablissement“ zu veranlassen. Genügte die „Dienstkleidung“ aber nicht, um diesen Effekt zu bewirken, scheute er sich nicht, eine oder zwei Handschellen aus seiner Uniformjacke zu zaubern und die Übeltäter mit donnernder Stimme mit Arrest und polizeilicher Anzeige zu bedrohen, was auch den letzten Krakeeler von den Vorteilen eines schleunigen Rückzuges überzeugte und Opa als triumphierenden Sieger auf der Bildfläche zurück ließ.
Eines Abends, zur Zeit der Ruhrgebietsbesetzung, als das Lokal schon längst geschlossen war und zwei laute, angetrunkene französische Besatzungssoldaten noch Einlass in die Kneipe begehrten, glaubte er wieder mit polizeilichen Mitteln die Ruhe herstellen zu können. Zudem war er an diesem Tag maßlos erbittert über die französische Besatzung, weil ihn tags, bei seiner Rückkehr von der Bahn mit dem Rad, zwei patrouillierende französische Soldaten vom Bürgersteig abgedrängt hatten, wie sie das öfter gegenüber deutschen Passanten praktizierten, wodurch er zu Fall gekommen war und sich schmerzhafte Prellungen zugezogen hatte. Er streckte also seinen mit Polizistenhelm geschmückten Kopf aus dem Fenster und begann die Franzosen unflätig zu beschimpfen. Es müssen Worte wie „Kriegsverbrecher“, „Schmarotzervolk“ und „kriminelle Halunken“ gefallen sein, Worte, die mein Opa sonst nicht in den Mund nahm, die ihm aber sein am Tag erlebtes Zusammentreffen mit ganz anderen Franzosen eingab und die von den französischen Soldaten mit Sicherheit nicht verstanden wurden. Dennoch merkten die Soldaten an Tonfall und Gestik meines Opas, dass sie gemeint waren und dass das ihnen entgegengebrachte Gebaren keineswegs freundlich war, sondern bei einem Uniform- und mutmaßlichen Waffenträger äußerst gefährlich für sie sein konnte. Sie rissen daher ihre Gewehre von den Schultern, entsicherten sie und legten auf Opa an. Und nur dem beherzten und geistesgegenwärtigen Eingreifen meiner Oma und meiner damals noch jugendlichen Mutter, die den Opa vom Fenster wegrissen, ist es zu verdanken, dass er damals nicht seinen allerletzten Auftritt auf der Bühne des Lebens hatte.
Dieses wäre für mich sehr bedauerlich gewesen, denn dann wäre ich nicht mehr in den Genuss seiner Inszenierungen und Rollenspiele gekommen, wie es die folgenden Geschichten bezeugen.