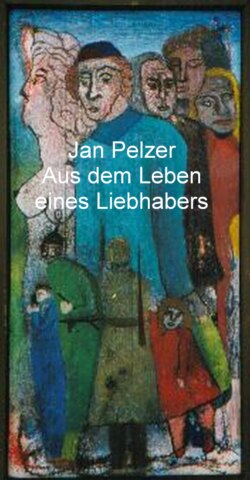Читать книгу Aus dem Leben eines Liebhabers - Jan Pelzer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der kindliche Virtuose
ОглавлениеAber ich habe der Zeit vorausgegriffen. Meine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Situation und meiner Umwelt fängt schon viel früher an. Obwohl ich mit 13 Jahren mit meinen Leistungen im Sport und in künstlerischen Betätigungen meine „Behinderung“ etwas kompensieren konnte und mein Selbstbewusstsein die ersten zarten Knospen trieb, blieben mir - dem nationalsozialistischen Zeitgeist entsprechend - auch auf diesen Gebieten Niederlagen und enttäuschende Erfahrungen nicht erspart. So wurde mir trotz guter Torwartleistungen im Fußball wegen meiner Hasenscharte die Aufstellung für die Schulmannschaft meiner Altersklasse vorenthalten. Auch für den feierlichen Gedichtvortrag anlässlich einer patriotischen Feier in der Aula unserer Schule kam ich nicht in Frage.
Und auch als kindlicher Violinvirtuose fand ich nicht die Aufmerksamkeit, die ich für meine Leistung verdient gehabt hätte. Aber diese Missachtung, die ich dort erfuhr, erfuhr ich nicht wegen meiner Hasenscharte, sondern wegen der Konkurrenz von Kaffee und Kuchen, die auch jedem anderen Virtuosen zu schaffen gemacht hätte. Dass sie letztlich meinem bereits fortgeschrittenen Selbstbewusstsein nicht geschadet hat, kann man an der Schilderung des Vorgangs ablesen.
Die Geschichte spielte sich in meiner Gymnasialzeit ab. Ich war damals in der Quarta, der siebten Klasse, und schon ein ziemlich fortgeschrittener Geigenspieler. Meine Schule feierte damals – im Jahr 1940 – ihr 50jähriges Jubiläum und veranstaltete aus diesem Grunde ein Schulfest. Meine Klasse wollte an diesem Tage ein Café betreiben, in dem auch Life-Musik zu hören sein sollte. Ich sollte der Caféhausgeiger sein. Diese Aufgabe nahm ich sehr ernst und übte ein viel zu anspruchsvolles Programm ein, das ich auswendig vortragen wollte. Als mein Auftritt kam, den man mit großen Lettern angekündigt hatte, war das Café bis an den Rand mit Besuchern gefüllt. Diese waren von den guten Kuchen, die die Mütter meiner Klassenkameraden gebacken hatten, und von den verführerischen Düften des frisch aufgegossenen Kaffees angelockt worden. Sie veranstalteten einen Höllenlärm, der sich auch nicht legte, als ich meine Geige auspackte und zu spielen begann. Ich spielte zunächst einige Ungarische Tänze von Brahms, die für Violine bearbeitet waren und ziemlich virtuos klangen. Sie konnten von den Besuchern aber nur bruchstückhaft gehört werden, weil sie keine Veranlassung sahen wegen meines Spiels etwas leiser zu sein.
Dieses Verhalten war für mich schon etwas deprimierend, aber ich fasste mich und spielte einige Schlagermelodien, die damals gerne gehört wurden: „Kann denn Liebe Sünde sein“ oder „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ oder „Gnädige Frau, wo warn Sie gestern?“ oder „Ausgerechnet Bananen“ oder „Unter einem Regenschirm am Abend“ usw., Schlager, die zum größten Teil von Zarah Leander vorgetragen wurden und deren frivol-laszive Erotik in heftigem Gegensatz zu der Erscheinung des kindlichen, knabenhaften Spargel-Tarzans standen, der so hingebungsvoll die Violine strich.
Beim Vortrag dieser Melodien störte es mich nicht, wenn der Lärm der Besucher weiter um mich herumbrandete, weil ich mich sehr darauf konzentrieren musste, die richtigen Töne zu greifen und die Melodien gefällig zu variieren und mit virtuosen Läufen und Doppelgriffpassagen effektvoll auszugestalten. Zudem klatschten die Leute nach jedem Musikstück bereitwillig Beifall.
Allerdings merkte ich genau, dass dieser Beifall einen sehr konventionellen Charakter hatte, eine Angelegenheit des höflichen Benehmens war und zu der Qualität oder dem Murks meiner Darbietung in keinem Verhältnis stand. Ich provozierte denn auch bald das Publikum, indem ich mit Absicht Dissonanzen in meine Schlagerparaphrasen einbaute oder das Publikum durch die Wiedergabe der Melodie von „Du bist verrückt, mein Kind, du kommst aus Berlin, wo die Verrückten sind, da gehörst du hin“ zu attackieren versuchte oder auch die Melodie des frech-anarchischen „Bolle-Liedes“ bis zum Exzess strapazierte. Aber die Zuschauer klatschten genauso unbeteiligt und mechanisch wie vorher Beifall und sie hätten, glaube ich, auch zu ihrem musikalisch verpackten Todesurteil geklatscht, weil sie überhaupt nicht hinhörten, sondern auf ihre Unterhaltungen und ihren Kuchen fixiert waren.
Ein etwas reiferer Mensch, als ich es damals war, hätte dieses Verhalten als normal begriffen und die Leute noch eine Zeit lang mit belangloser Musik berieselt, ohne sich für die technische Perfektion oder den emotionalen Ausdruck der gespielten Stücke zu engagieren; aber ich war zu solch einer zynischen – wenn auch der Situation angemessenen – Haltung nicht in der Lage und litt unter der Nichtbeachtung und offensichtlichen Geringschätzung meiner Bemühungen.
Schließlich wollte ich mit Gewalt diese Mauer von Ignoranz und Gleichgültigkeit sprengen und ich dachte, ich könnte das mit dem Vortrag eines Stückes erreichen, das ich am meisten liebte und das ich für diese Veranstaltung besonders intensiv geübt hatte, der G-Dur Romanze für Violine von Beethoven, deren auswendig gespielter Vortrag für einen musisch nur normal begabten Jugendlichen schon eine bemerkenswerte Leistung ist.
Ich legte nun alle Kraft und meine ganze Seele in den Vortrag des Stückes – in der Erwartung, dass mir die Cafégäste wenigstens dieses eine Mal zuhörten oder doch zumindest die Musik zum Ertönen kommen ließen. Aber nichts änderte sich. Diese von mir innerlich so empfundenen „Dickhäuter“ fraßen weiter ihren Kuchen in sich hinein, schlürften schmatzend ihren Kaffee, qualmten genüsslich ihre Lord Astor und palaverten weiter über die Pflege von Gesichtswarzen und Hühneraugen, ohne von dem besonderen Ereignis, das sich für meine Begriffe soeben in ihrer Nähe abspielte, auch nur das Geringste wahrzunehmen.
Erst als ich kurz vor dem Ende der Romanze mein Spiel abbrach und die verdatterten Spießbürger anschrie: „Für solche Säue spiele ich nicht!“, entstand ein ärgerlicher Tumult und eine aggressive Empörung. Einige der aufgebrachten Väter wollten mich sogar schlagen, und nur dem entschlossenen Eingreifen meines Musiklehrers, der – wohl angelockt durch meine Töne – einige Minuten vorher den Raum betreten hatte und mir jetzt demonstrativ Beifall zollte, habe ich es zu verdanken, dass ich nicht mit blauem Auge und aufgeplatzter Lippe den Schauplatz verlassen musste.
Er stellte sich zornig vor mich und rief die Versammlung zur Ordnung und erklärte dann noch, dass die Lautstärke, mit der sie meine beseelte Interpretation der Beethoven-Romanze gestört hätten, ein Zeichen von fehlender Kultur und Herzensbildung sei und dass sie die Leistung, die ich ihnen geboten hätte, überhaupt nicht zu schätzen gewusst hätten. Er könne meinen Unmut deswegen völlig verstehen und er selber, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, hätte sich genauso verhalten.
Ich hatte inzwischen weinend meine Geige eingepackt und verließ darauf an der Hand meines Musiklehrers den Raum. Die Caféhausbesucher aber, so erzählten es mir meine Klassenkameraden am nächsten Tag, hätten nach einer kurzen Pause der Betroffenheit weiter palavert, als sei nichts passiert.