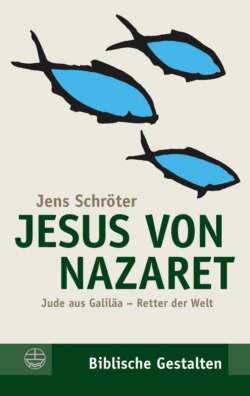Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. EIN BLICK IN DIE FORSCHUNGSGESCHICHTE
ОглавлениеEine heutige Jesusdarstellung baut auf der mehr als zweihundertjährigen Arbeit historisch-kritischer Forschung auf. Sie profitiert von den dabei gewonnenen Erkenntnissen über die Quellen sowie über den politischen, religiösen und kulturellen Kontext Jesu.
Die historisch-kritische Jesusforschung wird zumeist in drei Phasen eingeteilt: die sog. »liberale Leben-Jesu-Forschung«, die das 19. Jahrhundert bestimmte und am Beginn des 20. Jahrhunderts an ihr Ende kam, die sog. »neue Frage nach dem historischen Jesus«, deren Beginn in der Regel in dem wichtigen Vortrag Ernst Käsemanns über »Das Problem des historischen Jesus« von 1953 gesehen wird,11 sowie die in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts einsetzende, sich selbst als »dritte Frage« (»Third Quest«) nach dem historischen Jesus bezeichnende Richtung. Man kann natürlich auch hiervon abweichende Einteilungen vornehmen.12 Im Folgenden soll es jedoch nicht um derartige Einteilungsfragen, sondern um einige grundlegende Merkmale der neuzeitlichen Jesusforschung gehen.13
Eine wichtige Voraussetzung für die Frage nach dem historischen Jesus ist die oben schon genannte Beurteilung der biblischen Schriften am Maßstab der kritischen Vernunft. Dass die Bibel, in christlicher Antike und christlichem Mittelalter Grundlage des Welt- und Menschenbildes, in der Neuzeit zum Gegenstand wissenschaftlicher Kritik wurde, ist eine in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzende Entwicklung. Sie bildet die Grundlage für das historisch-kritische Bewusstsein, das die Aussagen der Heiligen Schrift nicht mehr automatisch mit der Wahrheit gleichsetzt, sondern zwischen historischer Wirklichkeit und Deutung unterscheidet. Diese heute selbstverständlich erscheinende Unterscheidung war zur Zeit ihrer Entstehung eine regelrechte Revolution.
Innerhalb der Jesusforschung wird diese Entwicklung zuerst bei dem schon genannten Hermann Samuel Reimarus greifbar. In seiner bereits erwähnten Schrift zur Verteidigung der »vernünftigen Verehrer Gottes« stellt er eine Differenz zwischen der Lehre Jesu und der Entstehung des christlichen Glaubens fest und bezeichnet es als einen »gemeinen Irrthum der Christen«, beides miteinander vermischt zu haben. Die Verkündigung Jesu selbst sei eine im Kontext des Judentums angesiedelte ethische Belehrung, ausgerichtet auf »Aenderung des Sinnes, auf ungeheuchelte Liebe Gottes und des Nächsten, auf Demuth, Sanftmuth, Verläugnung sein selbst, auf Unterdrückung aller bösen Lust«, auf moralische Besserung des Menschen also, jedoch nicht auf ein neues, das Judentum ablösendes Religionssystem. Dieses hätten vielmehr erst die Apostel (Reimarus meint hier die Verfasser der neutestamentlichen Briefe, im Unterschied zu den Evangelisten als Geschichtsschreibern) nach Jesu Tod entwickelt und an die Stelle der einfachen, natürlichen Religion Jesu das System eines leidenden, vom Tode auferstehenden und nach seiner Himmelfahrt zum Gericht wiederkommenden Erlösers gesetzt.
Trotz etlicher Unzulänglichkeiten, auf die hier nicht näher einzugehen ist, ist die Theorie von Reimarus die erste konsequente Erklärung der Lehre Jesu aus ihrem historischen Kontext heraus. Dass die Frage nach Jesus immer auch eine Aufgabe historischer Forschung ist, wurde dabei durch Reimarus (und Lessing) zu Recht herausgestellt und in der neueren Jesusforschung wieder deutlich hervorgehoben. Die Kenntnisse über die politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse der Zeit Jesu sind dabei heute ungleich präziser als zu Zeiten von Reimarus. Diese Kenntnisse bilden einen wichtigen Bestandteil gegenwärtiger Jesusdarstellungen. Um das Auftreten Jesu zu beschreiben, muss danach gefragt werden, mit welchen Menschen er in Kontakt kam, müssen die sozialen und politischen Verhältnisse der Gegend, in der er wirkte, in den Blick genommen werden. Um den historischen Kontext Jesu auszuleuchten, sind alle Materialien, die hierüber Informationen liefern, heranzuziehen. Biblische und außerbiblische Texte halten Kenntnisse zur Geschichte Palästinas und des galiläischen Judentums bereit. Archäologische Funde, Inschriften oder Münzen helfen, dieses Bild zu konkretisieren. Die umfassende Berücksichtigung dieses Materials ist in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der Jesusforschung geworden.14 Mit dem Programm, Jesus aus seinem konkreten jüdischen Kontext heraus zu verstehen, bewegt sich die Jesusforschung dabei in den Spuren von Reimarus.
Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus dem besonderen Charakter der Evangelien. Hatte noch Reimarus – ähnlich wie auch Lessing – deren Verfasser als glaubwürdige Geschichtsschreiber betrachtet,15 so entdeckte David Friedrich Strauß (1808–1874), dass die Berichte über Jesus von Motiven geprägt sind, die größtenteils aus dem Alten Testament oder dem Judentum stammen (wie etwa die Erwartung des kommenden Messias) und die nunmehr auf Jesus übertragen wurden, um die Bedeutung seiner Person zum Ausdruck zu bringen. Strauß verwendete hierfür den Begriff »Mythos« und verstand darunter die »geschichtsartige Einkleidung« von Ideen, die in der Person Jesu als verwirklicht angesehen wurden und deren höchste die Idee der Gottmenschheit sei. War bei Reimarus zum ersten Mal das Verhältnis von Wirken Jesu und Entstehung des christlichen Glaubens thematisiert worden, so werden bei Strauß die Evangelien selbst auf ihre historische Grundlage hin befragt. Die dabei eingeführte Differenzierung zwischen historischer Wirklichkeit und deutender Darstellung ist seither aus der Jesusforschung nicht mehr wegzudenken.
Die von Strauß aufgeworfene Frage, ob die historischen Ereignisse des Wirkens Jesu zur Wahrheit des Christentums dazugehören oder aber zugunsten der »Ideen«, mit denen sie gedeutet wurden, letztlich verzichtbar seien, wird von Martin Kähler (1835–1912) in einem berühmt gewordenen Vortrag von 1892 mit dem bezeichnenden Titel »Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus« dahingehend beantwortet, dass der Versuch, hinter den biblisch bezeugten Christus auf den historischen Jesus zurückgehen zu wollen, ein Holzweg sei. Die neutestamentlichen Darstellungen seien Verkündigung, deren Wahrheit nicht mit den Mitteln historischer Kritik erhoben werden könne. Es gelte vielmehr, den wirklichen in dem gepredigten Christus zu erkennen. Eine Unterscheidung von historischen Ereignissen und ihrer Deutung durch den christlichen Glauben, der ihnen erst nachträglich eine Bedeutung verleihe, lehnte Kähler dagegen vehement ab.
Die Linie von Strauß zu Kähler lässt sich über Rudolf Bultmann und Paul Tillich bis zu dem nordamerikanischen Exegeten Luke Timothy Johnson verlängern.16 Das Kennzeichen dieser Position ist es, eine Rekonstruktion des historischen Jesus jenseits der christlichen Glaubenszeugnisse – und damit das Projekt eines »historischen Jesus« – angesichts der Quellen für nicht realisierbar und theologisch für unsachgemäß zu halten. Die Deutungen seines Wirkens und Geschicks aus der Sicht des christlichen Glaubens seien genau diejenige Form, in der Jesus geschichtlich wirksam geworden sei, deshalb sei es methodisch wie sachlich unangemessen, unabhängig hiervon nach einem »historischen Jesus« suchen zu wollen.
Diese Position hat in der deutschsprachigen Jesusforschung eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. Ihr prinzipielles Recht liegt in dem Insistieren darauf, dass historische Forschung nicht hinter die christlichen Glaubensüberzeugungen zu dem »wirklichen« Jesus vordringt. Dass die nachösterlichen Glaubensüberzeugungen die Darstellungen des vorösterlichen Wirkens Jesu maßgeblich geprägt haben, steht außer Frage. Gleichwohl wäre es voreilig, die historische Jesusfrage damit grundsätzlich zu verabschieden. Zwischen historischen Ereignissen und deren Deutung kann in den Evangelien durchaus unterschieden werden, Konturen der historischen Person Jesu lassen sich in den Entwürfen der Evangelien erkennen. Eine grundsätzliche Skepsis gegenüber einem historisch-kritisch erstellten Bild Jesu17 ist deshalb überzogen.18 Zu einem solchen Bild gehört wesentlich mehr als das, was Bultmann als historisch gesichert über das Wirken Jesu sagen zu können meinte.19
An dieser Stelle wird eine Tendenz erkennbar, die die Jesusforschung im Gefolge Bultmanns maßgeblich geprägt hat. Die Jesusdarstellungen dieser Phase, der sog. »neuen Frage nach dem historischen Jesus«, waren in der Regel auf seine »Verkündigung« konzentriert. Das »Eigentliche« seines Wirkens wurde also vornehmlich in seinen Worten und Gleichnissen gesehen, der historische und soziale Kontext dagegen eher beiläufig als »Rahmen« abgehandelt.20 Vorausgesetzt ist dabei die durchaus zutreffende Einsicht, dass den Evangelien Überlieferungen vorausliegen, die sie selbst in einen chronologischen und geographischen Rahmen gestellt haben. Dieser »Rahmen« ist allerdings keineswegs belanglos. Er vermittelt vielmehr wichtige Kenntnisse über die Zeit und die Regionen des Wirkens Jesu und bettet sein Wirken in konkrete soziale, kulturelle und religiöse Zusammenhänge ein. Er ist deshalb für eine Interpretation seines Auftretens unverzichtbar. Dagegen wäre es nicht einleuchtend, die Bedeutung Jesu auf seine »Verkündigung« zu reduzieren, diese ihren konkreten Zusammenhängen zu entheben und die konkreten Kontexte, die sein Wirken historisch erst verstehen lassen, an den Rand zu stellen.
Die mit den Namen von Strauß, Kähler, Bultmann und Johnson verbundene Linie der Jesusforschung formuliert also ein wichtiges Korrektiv gegen eine naive Gleichsetzung von historischer Forschung und vergangener Wirklichkeit: Die Bedeutung des Wirkens und Geschicks Jesu lässt sich nicht unabhängig von den Deutungen in den frühen Quellen erfassen. Historische Darstellungen müssen vielmehr verständlich machen, wie Deutung und historisches Ereignis aufeinander zu beziehen sind. Andererseits spricht die Einsicht in den »mythischen« oder »kerygmatischen« Charakter der Evangelien nicht gegen ihren Wert als historische Quellen. Der historische Kontext des Wirkens Jesu bleibt vielmehr durchaus erkennbar und erlaubt es, Konturen seines Auftretens nachzuzeichnen.
Ein dritter Aspekt der historischen Jesusforschung verbindet sich mit dem Namen von Albert Schweitzer (1875–1965). Schweitzer hatte die Abhängigkeit historischer Darstellungen von den Urteilen und Wertmaßstäben ihrer Verfasser innerhalb der Jesusforschung deutlich erkannt. In seiner »Geschichte der Leben-Jesu-Forschung« kritisierte er die Jesusdarstellungen der Forschung des 19. Jahrhunderts dafür, dass sie die Fremdheit Jesu nicht ernst genommen und ihn um den Preis der Bewahrung seiner Besonderheit in ihre eigene Zeit hineingeholt hätten, aus der er allerdings wieder in seine eigene Zeit zurückgekehrt sei.
Hatte Schweitzer damit zu Recht auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die in einer unreflektierten Aneignung der Vergangenheit liegt, so besitzt auch sein eigener Entwurf eine methodische Schwäche: Schweitzer wollte an die Stelle der geschichtlichen Erkenntnis, die der Vorläufigkeit unterworfen sei, das von wandelbaren historischen Urteilen unabhängige Fundament des christlichen Glaubens setzen.21 Dieses meinte er in der »Persönlichkeit« und dem »Willen« Jesu zu finden, die von dem Vorstellungsmaterial, in das sie gekleidet wurden, unabhängig seien.22 Damit steht Schweitzer in der Tradition eines Geschichtsbildes, das durch die Orientierung an großen Persönlichkeiten gekennzeichnet ist und sich auch schon vor ihm in der Jesusforschung bemerkbar gemacht hatte.23 Zugleich bereitete Schweitzer mit der Betonung des angeblich zeitlosen »Willens Jesu« eine Richtung vor, an die dann vor allem in der oben angesprochenen, auf die »Verkündigung« Jesu konzentrierten Richtung angeknüpft wurde.
Schweitzer geht es also, ähnlich wie Kähler und Bultmann, um ein sicheres Fundament, auf das sich der Zugang zu Jesus gründen kann. Gesucht wird dieses Fundament von allen drei Forschern jenseits wandelbarer historischer Urteile. Diese Vorstellung ist jedoch eine Illusion. Es kann bei der Beschäftigung mit Jesus nicht darum gehen, das »zeitlos Gültige« vom wandelbaren »Material«, in das es gekleidet wurde, absondern zu wollen. Das lässt sich unschwer an Schweitzer selbst zeigen: Seine Konzentration auf die vermeintlich zeitlose »Persönlichkeit« Jesu und seinen »Willen« sind dem Persönlichkeitsideal des 19. Jahrhunderts und einer bestimmten Sicht auf die »spätjüdische« Apokalyptik verpflichtet – und damit durchaus zeitbedingt, wenn auch auf andere Weise als die von ihm kritisierten Darstellungen. Christlicher Glaube kann nicht auf ein »unerschütterliches Fundament« oder eine »ewige Vernunftwahrheit« im Sinne Lessings gegründet werden. Er ist vielmehr stets von den geschichtlichen Entwicklungen und den damit verbundenen Veränderungen der Sicht auf die Vergangenheit betroffen; er ist der ständigen Prüfung an den Quellen unterworfen und kritischen Fragen nach der Plausibilität seiner Wirklichkeitsdeutung ausgesetzt. Genau darauf gründet die Stärke eines Glaubens, der sich solch kritischer Prüfung nicht verweigert. Nur ein intellektuell und ethisch verantworteter Glaube ist davor gefeit, sich in einen Sonderbereich zurückzuziehen und zur Ideologie zu werden. Nur ein solcher Glaube kann deshalb im offenen Diskurs über die Deutung der Wirklichkeit bestehen.
Schließlich ist ein Weiteres zu bedenken: Dass die Evangelien vor- und nachösterliche Überlieferungen miteinander verschmelzen, verleiht dem Unterfangen der kritischen Jesusforschung von vornherein eine Ambivalenz: Die Frage, welche Überlieferungen als authentisch, welche als spätere Deutungen, welche Facetten für ein Bild von Jesus als besonders markant und charakteristisch, welche als eher belanglos beurteilt werden, hängt immer auch von dem vorausgesetzten Gesamtbild vom Wirken Jesu und seinem historischen Kontext ab.
Die Vielfalt der Jesusbilder in der neueren Forschung liefert dafür einen eindrücklichen Beleg. Die Differenzen entstehen nicht – jedenfalls nicht in erster Linie – dadurch, dass mit verschiedenen historischen Materialien gearbeitet würde, sondern durch die jeweils vorausgesetzten Annahmen über historische Plausibilitäten. So hält etwa Ed Parish Sanders die jüdische »Restaurationseschatologie« (»restoration eschatology«) für denjenigen Kontext, innerhalb dessen die Wirksamkeit Jesu interpretiert werden müsse. Dabei hält er die Erzählung von der Tempelaustreibung für den sichersten Ausgangspunkt einer Untersuchung des Wirken Jesu und beginnt seine Darstellung mit deren Analyse.24
Für Richard A. Horsley sind dagegen die sozialen Verhältnisse im Palästina des 1. Jahrhunderts der maßgebliche Kontext, um das Wirken Jesu zu interpretieren. Anders als bei Sanders wird die Wirksamkeit Jesu deshalb wesentlich stärker im Blick auf ihre politischen und sozialen Implikationen hin befragt. Jesus wollte die Gottesherrschaft als neue Ordnung, die sich gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit richtet, bereits gegenwärtig erfahrbar machen und nicht, wie Sanders meint, auf die zukünftige, von Gott selbst heraufgeführte Ordnung verweisen.25
Lassen sich für verschiedene Einordnungen Jesu in sein historisches Umfeld Argumente anführen, so bedeutet das nicht, dass die Darstellungen dadurch beliebig würden. Es zeigt jedoch, dass sich die historisch-kritische Jesusforschung in einem gewissen »Unschärfebereich« bewegt, da sie es als historisches Unternehmen mit Quellen zu tun hat, die kein eindeutiges Bild der Vergangenheit vermitteln. Ihr Ziel kann deshalb nicht das Erreichen des einen Jesus hinter den Texten sein, sondern ein auf Abwägen von Plausibilitäten gegründeter Entwurf, der sich als Abstraktion von den Quellen stets vor diesen bewegt.
Für diesen geschichtshermeneutischen Zugang wurde der Begriff der »Erinnerung« in die Jesusforschung eingeführt.26 Damit ist nicht die individuelle Aufbewahrung von Inhalten des Wirkens und der Lehre Jesu im Gedächtnis seiner Nachfolger gemeint,27 sondern die Aneignung der Vergangenheit aus der Perspektive der jeweiligen Gegenwart. Dieser Zugang knüpft an ein Verständnis des Erinnerungsbegriffs an, das Jan Assmann im Anschluss an Maurice Halbwachs entwickelt hat.28 Assmann geht – wie auch Halbwachs – von der sozialen, kollektiven Dimension des Gedächtnisses aus, in dem diejenigen Traditionen aufbewahrt werden, die für das Selbstverständnis einer Gemeinschaft grundlegend sind. Zu dieser Form des Gedächtnisses gehört deshalb immer auch die Aktualisierung und Inszenierung von Traditionen im Leben von Gemeinschaften – etwa durch Erzählungen, Rituale, Gedenktage und dergleichen. Für das Judentum ist in diesem Sinn etwa die Exoduserzählung eine Tradition, die im Gedächtnis des jüdischen Volkes aufbewahrt, gelesen und bei der Passahfeier rituell inszeniert wird. In der Christentumsgeschichte lässt sich dem die Feier des Abendmahls vergleichen, die an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern in Jerusalem anknüpft und Jesus in der mahlfeiernden Gemeinde vergegenwärtigt. »Erinnerung« bezeichnet diesem Verständnis zufolge den Rückgriff auf für bedeutsam gehaltene Vergangenheit, die in Erzählungen, Ritualen, Festen und anderen Formen angeeignet und vergegenwärtigt wird.
Die kritische Prüfung des historischen Materials wird damit in keiner Weise überflüssig. Die Aneignung der Vergangenheit wird sich vielmehr auf solche Zeugnisse stützen, die kritischer Analyse als verlässlich erscheinen. Ein am Erinnerungsbegriff orientierter Zugang zur Vergangenheit – und damit auch zur Jesusüberlieferung – ist sich aber dessen bewusst, dass die Zeugnisse der Vergangenheit die für die Gegenwart bedeutsame Geschichte nicht unmittelbar enthalten. Diese muss vielmehr erst durch eine auf kritischer Analyse und kreativer Einbildungskraft basierende Erzählung aus ihnen geschaffen werden. Die Aneignung der Vergangenheit ist demzufolge ein Prozess, bei dem die historischen Quellen aus der Perspektive der Gegenwart gedeutet und zu einem Bild zusammengefügt werden, das dem jeweiligen Erkenntnisstand und den Voraussetzungen, mit denen wir die Quellen interpretieren, entspricht. Die historische Erzählung gründet dabei auf den Zeugnissen der Vergangenheit und wird sich durch sie korrigieren lassen. Sie ist zugleich ein Produkt historischer Einbildungskraft, die aus den Zeugnissen der Vergangenheit lebendige, bedeutsame Geschichte erschafft.29
Für die Frage nach dem historischen Jesus ist diese geschichtshermeneutische Perspektive von großer Bedeutung. Die aktuelle Jesusforschung steht der Auffassung, nicht der »historische Jesus«, sondern nur der »geglaubte Christus« sei für den christlichen Glauben von Bedeutung, skeptisch gegenüber. Sie fasst die Jesusforschung stattdessen primär als geschichtswissenschaftliche Unternehmung auf, die auf der Grundlage kritischer Analyse des historischen Materials ein Bild Jesu in seinem historischen Kontext zeichnet. Die Jesusforschung der Gegenwart ist zugleich dadurch charakterisiert, dass sie die zur Verfügung stehenden Quellen in umfassender Weise für die Beschreibung des historischen Kontextes Jesu heranzieht. Dies macht eine geschichtshermeneutische Reflexion notwendig, die zu Bewusstsein bringt, dass der »historische Jesus« nicht der »wirkliche Jesus« hinter den Quellen ist, sondern ein Produkt, das auf historisch-kritischer Quellenanalyse und historischer Einbildungskraft beruht. Jesusbilder – auch historisch-kritische – sind deshalb vielfältig, selektiv und revidierbar. Gerade darin haben sie ihre Bedeutung für die Rezeption Jesu in der jeweiligen Gegenwart.
Fassen wir diesen Überblick zusammen, so zeigt sich: Die Jesusforschung seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat wichtige methodische und inhaltliche Voraussetzungen für eine Beschäftigung mit Jesus unter den Bedingungen des neuzeitlichen historisch-kritischen Bewusstseins geschaffen. Sie bewegt sich dabei in der Spannung von historischer Rekonstruktion, die wissen will, wie es »wirklich« war, und nachösterlicher Konstruktion, die dies für unerreichbar hält und sich stattdessen an den nachösterlichen Glaubenszeugnissen orientiert. Bei beiden Optionen handelt es sich um Radikallösungen, die für sich genommen unzureichend sind. Gemeinsam verleihen sie der neuzeitlichen Jesusforschung jedoch eine Dynamik, die sich als äußerst fruchtbar erweist: Die Beschäftigung mit den Quellen stellt ein Bild der Vergangenheit vor Augen, das als Produkt der Gegenwart jedoch immer veränderlich, fehlbar und unvollständig bleibt. Historische Jesusforschung kann deshalb den christlichen Glauben niemals begründen oder gar seine Richtigkeit beweisen. Sie kann jedoch zeigen, dass dieser Glaube auf dem Wirken und Geschick einer Person gründet, das sich, wenn auch nicht in jedem Detail, so jedoch in wichtigen Facetten auch heute noch nachzeichnen lässt. Damit leistet sie für die Verantwortung des christlichen Glaubens in der modernen Welt einen substantiellen Beitrag.