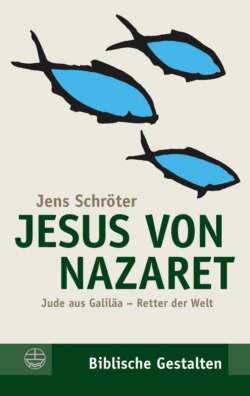Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.1 Die Schriften des Neuen Testaments
ОглавлениеZu den Quellen, die Aufschluss über den historischen Jesus geben, gehören diejenigen Zeugnisse, die historisch auswertbare Informationen aufbewahrt haben und nicht ihrerseits von älteren Quellen abhängig sind. Spätere Zeugnisse malen das Leben Jesu dagegen häufig legendarisch aus und gehören deshalb in die Wirkungsgeschichte der ältesten Quellen. Sie spiegeln Konstellationen späterer Phasen der Christentumsgeschichte wider, etliche sind zudem Ausdruck christlicher Frömmigkeit, die die Person Jesu in Legenden, bildlichen Darstellungen und rituellen Vollzügen zur Anschauung bringt.35 Diese Zeugnisse, von denen einige in Teil C dieses Buches besprochen werden, können im vorliegenden Abschnitt, der sich auf die historisch auswertbaren Informationen konzentriert, übergangen werden.
Die Jesusüberlieferung wurde in ihren Anfängen mündlich weitergegeben. Dieser Prozess, der aller Wahrscheinlichkeit nach bereits während der Wirksamkeit Jesu einsetzte, hat ihren Charakter grundlegend geprägt. Als ursprünglich mündliche Überlieferung behielt sie ihre Variabilität bei der je konkreten sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung auch während und nach ihren ersten Verschriftlichungen. Das wird sofort deutlich, wenn man verschiedene Versionen eines Wortes, eines Gleichnisses oder einer Episode aus dem Leben Jesu nebeneinander stellt. Dass diese Flexibilität auch in der schriftlichen Jesusüberlieferung erhalten blieb, kann an ihrer Verarbeitung in frühchristlichen Schriften sowie an der Textüberlieferung unschwer abgelesen werden.36 Nimmt man hinzu, dass Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Griechisch gesprochen hat – die Sprache aller Autoren des Neuen Testaments –, sondern Aramäisch, dann wird deutlich, dass bereits die älteste zugängliche Überlieferung sprachlich wie inhaltlich ein ganzes Stück von Jesus entfernt ist: Sie ist durch einen Prozess mündlicher Überlieferung und inhaltlicher Deutung hindurchgegangen und in eine andere Sprache übersetzt worden; sie wurde in bestimmte Formen gefasst – etwa in Spruchgruppen, Heilungserzählungen oder kleine Episoden über Berufungen und Streitgespräche –; sie wurde in Erzählungen mit je eigenem sprachlichen und inhaltlichen Profil integriert; sie wurde in Texten überliefert, von denen verschiedene, voneinander abweichende Manuskripte existieren, deren älteste bis ins 2. Jahrhundert zurückreichen. Auf der Grundlage dieser Quellen können wir aus heutiger Perspektive Bilder von Jesus zeichnen, die von unseren Kenntnissen über diese Quellen abhängig, von der Person, auf die sich diese Quellen beziehen, jedoch zu unterscheiden sind.
Die ältesten Texte, aus denen wir etwas über Jesus erfahren, sind die Briefe des Paulus. Paulus geht es zwar nur am Rande darum, Biographisches über das Wirken Jesu zu berichten, dennoch finden sich in seinen Briefen Spuren früher Überlieferungen.37 Dazu gehört zunächst die Notiz über »die Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde«, mit der Paulus seinen Bericht von der Einsetzung des Herrenmahls in 1Kor 11,23–25 beginnt. Dazu gehört auch die Erwähnung der davidischen Herkunft Jesu (Röm 1,3), auf die noch zurückzukommen ist.38 In beiden Fällen zitiert Paulus Überlieferungen, die in eine frühe Zeit zurückreichen.
An einigen Stellen bezieht sich Paulus im Zusammenhang von Anweisungen, die er erteilt, ausdrücklich auf ein »Wort des Herrn«. Neben den gerade genannten Einsetzungsworten des Herrenmahls gehören hierzu das Verbot der Trennung von Mann und Frau (1Kor 7,10 f.) sowie die Anordnung, dass die, die das Evangelium verkünden, auch von ihm leben sollen (1Kor 9,14). Auch in 1Thess 4,15 spricht Paulus »in einem Wort des Herrn«, allerdings zitiert er dort kein Jesuswort, sondern beruft sich auf die Autorität Jesu. An anderen Stellen weisen die Formulierungen des Paulus Berührungen mit den synoptischen Evangelien auf, ohne dass er sich dabei ausdrücklich auf Jesus oder den »Herrn« berufen würde.
Das Wort vom Dieb in der Nacht in 1Thess 5,2 (vgl. auch 2Petr 3,10 sowie Offb 3,3; 16,15) begegnet in analoger Weise in Lk 12,39/Mt 24,43 sowie in Ev Thom 21,5–7. Hier wird die Metapher vom Dieb in einem Bildwort Jesu verwendet. Der Kontext ist in allen Fällen die Aufforderung zur Wachsamkeit angesichts des unbekannten Zeitpunktes des Kommens Jesu zum Gericht.
Die Aufforderung zum Friedenhalten in 1Thess 5,13 (vgl. Röm 12,18) wird in Mk 9,50 (vgl. Mt 5,9) als Gebot Jesu angeführt.
Zur Aufforderung in 1Thess 5,15/Röm 12,17, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sowie zur hiermit nahe verwandten Mahnung in Röm 12,14, die Verfolger zu segnen und nicht zu verfluchen, finden sich Analogien in der Feldrede bzw. Bergpredigt (Lk 6,28/Mt 5,44) sowie in 1Petr 3,9. Es handelt sich um einen Topos urchristlicher Paränese, der sowohl in den synoptischen Evangelien als auch in der Briefliteratur rezipiert wurde.
Das Wort über das Wohlverhalten gegenüber dem Feind in Röm 12,20, bei Paulus ein Zitat aus Spr 25,21, begegnet in der synoptischen Überlieferung als Feindesliebegebot Jesu (Lk 6,27.35/Mt 5,44).
Zum Topos in Röm 14,14, dass nichts von sich aus unrein ist, ist das Jesuswort in Mk 7,15/Mt 15,11 zu vergleichen: »Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen.«
Das Wort über den Berge versetzenden Glauben in 1Kor 13,2 besitzt Analogien in Mk 11,22f./Mt 17,20 (vgl. auch Lk 17,6 sowie in Ev Thom 48 und 106).
Die Stellen zeigen, dass bereits vor der Entstehung der Evangelien ein Überlieferungsbereich existierte, in dem die Lehre Jesu, gemeinsam mit anderen Überlieferungen, im Urchristentum weitergegeben wurde. Die Unterscheidung von »echten« Jesusworten und anderen, nicht auf Jesus zurückgehenden Überlieferungen spielte dabei keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr, dass die urchristliche Unterweisung insgesamt als durch den Herrn autorisiert angesehen wurde. Das gilt auch für Paulus, wie vor allem solche Formulierungen belegen, in denen er auf die Autorität des Herrn bzw. Jesu verweist, ohne dabei ein Jesuswort zu zitieren.39
Der irdische Jesus ist demnach als derjenige von Bedeutung, der zugleich der auferweckte und zu Gott erhöhte Herr ist.
Die für die historische Jesusfrage wichtigsten Schriften innerhalb des Neuen Testaments sind die Evangelien. Diese entstanden einige Jahrzehnte nach der Wirksamkeit Jesu und halten die Erinnerung an sein Wirken und Geschick nunmehr in Form von Erzählungen fest. Sie verarbeiten hierzu sowohl die Lehre des Urchristentums wie auch biographische Traditionen über seine Herkunft, Orte und Personen seines Wirkungskreises sowie die Umstände seines Todes. Innerhalb des Überlieferungsprozesses gibt es demnach eine Kontinuität der Erinnerung an Jesus, durch die zentrale Aspekte seiner Wirksamkeit festgehalten wurden. Dabei lassen sich bestimmte Formen erkennen, in denen die Jesusüberlieferung bereits vor der Entstehung der schriftlichen Erzählungen weitergegeben wurde. In Chrien (bzw. Apophthegmen), knappen Szenen mit einem Ausspruch oder einer Tat als Pointe, werden Worte und Handlungen Jesu,40 in Heilungserzählungen seine außergewöhnlichen Taten, in Sentenzen und Gleichnissen seine Lehren überliefert.
Die Evangelien erzählen das Wirken und Geschick Jesu allerdings nicht in einer Anordnung, die der historischen Darstellung zugrunde gelegt werden könnte. Sie ordnen die Überlieferungen vielmehr oftmals unter formalen Aspekten – etwa dadurch, dass sie Gleichnisse, Streitgespräche oder Heilungen zusammenstellen –, entwerfen Szenen des Lehrens Jesu – etwa am See Gennesaret, auf einem Berg oder bei einem Mahl – und geben dem geographischen Aufriss durch die Gegenüberstellung von Galiläa und Jerusalem eine symbolische Bedeutung. Die Einzelereignisse, etwa Gleichnisse und Machttaten Jesu, seine Berufungen von Nachfolgern oder die Kontroversen mit Gegnern, erhalten ihre Bedeutung demnach innerhalb der von den Verfassern der Evangelien entworfenen Jesuserzählungen.
Man kann sich das an einem Beispiel verdeutlichen: Das Gleichnis vom großen Gastmahl wird bei Lukas von Jesus anlässlich der Einladung zu einem Essen im Haus eines Pharisäers erzählt und ist mit dieser Situation eng verknüpft: Jesus fordert den Gastgeber auf, zu einem Essen nicht diejenigen einzuladen, von denen man eine Gegeneinladung erhofft, sondern die Armen, Krüppel, Lahmen und Blinden. Diese Aufforderung wird anschließend durch das Gleichnis illustriert (Lk 14,12–24). Auch Matthäus erzählt eine Version dieses Gleichnisses (Mt 22,1–14). Bei ihm ist es jedoch Bestandteil einer längeren Rede, bestehend aus drei Gleichnissen (Mt 21,28–22,14), die Jesus anlässlich seiner Auseinandersetzung mit den Hohenpriestern und Ältesten im Jerusalemer Tempel hält und die ein gemeinsames Thema entfalten: »Die Erstadressaten haben versagt und werden durch eine andere Gruppe ersetzt«. Das Gleichnis wird also auf jeweils eigene Weise in die Deutungen des Wirkens Jesu bei Lukas und Matthäus integriert. Einmal dient es der Anweisung zum rechten Verhalten gegenüber den Bedürftigen, einmal ist es eine Warnung an die Führer Israels und auch an die christliche Gemeinde, dem Ruf zur Umkehr im konkreten Verhalten Folge zu leisten. Bei welcher Gelegenheit Jesus selbst ein derartiges Gleichnis erzählt hat, wie genau es gelautet hat und wer seine ursprünglichen Adressaten waren, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Die Bedeutung des Gleichnisses für eine historische Jesusdarstellung kann deshalb nur durch eine Analyse der literarischen Verarbeitungen in den Evangelien erhoben werden.
Des Weiteren werden Wirken und Geschick Jesu im Licht der Ostererfahrung gedeutet, die ihm einen neuen Sinn verleiht. Dieser geht über sein irdisches Wirken hinaus und stellt es in ein neues Licht. Bei der Auswertung der Evangelien für die historische Jesusfrage ist also zu bedenken, dass sie den Glauben an Jesus als Sohn Gottes bezeugen wollen und sein irdisches Wirken in diesem Licht darstellen. Am deutlichsten ist dies im JohEv, wo mehrfach auf die neue Einsicht hingewiesen wird, die die Ostererfahrung und der damit verbundene Geist in die Bedeutung Jesu vermittelt haben.41
Auch hierfür ein Beispiel: Bei der Erzählung von der Speisung der 5000 in Mk 6 begegnet die Wendung: »Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern …« (V.41). Wenn später beim letzten Mahl in Jerusalem eine ganz ähnliche Formulierung gebraucht wird (Mk 14,22), dann wird deutlich: Die Mähler, die Jesus mit den Menschen feiert, weisen bereits voraus auf das letzte Mahl, bei dem er sein Wirken noch einmal zusammenfassend deutet. Dass das gesamte Wirken Jesu unter das Vorzeichen seiner Gottessohnschaft gestellt wird, machen die Anfänge der Evangelien deutlich: die Schilderung seiner wunderbaren Geburt bei Matthäus und Lukas, der Prolog über den göttlichen Logos bei Johannes, die Annahme zum Sohn Gottes in der Taufe bei Markus.42
In den Evangelien wird die Bedeutung Jesu demnach so entfaltet, dass bei der Erzählung von seinem irdischen Wirken und Geschick vorösterliche Ereignisse und nachösterlicher Glaube miteinander verschmolzen werden. Das ist bei ihrer Auswertung für die historische Jesusfrage zu berücksichtigen. Es ändert aber nichts daran, dass wir hier auf wichtige Informationen für ein historisches Profil der Person Jesu stoßen. Die Evangelien enthalten sogar die entscheidenden Angaben über den geographischen, religiösen und kulturellen Kontext des Auftretens Jesu, die Personen in seinem Umfeld, zentrale Inhalte seines Wirkens und die Umstände seines Todes. Sie sind deshalb für ein historisches Jesusbild unverzichtbar.
Die kritische Forschung des ausgehenden 18. sowie des 19. Jahrhunderts hat über das Genannte hinaus zu zwei wichtigen Ergebnissen geführt, die das Verhältnis der Evangelien untereinander betreffen: Sie konnte zeigen, dass zwischen den drei ersten Evangelien Matthäus, Markus und Lukas auf der einen und dem JohEv auf der anderen Seite deutliche Differenzen bestehen sowie dass die drei ersten, die »synoptischen« Evangelien literarisch miteinander zusammenhängen. Als Lösung der Frage, wie dies genauer vorzustellen ist (der sog. »synoptischen Frage«), kristallisierte sich als weithin akzeptierte Lösung heraus, dass das MkEv das älteste ist und Matthäus und Lukas als Vorlage diente. Wie der von ihnen benutzte Text des MkEv genau ausgesehen hat, kann dabei nur noch annäherungsweise bestimmt werden.43 Es spricht jedenfalls einiges dafür, dass Matthäus und Lukas verschiedene Versionen des MkEv benutzt haben und dass die durch die erhaltenen Manuskripte bezeugten, späteren Fassungen hiervon noch einmal zu unterscheiden sind.44
In zeitlicher Hinsicht bewegen wir uns bei den Evangelien etwa zwischen dem Jahr 70 und dem Ende des 1. Jahrhunderts. Im MkEv spiegeln sich vermutlich die Ereignisse des jüdisch-römischen Krieges in den Jahren 66–70 wider, Mt und Lk sind etwas später anzusetzen. Damit ist deutlich: Die Evangelien haben ältere Überlieferungen verarbeitet, sind selbst aber erst einige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu verfasst worden. Sie blicken aus einer veränderten politischen Situation auf Wirken und Geschick Jesu zurück und setzen eine Entwicklung voraus, in der sich die Jesusbewegung der Heidenmission geöffnet und deutlicher gegenüber dem Judentum profiliert hat.
Aus diesem Befund ergibt sich zudem, dass Matthäus und Lukas Zugang zu weiteren Überlieferungen hatten, die ihnen zum Teil in schriftlicher Form vorgelegen haben. Das zeigt sich daran, dass sie etliche Überlieferungen über Markus hinaus gemeinsam haben, die mitunter deutliche Übereinstimmungen im Wortlaut aufweisen. Bereits im 19. Jahrhundert wurde hieraus auf die Existenz einer zweiten Quelle neben Mk geschlossen, die von Mt und Lk benutzt, danach aber nicht mehr selbständig überliefert worden sei. Diese vermutete Quelle, für die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Abkürzung »Q« eingebürgert hat, wird allerdings nirgendwo explizit erwähnt.45 Ihre Existenz, die ohnehin nur von kurzer Dauer gewesen sein könnte, bleibt deshalb eine Hypothese.
Um diese vermutete Quelle hat es in den zurückliegenden Jahren eine intensive Diskussion gegeben. Es wurde versucht, ihr inhaltliches Profil genauer zu erfassen und sogar ihren Wortlaut zu rekonstruieren.46
Da jedoch kein Manuskript überliefert ist, bleiben die Mutmaßungen über ihren Umfang, ihren Inhalt und ihr literarisches Profil – letztlich auch ihre Existenz – hypothetisch. Thesen wie etwa, es handle sich um eine Quelle, deren Jesusbild von denjenigen der synoptischen Evangelien deutlich abweiche und sich stattdessen mit demjenigen des Thomasevangeliums berühre, sind schon deshalb unwahrscheinlich, weil die zu Q gerechneten Sprüche und Reden Jesu in das MtEv und das LkEv eingearbeitet wurden und sich zudem im gemeinsamen Nicht-Mk-Stoff von Mt und Lk sowohl narrative Überlieferungen als auch Worttraditionen finden. Das Ev Thom ist dagegen eine Zusammenstellung verschiedener Worte, Gleichnisse, Dialoge und kurzer Erzählsequenzen, aus verschiedenen Überlieferungsbereichen. Sie werden im Ev Thom als »verborgene Worte des lebendigen Jesus« präsentiert und häufig separat mit »Jesus spricht« bzw. »Jesus sprach« eingeleitet. Das Ev Thom ist demnach von den Q-Stoffen, die zum Bereich der synoptischen Überlieferung gehören und sich auf dem Weg zu einer narrativen Darstellung des Wirkens und Geschicks Jesu befinden, gänzlich verschieden.
Auch wenn also über Umfang, literarisches Profil und oftmals auch über den genauen Wortlaut der zu Q gerechneten Überlieferungen keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden können, gehören diese Stoffe zu den wichtigsten Zeugnissen der ältesten Jesusüberlieferung. Es handelt sich um Texte, zu denen Mt und Lk offenbar unabhängig voneinander Zugang hatten, zu denen auch Parallelen bei Mk gehören und die das Bild der ältesten Jesusüberlieferung in wesentlicher Weise profilieren.
Insbesondere bei denjenigen Texten, die sowohl bei Mk als auch in Q überliefert sind, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um sehr frühe Überlieferungen.47 Hierzu gehören z. B. die Ankündigung Jesu durch Johannes, die Beelzebulkontroverse, die Aussendungsrede, das Senfkorngleichnis und die Aufforderung zur Kreuzesnachfolge. Prinzipiell können natürlich auch solche Texte sehr alt sein, die nur in einem Evangelium oder in einem außerkanonischen Text wie dem Ev Thom überliefert sind. Die bei Mk und Q begegnenden Überlieferungen, die nach der hier skizzierten und heute zumeist vorausgesetzten Lösung der synoptischen Frage an den Anfängen der Verschriftlichung der Jesusüberlieferung bereits vorgelegen haben, bilden jedoch insofern eine erste Orientierung, als sich ein Bild des historischen Jesus kaum gegen diesen frühen Bestand entwerfen lässt.
Im JohEv begegnet ein von den synoptischen Evangelien deutlich abweichendes Jesusbild. Der Weg Jesu beginnt hier unmittelbar bei Gott, von woher er dann in die Welt kommt, um Gott zu offenbaren. Aufgrund dieser göttlichen Herkunft, die im JohEv durchgehend präsent ist, kann die Welt Jesus auch nur scheinbar etwas anhaben.48 Selbst in der Passionsgeschichte bleibt Jesus souverän. Das JohEv ist also in besonderer Weise daran interessiert, die Göttlichkeit Jesu zu betonen – vermutlich weil diese strittig war. Trotz dieses starken Hervortretens der theologischen Deutung des Wesens Jesu hat auch Johannes Überlieferungen bewahrt, die für die historische Untersuchung von Interesse sind. Hierzu gehören vor allem eigene Verarbeitungen der Worte Jesu,49 Details von Orten und Ereignissen der Passionsgeschichte. Auch dass Johannes als einziger von einer Tauftätigkeit Jesu und mehreren Aufenthalten in Jerusalem berichtet, verdient Beachtung.