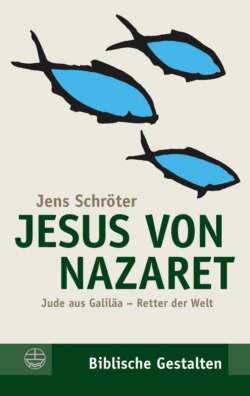Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. EINFÜHRUNG 1. DER »HISTORISCHE« UND DER »ERINNERTE« JESUS ODER: WIE ES »WIRKLICH« WAR
ОглавлениеJesus von Nazaret hat für unseren Kulturkreis eine einzigartige Bedeutung. Keine andere Person hat eine ähnliche Wirkung hervorgerufen und die europäische Geschichte in einer vergleichbaren Weise geprägt. Die christliche Prägung der griechisch-römischen Spätantike, das Gegenüber von Papst und Kaiser im Mittelalter, die Kreuzzüge, die reformatorischen Aufbrüche im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, die Deklaration der Menschenrechte sowie die Verfassungen zahlreicher Staaten des europäischen und nordamerikanischen Kulturraums – um nur einiges zu nennen – sind geschichtliche Wirkungen derjenigen Religion, in deren Zentrum das Bekenntnis zu Jesus Christus steht. Die Spuren der Beschäftigung mit Jesus in Musik und Dichtung, Film und Malerei, Philosophie und Geschichtsschreibung – bis hin zur Zeitrechnung post Christum natum1 – zeugen von der einzigartigen Faszination, die von ihm seit etwa zweitausend Jahren ausgeht. Viele Menschen haben sich in ihren Lebensentwürfen an seiner Lehre ausgerichtet. Die Bergpredigt diente zu allen Zeiten, bis in die jüngste Vergangenheit, immer wieder als kritischer Maßstab – nicht nur innerhalb der christlichen Kirchen.2 Die Seligpreisungen, das Gebot der Feindesliebe und das Vaterunser sind auch dem Christentum fernstehenden Menschen als zentrale Inhalte der Verkündigung Jesu bekannt.
Auch der Leidensweg Jesu hat zu allen Zeiten eindrucksvolle Darstellungen gefunden – man denke nur an die Passionsmusiken Johann Sebastian Bachs oder den Isenheimer Altar von Mathias Grünewald (vgl. dazu Teil C. 4) – und sogar zur imitatio seiner Schmerzen inspiriert. Bis in die Gegenwart und die Alltagskultur hinein finden sich von der Leidensgeschichte Jesu angeregte Motive – wie z. B. auf dem Plakat, mit dem das Deutsche Rote Kreuz vor einigen Jahren für Blutspenden warb und das auf die neutestamentlichen Abendmahlsworte anspielt (Anhang, Abbildung 1). Wir kommen auf die Wirkungen Jesu im dritten Teil dieses Buches zurück. Zuvor ist aber ein Weg zurückzulegen, der uns in die Zeit führen wird, in der der Wanderprediger Jesus von Nazaret in Galiläa und Jerusalem auftrat. Die Wirkungen, die von ihm ausgegangen sind, können ohne eine Beschäftigung mit diesen Ursprüngen nicht verstanden werden – auch wenn sie darin nicht aufgehen, sondern oftmals kreative Weiterentwicklungen darstellen, die von der prägenden Kraft der Gestalt Jesu zeugen.
In den zurückliegenden Jahrzehnten ist die Diskussion darüber, wer Jesus »wirklich« war, neu entbrannt. Zahlreiche seither erschienene Jesusbücher haben unterschiedliche Bilder seiner Person gezeichnet. Jesus erscheint als Sozialrevolutionär, der sich für die Armen und Unterdrückten einsetzt, als Prophet, der das baldige Hereinbrechen des Gottesreiches ankündigt, als Weisheitslehrer, der eine radikale Ethik verkündet oder als Charismatiker, der eine neue Gemeinschaft gründet, die sich von den überkommenen gesellschaftlichen Normen kritisch absetzt. In der folgenden Darstellung wird deutlich werden, wie diese Entwürfe nach der hier vorgelegten Sicht zu beurteilen sind. An dieser Stelle ist dagegen zunächst festzuhalten, dass die neue internationale und konfessionsübergreifende Jesusforschung auf eindrückliche Weise die Bedeutung der Frage nach Jesus für die christliche Theologie und darüber hinaus ins Bewusstsein gerufen hat.
Wie konnte Jesus eine derartige Bedeutung erlangen und zum Zentrum einer eigenen Religion werden? Die Zeugnisse der frühen Christenheit geben hierauf eine eindeutige Antwort. Die Einzigartigkeit Jesu besteht darin, dass in seiner Person Gott und Mensch unmittelbar miteinander in Verbindung treten. Durch das Wirken Jesu wird die Herrschaft Gottes auf der Erde aufgerichtet, Jesus ist »Bild«, »Abdruck« oder »Wort« Gottes. Er gehört auf die Seite Gottes, ist derjenige, durch den Gott in der Welt erschienen ist und an dem er in einzigartiger Weise gehandelt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Glaube an Jesus Christus ist deshalb nach christlicher Überzeugung der einzige Weg zum Heil Gottes, der Mitvollzug seines Weges von Tod und Auferweckung vermittelt neues Leben. Das bedeutet zugleich, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus dasjenige zum Gott Israels voraussetzt und umfasst. Drei Texte des Neuen Testaments, die diese Überzeugung auf je eigene Weise zum Ausdruck bringen, seien genannt.
1) Das Johannesevangelium spricht in besonders intensiver Weise von der engen Beziehung zwischen Jesus und Gott. Der eigentlich unsichtbare Gott wird durch Jesus bekannt gemacht (Joh 1,18); Jesus und der Vater sind eins (Joh 10,30); wer Jesus, den Sohn, sieht, der sieht zugleich Gott, den Vater (Joh 14,9). Jesus wird deshalb als das »Wort« bezeichnet, das schon vor der Erschaffung der Welt bei Gott war. Andere Schriften des Neuen Testaments nennen Jesus in ähnlicher Weise »Bild«, »Erstgeborener« oder »Abglanz« Gottes und bringen damit seine enge Verbindung mit Gott zum Ausdruck.3 Jesus ist demnach von allen anderen Menschen unterschieden. Er gehört auf die Seite Gottes und ist zugleich derjenige, der ihn unter den Menschen repräsentiert. Diese einzigartige Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus ist das Zentrum des christlichen Glaubens.
2) In Lk 12,8 f. (par. Mt 10,32 f.) heißt es: »Jeder der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes.«
Hier wird eine Gerichtsszenerie entworfen: Am Ende der Zeit steht man vor Gott und seinen Engeln, Jesus, der Menschensohn, kann für einen eintreten oder auch nicht. Es hängt vom eigenen Bekenntnis zu Jesus vor den Menschen ab, ob er dies tut und man gerettet wird, oder ob man zu den Verurteilten gehört, weil man Jesus im irdischen Leben verleugnet hat. Der Text bringt demnach zum Ausdruck, dass mit der Stellung zu Jesus zugleich diejenige zu Gott auf dem Spiel steht und damit die Entscheidung über Leben und Tod, Heil und Unheil fällt.
3) In 2Kor 5,14 f. schreibt Paulus: »Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Und er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde.«
Paulus überträgt hier das Geschick Jesu Christi auf die Glaubenden: Sie sind ihrem alten Leben »gestorben« und haben jetzt Anteil am neuen Leben des auferweckten Jesus und sind durch die Zugehörigkeit zu ihm zu einer »neuen Schöpfung« geworden (V. 17). Tod und Auferweckung Jesu Christi werden also als ein Ereignis verstanden, an dem die Menschen teilhaben können und das ihnen die Möglichkeit eines neuen Lebens eröffnet. Der Text macht somit deutlich, dass die Zugehörigkeit zu Jesus Christus konkrete Folgen für das eigene Leben hat. Nach der Auffassung des Paulus wie auch aller anderen Autoren des Neuen Testaments muss der Glaube im Leben Gestalt gewinnen und zur Anschauung gebracht werden. Deshalb findet sich im Neuen Testament immer wieder die Aufforderung zu einem Leben, das dem Glauben an Jesus Christus entspricht. Die Evangelien beziehen sich dazu unmittelbar auf die Lehre Jesu selbst, etwa auf seine Auslegung der Tora.
Die enge Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus, die in den genannten Texten zum Ausdruck kommt – er ist »Wort Gottes«, himmlischer Fürsprecher im letzten Gericht, Vermittler neuen Lebens –, wurde in den frühen Bekenntnissen des Christentums – dem Apostolikum, dem Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, dem Chalcedonense – in je eigener Weise festgehalten. Sie war für das Christentum, ungeachtet konfessioneller Unterschiede, lange Zeit die unhinterfragte Glaubensgrundlage. Erst dem neuzeitlichen Bewusstsein wurde die Vorstellung, Jesus sei in gleicher Weise Gott und Mensch gewesen, zum Problem. Die Aufklärung bestimmte die menschliche Vernunft zum kritischen Maßstab, der auch an die biblischen Schriften anzulegen sei. Das führte zur Unterscheidung von rational nachprüfbaren Berichten und »Mythen«, die vergangene Ereignisse deuten, von diesen selbst aber zu unterscheiden sind. Das im 19. Jahrhundert entstehende historische Bewusstsein machte zusätzlich den Abstand deutlich, der zwischen der Welt des Neuen Testaments und der eigenen Zeit liegt. Der Zugang zur Vergangenheit wurde in der Konsequenz an methodisch kontrollierte Quellenforschung gebunden, die zu einem möglichst vorurteilsfreien Geschichtsbild führen sollte.
Aufklärung und historisch-kritische Geschichtswissenschaft nötigten demnach zu neuem Nachdenken über das Verhältnis von göttlicher und menschlicher Natur in Jesus Christus. Sicher erschien nunmehr nur, dass Jesus Mensch war, die Einheit von Gott und Mensch in seiner Person konnte dagegen nicht länger als unproblematisch vorausgesetzt werden. Das Interesse konzentrierte sich in der Folge darauf, was mit den Mitteln historischer Forschung über sein Wirken und Geschick herauszufinden ist. Damit war die Frage nach dem »historischen Jesus« geboren. Sie fragt nach Jesus, ohne dabei das Bekenntnis zu seiner Göttlichkeit vorauszusetzen. Die oben genannte, in seiner göttlichen Natur begründete Einzigartigkeit war damit in Frage gestellt. Lassen sich, so wurde nunmehr gefragt, die Erkenntnisse über den Menschen Jesus mit dem Bekenntnis seiner Göttlichkeit, lässt sich der »historische Jesus« mit dem »geglaubten Christus« vereinbaren? Die historische Jesusforschung gibt auf diese Frage zwei Antworten.
Die erste Antwort besagt: Zwischen den Resultaten historischer Forschung und Glaubensüberzeugungen ist zu unterscheiden. Historische Forschung kann anhand der überlieferten Zeugnisse ein Bild von der Wirksamkeit Jesu entwerfen und nach den Ursachen für seine Hinrichtung fragen. Ob er in göttlicher Autorität wirkte, ob Gott ihn vom Tod auferweckte und ob er zum endzeitlichen Gericht wiederkehren wird, kann dagegen nicht mit den Mitteln historischer Kritik entschieden werden. Historische Jesusforschung urteilt deshalb auch nicht über die Wahrheit des christlichen Glaubens. Sie stellt vielmehr die Grundlage dafür bereit, seine Entstehung nachzuvollziehen. Sie macht deutlich, dass das christliche Bekenntnis eine Reaktion auf den Anspruch Jesu darstellt, die das Neue Testament als »Nachfolge« oder als »Glaube« bezeichnet, neben der es aber auch andere Möglichkeiten gibt, sich zu Jesus zu verhalten. Bereits die in den frühen Quellen berichteten Konflikte zeigen, dass die Autorität Jesu auf den Geist Gottes zurückgeführt oder als Bund mit dem Satan gewertet werden konnte.4
Historische Jesusforschung zielt also auf das Verstehen des Zusammenhangs von Geschehnissen und ihrer späteren Deutung, von Ereignis und Erzählung.5 Sie befragt die Quellen daraufhin, ob sich das von ihnen Berichtete tatsächlich ereignet hat, warum gerade diese Dinge von Jesus berichtet werden, anderes dagegen nicht und wie sich Ereignis und Deutung zueinander verhalten. Historische Jesusforschung betrachtet die Quellen also mit einem kritisch-differenzierenden Blick.
Die Bibelwissenschaften haben maßgeblich zur Ausprägung dieses kritischen Bewusstseins beigetragen, dessen Anfänge sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lassen.6 In der Jesusforschung begegnet es zum ersten Mal in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einer Schrift mit dem Titel »Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes« des Hamburger Orientalisten Hermann Samuel Reimarus (1694–1768), von der Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) posthum sieben Teile als »Fragmente eines Ungenannten« publizierte. Seither ist die Unterscheidung zwischen den Ereignissen des Lebens und Wirkens Jesu einerseits, ihrer Darstellung in den Evangelien andererseits, eine Voraussetzung der Beschäftigung mit Jesus, deren Berechtigung niemand bezweifelt.
Die zweite Antwort lautet: Historische Forschung stellt die Vergangenheit nicht so wieder her, wie sie sich einst ereignet hat. Sie befragt die Quellen vielmehr aus ihrer eigenen Zeit heraus, versteht die Vergangenheit also im Licht ihrer eigenen Gegenwart. Für die historische Jesusforschung bedeutet das: Sie entwirft Bilder der Person Jesu, die dem Kenntnisstand über die damalige Zeit entsprechen, die zudem geprägt sind von der jeweiligen Sicht auf die Wirklichkeit und denjenigen Annahmen, die bei der Interpretation der Texte stets – bewusst oder unbewusst – eine Rolle spielen. Historische Jesusforschung setzt den christlichen Glauben also der kritischen Prüfung durch geschichtswissenschaftliche Methoden aus. Dabei gelangt sie niemals zu sicheren, unrevidierbaren Resultaten über die Vergangenheit. Sie stellt aber ein Bild Jesu vor Augen, das in der jeweiligen Gegenwart vor den Quellen rational und ethisch verantwortet ist. Historische Jesusforschung ist also kein dem christlichen Glauben entgegengesetztes Unterfangen, wiewohl man auch ohne Christ zu sein sich mit Jesus als historischer Person befassen kann. Für den christlichen Glauben stellt die historische Jesusforschung dagegen die Herausforderung dar, ihr Bekenntnis zu Jesus angesichts der je aktuellen Erkenntnisse über Jesus und seine Zeit zu formulieren.
Historische Jesusforschung stellt für die Verhältnisbestimmung von historischem Jesus und geglaubtem Christus also zugleich eine Herausforderung und einen Gewinn dar. Die Herausforderung besteht darin, das Bekenntnis zu Jesus der kritischen Prüfung durch wissenschaftliche Forschung auszusetzen und angesichts der dabei zutage geförderten Ergebnisse immer wieder neu zu durchdenken. Der Gewinn besteht darin, dass das Bekenntnis auf diese Weise den je aktuellen Erkenntnis- und Verstehensbedingungen korrespondiert und nicht zu einem abständigen und nur schwer vermittelbaren Inhalt wird. Auch das sei etwas näher erläutert.
Die zahlreichen literarischen und archäologischen Quellen, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt und veröffentlicht wurden,7 haben zu einer wesentlich genaueren Wahrnehmung des Judentums der Zeit Jesu geführt. Heutige Jesusdarstellungen unterscheiden sich gerade an diesem Punkt von solchen, die vor dem Bekanntwerden dieser Schriften verfasst wurden. Dazu beigetragen hat aber auch, dass die jüdischen Quellen heute mit anderen Augen betrachtet werden. Verantwortlich hierfür ist die Neubesinnung auf das Verhältnis des Christentums zum Judentum, die in der christlichen Theologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – ausgelöst nicht zuletzt durch die Shoa – einsetzte. Sie hat die Sensibilität für die Verwurzelung des Christentums im Judentum wesentlich befördert. Niemand bestreitet heute, dass Jesus und Paulus im Kontext des antiken Judentums verstanden werden müssen – als galiläischer Wanderprediger der eine, als zu Jesus Christus bekehrter Diasporajude und Pharisäer der andere. Die Erforschung des antiken Judentums als des historischen Kontextes für das Wirken Jesu und die Entstehung des christlichen Glaubens hat Thesen wie etwa diejenige eines »arischen Jesus« oder paganer Religiosität als Mutterboden des frühen Christentums als auf einer problematischen Entgegensetzung von »Judentum« und »Christentum« erweisen können. Dass Jesus fest in den jüdischen Schriften und Traditionen seiner Zeit verwurzelt war, wird heute von niemandem bestritten. Der historische Kontext Jesu, des Juden aus Galiläa, kann deshalb nicht zuletzt zu einem neuen Blick auf diejenigen Traditionen führen, die Juden und Christen miteinander verbinden.8 Das zeigt: Nicht nur die Quellenlage, auch der Blick auf die Quellen hat sich verändert. Historische Forschung hat immer auch eine Korrektivfunktion im Blick auf das Verständnis der Gegenwart im Horizont der Spuren der Vergangenheit.
Historische Forschung ist demnach der Vergangenheit wie der Gegenwart gleichermaßen verpflichtet. Sie bewahrt die Spuren des Gewesenen vor dem Vergessen, sie wehrt zugleich einer Instrumentalisierung der Vergangenheit zu ethisch fragwürdigen oder politisch vordergründigen Zwecken.9
Zwischen einem mittels historischer Forschung entworfenen »historischen Jesus« und dem »irdischen Jesus« ist darum zu unterscheiden: Der »historische Jesus« ist stets ein Produkt der Quellenauswertung durch einen Interpreten oder eine Interpretin. Abhängig davon, wie die Quellen beurteilt und zusammengefügt werden, entstehen dabei verschiedene Bilder. Historische Jesusdarstellungen – gerade auch diejenigen der neueren, auf intensiver Quellenauswertung basierenden Forschung – weisen deshalb z. T. beträchtliche Unterschiede auf. Zu einem eindeutigen Bild von Jesus wird historische Forschung niemals gelangen, denn die Quellen lassen nicht nur eine Deutung zu. Der »irdische Jesus« ist dagegen der Jude, der im 1. Jahrhundert in Galiläa gelebt und gewirkt hat und stets nur vermittelt durch Deutungen zugänglich ist. Spätere Zeiten sind für diese Deutungen auf Zeugnisse verwiesen, die Rückschlüsse auf die Person Jesu und ihren Kontext ermöglichen. Historische Jesusdarstellungen, wie andere historische Darstellungen auch, sind darum immer eine Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit und leisten so einen Beitrag zum Verstehen der Wirklichkeit. Das Resultat einer heutigen historischen Jesusdarstellung ist darum der erinnerte, vergegenwärtigte Jesus aus einer spezifischen Perspektive vom Anfang des 21. Jahrhunderts.10
Wie war es »wirklich«? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn Tatsachen und Ereignisse innerhalb eines Zusammenhangs gedeutet werden, der sich erst dem Blick späterer Interpreten erschließt. Die historischen Ereignisse des Wirkens und Geschicks Jesu, um die es im Folgenden geht, müssen aus den Quellen erschlossen, miteinander verknüpft und in einen historischen Kontext eingeordnet werden. Ob ein Zeitgenosse Jesu ihn in dem Bild, das dabei entsteht, wiedererkennen würde, bleibt eine hypothetische Frage, die aber auch nicht über den Wert einer heutigen Jesusdarstellung entscheidet. Wichtiger ist: Ein solches Jesusbild muss unter gegenwärtigen Erkenntnisbedingungen nachvollziehbar und an den Quellen orientiert sein – auch und gerade dort, wo uns Jesus in diesen Quellen fremd und unbequem erscheint. »Wirklich« meint dann: angesichts der je aktuellen Verstehensvoraussetzungen plausibel, wobei die jeweilige Gegenwart im Licht der Zeugnisse der Vergangenheit als gewordene verstanden wird. Die Frage, wer Jesus war, kann deshalb von derjenigen, wer er heute ist, nicht getrennt werden.