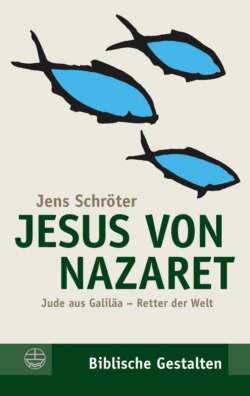Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. DAS HISTORISCHE MATERIAL: ÜBERRESTE UND QUELLEN 3.1 Überreste
ОглавлениеJohann Gustav Droysen, der Begründer neuzeitlicher Methodik historischen Arbeitens, unterteilte das Material, das dem Historiker zur Verfügung steht, in »Überreste« und »Quellen«. Damit ist gemeint: Es gibt einerseits Zeugnisse der Vergangenheit, die für den Gebrauch in der damaligen Zeit bestimmt waren, nicht jedoch dazu, Ereignisse festzuhalten, um sie der Nachwelt zu überliefern. Hierzu rechnete Droysen z. B. Geschäftsbriefe, Korrespondenzen, Gesetze usw. In den Quellen dagegen »sind die Vergangenheiten, wie menschliches Verständnis sie aufgefasst und ausgesprochen, als Erinnerung geformt hat, überliefert.« Hierbei handelt es sich also um solche Zeugnisse, in denen sich Menschen ein Bild ihrer eigenen Zeit gemacht, ihre Wirklichkeit interpretiert und festgehalten haben.30
Wenden wir diese Unterscheidung auf die historische Jesusforschung an, so gehören diejenigen Dinge zu den »Überresten«, die Informationen über den kulturellen, politischen, sozialen und religiösen Kontext Jesu liefern. Hierzu zu rechnen sind z. B. die archäologischen Zeugnisse aus Galiläa, die die Ausgrabungen der zurückliegenden Jahrzehnte zutage gefördert haben. Die jüdische Prägung Galiläas wurde durch diese Zeugnisse eindrucksvoll herausgestellt.31 Hierzu gehören weiter Münzen, die Aufschluss darüber geben, dass Herodes Antipas, der Herrscher in Galiläa zur Zeit Jesu, die jüdische Prägung dieser Region respektierte, indem er keine Münzen mit seinem eigenen Bild oder mit demjenigen des römischen Kaisers prägen ließ. Einige der wichtigen Funde werden im Folgenden kurz vorgestellt.
1) Die Pilatusinschrift von Cäsarea Maritima (Anhang, Abbildung 2).32 Sie ist im Israel-Museum in Jerusalem ausgestellt. Eine Kopie steht im antiken Cäsarea, wo die Inschrift gefunden wurde. Der Text lautet:
[NAUTI]S TIBERIEUM
[PO]NTIUS PILATUS
[PRAEF]ECTUS IUDAE[A]E
[REF]E[CIT]
[Den Seeleuten hat dieses] Tiberieum
[Po]ntius Pilatus
[Praef]ect von Judaea
[wieder errichtet]
Das »Tiberieum« ist demnach ein Gebäude, das Pontius Pilatus »den Seeleuten« (nautis) errichten lassen hat. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Leuchtturm (daher die Ergänzung »Den Seeleuten«), vielleicht auch um einen Sakralbau (dann könnte die erste Zeile zu AUGUSTIS ergänzt werden).33 Zu Ehren des Kaisers Tiberius trug das Gebäude den Namen »Tiberieum«. Die Inschrift belegt, dass Pontius Pilatus die Amtsbezeichnung »Präfekt« trug, nicht »Prokurator«, wie es bei Tacitus heißt.
2) Das Kaiaphas-Ossuar (Anhang, Abbildung 3). Im Jahr 1990 wurden in einer Familiengrabstätte in Jerusalem 12 Ossuare entdeckt. Das größte dieser Ossuare, das sich jetzt im Israel-Museum befindet, enthält die Knochen eines etwa sechzigjährigen Mannes und einiger seiner Familienmitglieder. Es wurde zudem aufwendig verziert. Auf der Längsseite findet sich die Aufschrift »Joseph, Sohn des Ka(ia)phas«, auf der Schmalseite die gekürzte Version »Joseph, Sohn des Kph«.
Es könnte sich um das Familiengrab des Hohenpriesters Kaiaphas handeln, den auch die Evangelien des Neuen Testaments und Josephus nennen (Josephus nennt in Ant. 18,35 »Joseph« als Zweitnamen des Kaiaphas). Obwohl die Lesart »Kaiaphas« nicht völlig gesichert ist, könnte das Ossuar dasjenige des Hohenpriesters Kaiaphas und seiner Familie sein. Das wird durch ein 2011 bekannt gewordenes Ossuar unterstützt, das die Aufschrift trägt: »Miriam, Tochter des Jeschua, Sohn des Kaiaphas, Priester von Maaziah, aus dem Hause Imri«. Damit ist ein weiterer Beleg für den Hohenpriester Kaiaphas ans Licht gekommen.
3) Das 1986 im See Gennesaret gefundene Boot (Anhang, Abbildung 4).34 Es stammt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. und wird deshalb mitunter auch als »Jesus-Boot« bezeichnet (obwohl natürlich niemand weiß, wer es tatsächlich benutzt hat). Nach einer ebenso komplizierten wie spektakulären Bergungs- und Konservierungsaktion ist es heute in der Allon-Ausstellungshalle des Kibbuz Nof Ginnosar in der Nähe von Kafarnaum zu besichtigen. Die Abmessungen der gefundenen Überreste betragen ca. 8,20 m x 2,30 m, die Maße für das ganze Boot betrugen demnach ca. 10 m x 3 m. Damit hatte es eine beachtliche Größe, die es zum Transport mehrerer Personen oder größerer Mengen von Gütern geeignet erscheinen lässt. Auffällig ist die Verwendung vieler Holzarten bei der Herstellung sowie bei späteren Reparaturen, die darauf schließen lässt, dass Bauholz knapp war. Ein Schiffsmosaik aus dem nahe gelegenen Magdala zeigt ein Boot ähnlichen Typs. Das Boot kann eine Szene wie die in Mk 4,35–41 beschriebene veranschaulichen:
Jesus schläft dort »im Heck«, was auf ein größeres Boot mit ausgearbeitetem Heck schließen lässt.