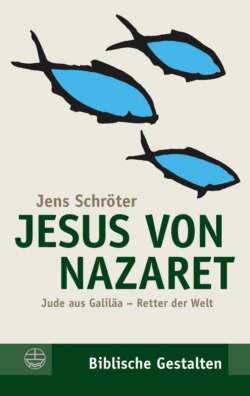Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Nichtchristliche Quellen
ОглавлениеDie wenigen außerchristlichen Notizen über Jesus sind in jüdische und heidnische Quellen zu unterteilen. Wir besprechen im Folgenden die wichtigsten dieser Zeugnisse.
1) Der jüdische Historiker Flavius Josephus (ca. 37 – nach 100 n. Chr.) kommt in einem Passus seines Werkes »Die jüdischen Altertümer« auch auf Jesus zu sprechen. Wie heute anerkannt ist, handelt es sich hierbei um ein christlich überarbeitetes Textstück.64 Das ist insofern nicht verwunderlich, als die Werke des Josephus nicht von Juden, sondern von Christen überliefert wurden. Die dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgenommenen Ergänzungen sind im Text kursiv gesetzt. Der Text lautet:
Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorherverkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.
Bemerkenswert ist zunächst, dass ein jüdischer Historiker am Ende des 1. Jahrhunderts (die »Jüdischen Altertümer« entstanden in den neunziger Jahren) überhaupt auf Jesus zu sprechen kommt. Interessant ist weiter: Josephus beschreibt Jesus als Wundertäter und Lehrer. Das dürfte für die Wahrnehmung Jesu durch seine jüdischen Zeitgenossen durchaus repräsentativ sein. Vermutlich hat auch eine Bemerkung über die Bezeichnung Jesu als »Christus« bereits im ursprünglichen Text des Josephus gestanden. Dafür spricht, dass am Ende des Textes das »Volk der Christen, die sich nach ihm nennen« genannt wird. Vermutlich hat diese Notiz aber nicht den Charakter eines Bekenntnisses (»Er war der Christus«) gehabt, wie es sich jetzt im Text findet. Sie könnte aber gelautet haben: »Er wurde Christus genannt«. In diese Richtung weist eine derartige Formulierung in der Notiz des Josephus über Jakobus, den er als »Bruder Jesu, der Christus genannt wird« bezeichnet (Ant. 20,200).65 Bemerkenswert ist schließlich, dass Josephus auch von Anhängern Jesu unter den Heiden spricht. Es ist nicht ganz deutlich, woher er diese Information besitzt und ob sie sich auf den palästinischen Kontext des Wirkens Jesu oder aber auf seine eigene Wahrnehmung des Christentums in Rom stützt, wo Josephus zur Zeit der Abfassung seines Werkes lebte. Immerhin stimmt sie sowohl mit einigen Angaben in den Evangelien überein, wo ebenfalls von Heiden die Rede ist, die sich an Jesus wenden,66 als auch mit der historischen Situation christlicher Gemeinden außerhalb Palästinas zur Zeit des Josephus selbst.
2) Die beiden heidnischen Texte weisen nach Rom. In einem Bericht über den Brand Roms während der Herrschaft von Kaiser Nero kommt der römische Historiker Tacitus (ca. 56 – ca. 120) auch auf das Gerücht zu sprechen, die Christen seien für den Brand verantwortlich (Annalen 15,44,2 f.). Er schreibt:
Aber weder durch menschliche Hilfeleistungen noch durch kaiserliche Schenkungen oder durch den Göttern dargebrachte Sühnopfer ließ sich das schändliche Gerücht beseitigen, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Um dieses Gerede zu beenden, gab Nero denen die Schuld und belegte sie mit sehr ausgesuchten Strafen, die wegen ihrer Schandtaten (flagitia) verhasst waren und die das Volk Christen (Christiani) nannte. Der Urheber dieses Namens, Christus, war zur Zeit der Herrschaft des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Der dadurch zunächst unterdrückte unheilvolle Aberglaube (superstitio) brach jedoch von neuem aus, nicht nur in Judäa, wo dieses Übel seinen Ursprung hat, sondern auch in der Hauptstadt (urbs), wo alle furchtbaren und schändlichen Gräuel und Abscheulichkeiten von überallher zusammenströmen und ausgeübt werden.
Tacitus verfasst die Annalen in der Spätphase seines Lebens (ca. zwischen 115 und 118), zu einer Zeit also, in der die berichteten Ereignisse bereits einige Jahrzehnte zurückliegen.67 Seine Notiz ist demnach ein Zeugnis für die Wahrnehmung der Christen durch die römische Oberschicht am Beginn des 2. Jahrhunderts. Tacitus weiß um die Herkunft des christlichen Glaubens aus Judäa, die Urheberschaft eines »Christus« (Tacitus denkt dabei natürlich an einen Eigennamen, nicht an eine jüdische Hoheitsbezeichnung) sowie um dessen Hinrichtung zur Zeit des Kaisers Tiberius (14–37) durch Pontius Pilatus. Letzteren nennt er »Prokurator«, obwohl Pilatus, wie aus der oben erwähnten Inschrift hervorgeht, die Amtsbezeichnung »Präfekt« trug.68 Tacitus war hierüber offenbar nicht genau informiert. Des Weiteren liefert Tacitus den ältesten nichtchristlichen Beleg für den Namen »Christen« (Christiani). Das deutet darauf hin, dass die Christen in den sechziger Jahren des 1. Jahrhunderts in Rom bereits als eigene Gruppe wahrgenommen wurden. Weiter kolportiert Tacitus die gängigen heidnischen Vorurteile gegen die Christen, wenn er davon spricht, sie seien wegen ihrer »Schandtaten« beim Volk verhasst gewesen.
Das wird durch die zweite außerchristliche Quelle bestätigt. Sueton (ca. 70 – ca. 120), ein Biograph der zwölf Kaiser von Caesar bis Domitian, erwähnt in seiner Lebensbeschreibung des Kaisers Nero, dass dieser mit Todesurteilen gegen die Christen vorgegangen sei und bezeichnet den christlichen Glauben dabei ebenfalls als superstitio.69 Außerdem kommt er in seiner Biographie des Kaisers Claudius (41–54) auf die durch diesen veranlasste Ausweisung der Juden aus Rom zu sprechen:
Die Juden, aufgehetzt durch Chrestus unablässig Unruhe stiftend, vertrieb er aus Rom.
Diese Maßnahme wird auch in Apg 18,2 (Paulus begegnet Aquila und Priscilla in Korinth, die vor kurzem aus Italien gekommen waren, da Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen müssen) und dann noch einmal bei dem christlichen Historiker Orosius aus dem 5. Jahrhundert erwähnt und ist vermutlich in das Jahr 49 zu datieren. Als Hintergrund sind Auseinandersetzungen um die Christusbotschaft innerhalb der jüdischen Gemeinde Roms zu vermuten. Sueton führt diese Unruhen auf einen »Chrestus« zurück und versteht darunter, ebenso wie Tacitus, einen Eigennamen. Vermutlich liegt dem eine Verwechslung von »Chrestus« mit »Christus« zugrunde, was aufgrund der gleichlautenden Aussprache gut vorstellbar ist. Der historische Wert der Sueton-Notiz liegt also darin, dass sie zeigt, wie ein heidnischer Autor das nach Rom gelangte Christentum wahrgenommen hat: Er hat von einem »Chrestus« gehört, der die Juden zum Aufruhr anstiftet. Genauere Informationen über Person und Inhalt der christlichen Verkündigung besitzt Sueton dagegen nicht – und es erscheint ihm auch nicht von Belang, darüber genauere Erkundigungen einzuziehen.70
Die nichtchristlichen Quellen zeigen zunächst, dass Jesus nur von Josephus als Person wahrgenommen wird, deren Auftreten einer näheren inhaltlichen Charakterisierung wert erscheint. Er berichtet von Jesu außergewöhnlichen Taten und seinem Lehren sowie seinem Erfolg bei Juden und Heiden. Vermutlich erwähnt er auch, dass Jesus von seinen Anhängern als Gesalbter (»Christus«) bezeichnet wurde. Wie auch Tacitus weiß Josephus zudem von der Anhängerschaft Jesu, deren Name sich von »Christus« herleitet. Beide kennen also die Bezeichnung »Christiani« bzw. »Christianoi«, die auch im Neuen Testament belegt ist (Apg 11,26 im Plural; Apg 26,28 und 1Petr 4,16 im Singular). Im Unterschied zu Tacitus und Sueton weiß der Jude Josephus dabei natürlich, dass »Christus« kein Eigenname ist, sondern Bezeichnung für den Gesalbten Gottes ist, der in dessen Auftrag handelt. Deshalb unterscheidet er zwischen dem Namen »Jesus« und der Bezeichnung »Christus«.
Sueton und Tacitus haben dagegen offenbar nur im Zusammenhang von Vorgängen in Rom vom Wirken eines »Christus« bzw. »Chrestus« Kenntnis genommen. Aus ihren Nachrichten geht deshalb hervor, dass das Christentum bereits im 1. Jahrhundert in Rom eine Rolle gespielt hat. Dabei wird es von Sueton als eine innerjüdische Gruppierung aufgefasst, wogegen Tacitus ausdrücklich seinen Ursprung in Palästina erwähnt. Zudem weiß er die Hinrichtung Jesu der Regierungszeit des Tiberius und der Amtszeit des Pilatus zuzuordnen. Schließlich handelt es sich für den Römer Tacitus bei der von den »Christiani« vertretenen Überzeugung um eine der zahlreichen Formen des Aberglaubens, deren Verbreitung im Römischen Reich er mit Verachtung konstatiert. Nähere Kenntnis von Jesus und der auf ihn zurückgehenden Bewegung besitzen die heidnischen Autoren nicht – und hätten es vermutlich auch abgelehnt, sich mit einer derartigen obskuren Bewegung aus dem Osten des Römischen Reiches näher zu befassen.