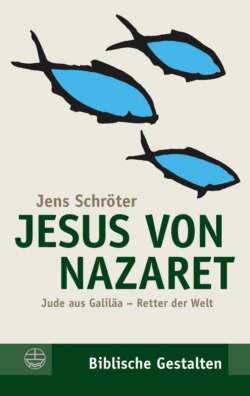Читать книгу Jesus von Nazaret - Jens Schröter - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.2 Christliche Schriften außerhalb des Neuen Testaments
ОглавлениеFür eine historische Darstellung zu berücksichtigende Jesusüberlieferungen finden sich auch außerhalb des Neuen Testaments. Zu nennen sind zunächst einige der zu den sog. »Apostolischen Vätern« gerechneten Texte. Hierbei handelt es sich um Schriften, die zwischen dem Ende des 1. und des 2. Jahrhunderts entstanden sind und bei der endgültigen Festlegung des Kanons des Neuen Testaments nicht in diesen aufgenommen wurden.50 Obwohl diese Texte zumeist später entstanden sind als die Evangelien des Neuen Testaments, können sie alte, unabhängige Überlieferungen bewahrt haben. Das lässt sich in einigen Fällen auch wahrscheinlich machen, wenngleich sich das historische Profil des Wirkens und Geschicks Jesu dadurch nicht grundlegend verändert.
So finden sich im 1. und 2. Klemensbrief Worte, die auf Jesus zurückgeführt werden und zum Teil Parallelen in den Evangelien des Neuen Testaments besitzen. In 1Klem 13,2 wird eine Reihe von »Worten des Herrn Jesus« angeführt, die die »Milde und Langmut« belegen, die er gelehrt habe. Diese Worte berühren sich mit der Bergpredigt, ohne dass sich eine direkte literarische Abhängigkeit nachweisen ließe. Ähnlich wird in 1Klem 46,7 auf »Worte unseres Herrn Jesus« verwiesen, die im Folgenden zitiert werden. Hier geht es um das Wort vom Mühlstein, das sich auch in Mk 9,42/Mt 18,6 findet und in 1Klem 46,8 in einer eigenen Version angeführt wird. In 2Klem wird des Öfteren darauf verwiesen, dass »der Herr« oder auch Jesus etwas gesagt habe. In 2Klem 8,5 heißt es sogar »Der Herr sagt im Evangelium …«. Ob dem Verfasser dabei eine Schrift mit Jesusüberlieferungen zur Verfügung gestanden hat, ist nicht mehr eindeutig festzustellen. Die Didache, eine Kirchenordnung vom Ende des 1. Jahrhunderts, führt etliche Überlieferungen – darunter z. B. auch eine Version des Vaterunsers – an, die ebenfalls Parallelen in den synoptischen Evangelien, vor allem im MtEv, besitzen. Sie werden hier allerdings nur zum Teil auf Jesus zurückgeführt, wobei die Didache in 8,2 die Formulierung »wie es der Herr angeordnet hat im Evangelium« verwendet. Laut ihrem Titel steht die Didache dagegen unter der Autorität der (zwölf) Apostel. Insgesamt verweist dieser Befund darauf, dass die Jesusüberlieferung auch nach ihren ersten Verschriftlichungen weiter als eine freie und lebendige Überlieferung existierte.
Zu nennen sind des Weiteren diejenigen Texte, die zu den sog. »Apokryphen«, wörtlich: den »verborgenen Schriften« gerechnet werden.51 Diese Bezeichnung konnte von den Verfassern dieser Schriften selbst in Anspruch genommen werden. Mit dem »Apokryphon des Johannes« ist sogar eine Schrift überliefert, die sich bereits im Titel als »apokryph« bezeichnet, und am Beginn des Thomasevangeliums wird der Inhalt der Schrift als »verborgene [apokryphe] Worte des lebendigen Jesus« charakterisiert. Nach dem Selbstverständnis dieser Schriften ist »apokryph« also eine positive Beschreibung ihres Inhalts: Es werden besondere Lehren Jesu oder spezielle Erkenntnisse vermittelt, die dem »Durchschnittschristentum« nicht zugänglich sind, sondern auserwählten Kreisen vorbehalten bleiben. Von den altkirchlichen Theologen wird »apokryph« dagegen im abwertenden Sinn gebraucht und mit »unecht« bzw. »gefälscht« gleichgesetzt. Heute dient der Begriff dagegen als Sammelbezeichnung für diejenigen Texte, die weder zum Neuen Testament noch zu den »Apostolischen Vätern« gehören. Daraus ergibt sich zugleich eine gewisse Unschärfe: Zu den apokryphen Überlieferungen werden heute z. B. auch solche Texte gerechnet, die in den ältesten Manuskripten der Evangelien nicht bezeugt sind, sondern erst später in diese eingefügt wurden.52 Dazu gehören aber auch später entstandene Schriften ganz unterschiedlichen Charakters, die oft nur fragmentarisch erhalten sind und in vielen Fällen in keiner inhaltlichen oder literarischen Beziehung zueinander stehen. »Apokryphen« ist deshalb im heutigen Verständnis eine Sammelbezeichnung für verschiedenartige Texte, die nur gemeinsam haben, dass sie nicht zum ältesten Textbestand des Neuen Testaments gehören und auch nicht zu den sog. »Apostolischen Vätern« gerechnet werden.53 Diese Texte haben deshalb auch niemals eine eigene Sammlung in Analogie zum Neuen Testament gebildet.
Etliche der apokryphen Texte sind erst seit gut 150 Jahren bekannt. Es handelt sich dabei z. T. um Fragmente mit einzelnen Worten oder Episoden,54 z. T. um größere Teile von Evangelien oder Schriften anderen Charakters, die Jesusüberlieferungen enthalten. Interessante Beispiele für Fragmente sind der Papyrus Egerton und der Oxyrhynchos-Papyrus 840, wichtige apokryphe Evangelien aus dem 2. bzw. 3. Jahrhundert sind das Thomasevangelium, das Petrusevangelium sowie das Mariaevangelium. Andere Texte sind dagegen schon immer bekannt gewesen, weil sie in der Kirche, obwohl nicht »offiziell« akzeptiert, dennoch gerne gelesen wurden. Hierbei handelt es sich um volkstümliche Erzählungen, die das Leben Jesu und der Apostel legendarisch ausschmücken, also eine Art »christliche Volksliteratur« darstellen. Dazu gehören etwa die sogenannten »Kindheitsevangelien«, auf die in Teil C. 2 zurückzukommen sein wird, aber auch die apokryphen Apostelakten, die das Leben der Apostel romanhaft ausschmücken.
Um das Verhältnis einiger der apokryphen Texte zu den Evangelien des Neuen Testaments wird seit einiger Zeit eine intensive Diskussion geführt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, ob die Apokryphen zusätzliche Informationen über Jesus enthalten, die das aus dem Neuen Testament gewonnene Bild ergänzen oder gar verändern würden. Mitunter verbindet sich damit das Interesse, das Christentum der ersten beiden Jahrhunderte als eine noch nicht von kirchlicher Orthodoxie und Hierarchie geprägte Bewegung darzustellen, für die auch der später festgelegte Kanon des Neuen Testaments noch nicht maßgeblich gewesen sei.55
Grundsätzlich gilt hierbei: Für die Frage nach dem historischen Jesus spielt die Frage, ob ein Text zum »Neuen Testament«, zu den »Apostolischen Vätern« oder zu den »Apokryphen« gerechnet wird, keine Rolle. Es handelt sich dabei vielmehr um spätere Einteilungen und Wertungen, die keine Auskunft über den historischen Quellenwert einzelner Schriften geben. Auch in den sogenannten »apokryphen« Evangelien können sich demnach alte Überlieferungen finden.
Die Thesen der Frühdatierung und Unabhängigkeit der außerkanonischen Schriften halten einer genaueren Prüfung allerdings in der Regel nicht stand. Das sei an den folgenden Beispielen etwas näher gezeigt.
Der Papyrus Egerton 2 (PEg)56 überliefert auf den beiden identifizierbaren Fragmenten verschiedene Episoden, die Varianten von Erzählungen in den neutestamentlichen Evangelien darstellen (Anhang, Abbildung 5). Nachdem anfänglich (die Erstveröffentlichung erfolgte 1935) die Unabhängigkeit von den neutestamentlichen Evangelien vermutet wurde, hat vor allem die Ergänzung des Papyrus durch ein 1987 veröffentlichtes Fragment aus der Kölner Papyrussammlung (PKöln 255) gezeigt, dass PEg Stoffe aus den synoptischen Evangelien mit solchen aus dem Johannesevangelium verknüpft.57 Er gehört also in eine spätere Phase der Jesusüberlieferung als die neutestamentlichen Evangelien, auch wenn er von diesen nicht direkt literarisch abhängig sein muss.
Das Petrusevangelium58, von dem ein 1886 / 87 entdeckter Teil in griechischer Sprache vorliegt, dem später zwei weitere Fragmente zugeordnet werden konnten, enthält eine Fassung der Passions- und Ostererzählung. Etliche Merkmale deuten darauf hin, dass es sich auch hier um eine Version handelt, die in ein späteres überlieferungsgeschichtliches Stadium gehört als die entsprechenden Berichte der Synoptiker und des Johannesevangeliums. Dazu gehören vor allem die einseitige Zuschreibung der Schuld am Tod Jesu an die Juden sowie die Ausmalung der Auferstehungsszenerie durch den von selbst ins Rollen geratenden Stein, das Motiv des Jesus folgenden und sprechenden Kreuzes sowie eine Himmelsstimme.
Das Mariaevangelium,59 von dem ein längeres Stück in koptischer Sprache auf einem zur Berliner Papyrussammlung gehörigen Codex, dem sog. »Berolinensis Gnosticus« (BG 8502), sowie zwei griechische Fragmente aus dem 3. Jahrhundert60 existieren, überliefert auf den erhaltenen Seiten (die Seiten 1–6 und 11–14 der ursprünglich 18 Seiten fehlen) einen Dialog des »Erlösers« mit seinen Jüngern vor seinem Weggang sowie im Anschluss daran einen Dialog Marias mit den Jüngern. Dabei berichtet Maria von speziellen Offenbarungen, welche ihr in einer Vision zuteil wurden, die offenbar auch eine Himmelsreise einschloss. Am Ende steht ein Streit über die Autorität der Maria, die von Petrus und Andreas in Zweifel gezogen, von Levi dagegen verteidigt wird. Dabei setzt EvMar die Erzählungen von der Erscheinung des Auferstandenen im MtEv, vermutlich auch im JohEv, voraus und entwirft auf dieser Grundlage eine nachösterliche Situation der Begegnung Jesu mit Maria und den Jüngern.61
Unter den apokryphen Evangelien hat das Thomasevangelium besondere Beachtung gefunden.62 Die Entdeckung dieser Schrift, die sich als zweite Schrift in Codex II der dreizehn 1945 in Nag Hammadi in Oberägypten gefundenen Codices findet, war seinerzeit eine regelrechte Sensation. Zum ersten Mal war man nunmehr im Besitz des (nahezu) vollständigen Textes eines apokryphen Evangeliums – zumindest in einer koptischen Übersetzung –, von dessen Existenz man, wie auch beim Petrus- und beim Judasevangelium, bereits zuvor durch Erwähnungen bei altkirchlichen Theologen wusste. Die Forschung hat sich in den ersten Jahrzehnten nach dieser Entdeckung intensiv mit der Frage nach dem Verhältnis des Ev Thom zu den kanonischen, vor allem den synoptischen Evangelien beschäftigt. Das legte sich schon deshalb nahe, weil ungefähr die Hälfte der im Ev Thom begegnenden Sprüche und Gleichnisse Jesu Parallelen in den synoptischen Evangelien besitzt. Inzwischen ist diese, zum Teil hitzig geführte Debatte einer besonnenen Analyse des Ev Thom gewichen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Schrift Zeugnis für eine Rezeptionslinie der Jesusüberlieferung ist, die im 2. Jahrhundert einsetzt. Aus dieser Zeit stammen auch die ältesten Fragmente des Ev Thom in griechischer Sprache.
Das Ev Thom ist nicht an einer Darstellung des Wirkens und Geschicks Jesu in seinem historischen Kontext interessiert, sondern an seinen Worten und Gleichnissen, die als »verborgene Worte des lebendigen Jesus« charakterisiert werden – »verborgen« deshalb, weil es besonderer Einsicht bedarf, um ihre eigentliche, tiefere Bedeutung zu erkennen. Dazu gehören sowohl sehr alte Überlieferungen, wie z. B. die Seligpreisung der Verfolgten (Spruch 68), die Gleichnisse von Senfkorn und Sauerteig (Spruch 20 bzw. 96) und das Wort über die Heimatlosigkeit des Menschensohnes (Spruch 86), als auch jüngere, wie etwa das Wort über die Herkunft aus dem Königreich, in das man wieder zurückkehren wird (Spruch 49), oder dasjenige über das Eingehen der »Einzelnen« in den Hochzeitssaal (Spruch 75). Die frühen Jesusüberlieferungen werden im Ev-Thom also innerhalb eines neuen Konzeptes interpretiert. Dieses ist an Jesus als dem Offenbarer des wahren Menschseins orientiert, dessen Worte den Weg zurück zum Ursprung und damit zur Bestimmung des Menschen weisen. In diesen Zusammenhang gehören auch das programmatisch am Anfang stehende Wort über das Suchen und Finden (Spruch 2), die Bezeichnung der Welt als einer »Leiche« (Spruch 56; vgl. 80) sowie die hiermit verbundene Aufforderung, sich der Welt zu enthalten (Spruch 27) und stattdessen den Weg zurück zum Vater zu suchen. Mit dieser Vorstellung einer Erlösung durch Erkenntnis weist das Ev Thom eine Nähe zu solchen Schriften auf, die davon sprechen, dass der Mensch wieder werden muss, was er ursprünglich war.
Für die Frage nach dem historischen Jesus bedeutet das: Es ist durchaus möglich, dass sich im Ev Thom sehr alte Jesusüberlieferungen finden. Das Gesamtkonzept ist jedoch jünger als dasjenige der neutestamentlichen Evangelien. Diese liefern deshalb auch den Rahmen, innerhalb dessen Worte aus dem Ev Thom für den historischen Jesus zu interpretieren sind. Hiervon zu unterscheiden ist eine Interpretation des Ev Thom selbst als Zeugnis für die Rezeption der Jesusüberlieferung im 2. Jahrhundert.
Die Schriften der Apostolischen Väter sowie die apokryphen Evangelien sind somit Zeugnisse für die Vielfalt der Deutungen, die die Person Jesu im 2. und 3. Jahrhundert erfahren hat. Für eine historische Rekonstruktion sind sie jedoch nur von sekundärer Bedeutung, auch dann, wenn sich in ihnen alte Überlieferungen finden sollten. Entscheidend ist, dass sich die Perspektive auf Jesus verändert hat: Wird er in den Schriften aus dem 1. Jahrhundert als in Galiläa und Jerusalem im Kontext des Judentums wirkend beschrieben, so treten an diese Stelle später religionsphilosophische Systeme und Geheimoffenbarungen, die nunmehr das Verständnis seiner Lehre prägen. Eine Datierung dieser Schriften in das 1. Jahrhundert würde deshalb eine Verzeichnung des historischen Befundes bedeuten, dem zufolge das Wirken Jesu innerhalb des Judentums zu interpretieren ist.
Aus dem dargestellten Befund folgt, dass die Evangelien des Neuen Testaments – und hier noch einmal besonders die synoptischen Evangelien – sowohl aufgrund ihres Alters wie auch der Tatsache, dass sie das Wirken Jesu in einen bestimmten zeitlichen und geographischen Kontext einordnen, die Grundlage für historisch-kritische Jesusdarstellungen besitzen.63 Auch in den nicht kanonisch gewordenen Schriften können alte Überlieferungen aufbewahrt sein. In historisch-kritischen Darstellungen sind diese jedoch innerhalb des von den ältesten Jesuserzählungen entworfenen geographischen, kulturellen und religiösen Milieus zu interpretieren.
In allen genannten Quellen ist zwischen frühen, historisch zuverlässigen und späteren, für historische Darstellungen sekundären Überlieferungen zu unterscheiden. Dabei handelt es sich natürlich nicht um im strikten Sinn beweisbare Urteile, sondern um solche, die auf der Plausibilität des Gesamtbildes beruhen und im Einzelfall umstritten bleiben können. Generell gilt jedoch der Maßstab der historischen Plausibilität und Kohärenz der Darstellung, der zur Entscheidung des Einzelfalls in einem dialektischen Verhältnis steht. Es handelt sich bei der historischen Beurteilung der Quellen also um einen immer wieder abzuschreitenden Zirkel von Gesamtbild und Einzelüberlieferung, die aufeinander zu beziehen sind und sich dabei gegenseitig korrigieren – ein Verfahren, das bei historischer Arbeit generell angewendet wird. In der vorliegenden Darstellung wird deshalb die Wirksamkeit Jesu in ihren vorauszusetzenden Kontext eingezeichnet, dem dann – orientiert an der beschriebenen Bewertung der Quellen – die jeweiligen Überlieferungen zugeordnet werden. Auf diese Weise soll ein plausibles und kohärentes Bild von Wirken und Geschick der historischen Person Jesu erstellt werden.