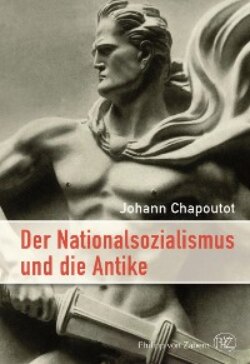Читать книгу Der Nationalsozialismus und die Antike - Johann Chapoutot - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Blonde Haare in der Antike: Irrungen und Wirrungen
der Langschädel im Mittelmeerraum
ОглавлениеDie Psychologie mag ihre Verdienste haben, die Königin der Beweisführung bleibt aber die Rassenanthropologie. Günther konnte, wie wir gesehen haben, jede Art von Argument gebrauchen, doch fand er seine solidesten Stützen in der Paläontologie und der historischen Anthropologie: der griechische Körper wurde dabei zur Epiphanie des nordischen Ethnotyps erhoben.
Günther beklagt zunächst den Mangel an beobachtbarem menschlichen Material, da die Griechen die schlechte Angewohnheit hatten, ihre Toten oft zu verbrennen. Wo Schädel fehlen, gibt es aber immerhin die Möglichkeit, die Helme der griechischen Krieger zu untersuchen, die in den Sammlungen des Alten Museums zu Berlin reichhaltig vertreten sind. Diese wiesen „fast ausschließlich auf lange, schmale Kopfformen“28 und damit auf die für die nordische Rasse charakteristische Dolichocephalie29 hin. Der Franzose Vacher de Lapouge30, dem Günther hier folgt,31 hatte als Erster den dolichocephalen Menschen des Nordens der gewöhnlichen Brachycephalie32 der anderen europäischen, asiatischen oder semitischen Rassen gegenübergestellt.
Da unmittelbare anthropologische Zeugnisse fehlen, wandte Günther sich zunächst den antiken literarischen Quellen zu. Der literarische Kanon Griechenlands wurde zur Argumentation herangezogen, insbesondere das opus majus Homers: „Die Götter und Helden der Ilias […] sind blond wie die der Odyssee.“33
Helden und Götter Homers wiesen in physiologischer und anthropometrischer Hinsicht sowie in der Pigmentation alle Eigenschaften der nordischen Rasse auf. Nur eine nordische Schönheit, die der Schönen Helena, habe die Griechen so zur Raserei bringen können, dass sie sich darüber in einen zehnjährigen Krieg stürzten, meint Günther, der ihr in seiner Begeisterung seine Huldigung darbietet:
„Helenas Schönheit wird eingehender geschildert: ihre seidenweichen Blondhaare, ihre fast durchsichtigen Augen, ihre rosigen Wangen und roten Lippen, ihre blendend helle Haut, ihre schmalen weißen Hände – also alles nordische Rassenmerkmale.“34
Nicht nur die Haut- und Haarfarbe verweisen in Richtung Norden, sondern auch ihre Körpergröße: „Götter und Helden der hellenischen Frühzeit […] ist auch ein hoher Wuchs eigen“,35 stellt Günther fest, der eine ganze Reihe von weiteren Texten außerhalb des homerischen Korpus und Kanons anführt: Herodot, Pindar, Lukian, Aristoteles und andere.
Günther hatte noch nicht das Arbeitsinstrument zur Hand, das einige Jahre später ebenfalls bei Lehmanns erschien: das Werk seines Kollegen Wilhelm Sieglin, Professor für Anthropologie an der Universität Berlin. Sieglin veröffentlichte im Jahr seines Todes, 1935, ein Werk mit dem Titel Die blonden Haare der indogermanischen Völker des Altertums. Eine Sammlung der antiken Zeugnisse als Beitrag zur Indogermanenfrage36. Auf eine Einleitung von etwa 60 Seiten Länge zur Frage des nordischen Ursprungs der Indogermanen folgen 92 weitere Seiten. Sieglin erfasst hier alle realen, mythologischen oder fiktiven Figuren, die in der antiken Literatur als blond oder braunhaarig bezeichnet wurden. Dabei werden der Name und die Rolle der jeweiligen Person sowie die vom Autor herangezogene Quelle genau erfasst – die reinste Sträflingsarbeit, wenn man bedenkt, dass das Werk 700 solcher Stichwörter verzeichnet.
Diese haarigen Prosopographien sind streng eingeteilt in mehrere kritische Kategorien. Dabei werden alle Völker der Antike berücksichtigt: 1) Hellenen; 2) Italer; 3) Gallier; 4) Germanen und Schweden, aber auch Juden, Ägypter etc. Die Völker Griechenlands und Roms, auf die besonders häufig verwiesen wird, sind in Subkategorien eingeteilt. Sieglin unterteilt sie in „Götter und Göttinnen“, „Mythische Personen“, „Historische Personen“ und „Erdichtete Personen“, wobei er für die bedauernswerten dunkelhaarigen Kerle die gleichen Kategorien vorsieht.37
Die Schlussfolgerung, die sich aufdrängt, ist nicht allzu überraschend: Griechen, Römer, Germanen und Schweden werden als mehrheitlich blonde Völker dargestellt. Die Juden sind ihrerseits dunkelhaarig: andere Rasse, andere Farbe. Mit seiner Akribie und seinem Streben nach Wissenschaftlichkeit und Genauigkeitsversessenheit ist Sieglins Werk in seiner obsessiven und pedantischen Art vielleicht das erstaunlichste Produkt der Rassenkunde dieser Zeit.
Das Buch wurde in der Nummer vom 15. Mai 1935 des Schwarzen Korps, der Wochenschrift der SS, ausführlich lobend besprochen und einem Publikum weit jenseits enger akademischer Zirkel zur Lektüre empfohlen. Der Titel des Artikels – „Die Nordrasse eroberte die Welt“38 – verweist ohne Umschweife auf das Interesse an einem Werk, das, gestützt auf anthropologische Belege, vom „Kampf zwischen blond und schwarz, zwischen nordischer Eigenart und anderem Rassentum“39 zu berichten weiß. Die SS-Zeitschrift begeisterte sich für Feststellungen wie: „Überwiegend blond in der älteren Zeit war das Herrenvolk der Griechen“ und „Im alten Rom unterschied sich das Herrenvolk der Patrizier schon äußerlich durch das blonde Haar von den Plebejern.“40 Mischehen zwischen beiden Kasten ließen die blonde Haarfarbe, ein bedauerlicherweise rezessives Merkmal, verschwinden, sodass die Römerinnen der Dekadenzzeit entweder ihre Haare entfärben oder Perücken aus dem Haar ihrer germanischen Sklaven tragen mussten, um die ursprüngliche Reinheit ihrer Vorfahren wiederzufinden. Diese haarigen Überlegungen fanden ihren Niederschlag in privaten Äußerungen Hitlers, in denen er sich über die Haarfarbe der Römerinnen ausließ.41
Neben dem Werk Sieglins stehen Arbeiten der größten Namen der Rassenanthropologie. Deren Untersuchung des archäologischen Materials unter Rassengesichtspunkten unterstützte die Arbeit von Althistorikern und Spezialisten für Rassenkunde des Altertums.
So arbeitete etwa Eugen Fischer mit Günther zusammen. Gemeinsam veröffentlichten sie 1933 Deutsche Köpfe nordischer Rasse42, eine Bild-Anthologie tadelloser deutscher Profile. Der gleiche Fischer wagte sich weiter auf das Feld der Alten Geschichte vor und veröffentlichte später Bücher zur Judenfrage im Altertum.43 Bereits 1933 arbeitete er aber an einem Gemeinschaftswerk deutscher Archäologen mit und steuerte seine anthropologische Sicht auf die in Mykene gefundenen menschlichen Überreste44 bei, die er einer detaillierten rassendkundlichen Interpretation unterzog.
Günther begnügte sich nicht mit der Bezugnahme auf Sprachwissenschaft, historische Anthropologie, Mythenkunde und Literaturwissenschaft. Im Gefolge Winckelmanns wandte er sich auch der Kunstgeschichte zu.
Immer wieder fügt er Büsten, Statuen und Porträts der Antike in seinen Text ein und unterzieht sie rassischer Diagnose. Die entsprechenden Illustrationen werden von knappen Legenden begleitet, die jeweils ein klares rassisches Urteil fällen. Die Fotos sind übrigens frontal oder im Profil bzw. im Dreiviertelprofil aufgenommen, so wie das in der Justiz-Fotografie seit Bertillon üblich war. So etwa auch Abbildung 18 auf Seite 34: „Unbekannte Hellenin (Dichterin). Nordisch“, oder etwa eine Sophokles-Statue, die ebenfalls die Rasse-Prüfung besteht: „Sophokles. Nordisch“45.
Die umfangreichen Anhänge am Ende des Werks enthalten Porträts, die genauer kommentiert werden. Es sind geradezu physiognomische Exegesen. Verwundert reibt sich der Leser die Augen angesichts der blühenden Phantasie, die am Werk ist, wenn Günther sich anschickt, aus der bloßen Betrachtung einer Plastik seine rassenkundlichen Schlüsse zu ziehen. Da kann dann eine Büste schon einmal so kommentiert werden:
„Eine ähnliche Ausgestaltung des Machtvoll-Erkennenden nordischer Rasse. Der rastlose Drang zum Überblick über Welt und Menschen, eine sich im Augenausdruck verratende gramvolle Erfahrung, ein gewisses stillhaltendes Entsagen, eine gewisse Enttäuschung über viel Unzulänglichkeit der Menschen um ihn – all solcher immer empfundener Drang und solcher nie abweisbarer Gram gebändigt zu einer großen Gelassenheit, welche im Umgang mit Menschen als Liebenswürdigkeit erscheinen kann; die Macht und Tiefe des Geistes in kennzeichnend nordischer Weise umhüllt von mühelos feinsinnigem Herrentum.“46
Die Analyse- und Schlussfähigkeiten, die Günther hier an den Tag legt, haben etwas fast Nekromantisches an sich: Tote und Statuen werden bei ihm endlos redselig. Doch was sich uns als hermeneutisches Delirium darstellt, ist für Günther nichts als die konsequente Anwendung des rassistischen Postulats: Der Phänotyp ist Ausdruck eines Wesensprinzips, des Bluts, dessen Eigenschaft den Körper, aber auch die Psyche modellieren. Vom Blut hängt alles ab: physische Beschaffenheit, Geist, kulturelle und künstlerische Leistungen einer Kultur. Der Schluss vom Körper auf den Geist und vom Geist auf den Körper ist also absolut berechtigt, denn beide Bestandteile leiten sich vom Blut her. Diese drei Wesenheiten definieren im Verbund die einheitliche und unentrinnbare rassische Identität.
Auch wenn die griechischen Männer und die nordische Virilität im Mittelpunkt dieses Diskurses stehen, so werden darüber die Frauen nicht vergessen. Günther stellt zu seiner Genugtuung fest, dass die Frauen-Darstellungen in der griechischen Kunst männliche Züge aufweisen.47 Das zarte Geschlecht habe im Epos etwas kräftig Männliches an sich. Dieser Vorrang des animus vor der anima ist nach Günther ein Charakteristikum der germanischen Frau, was einmal mehr die Herkunft der Griechen aus dem Norden beweise. Um seine These zu exemplifizieren, spricht Günther von Penelope, der Gattin des Odysseus, und von der Krieger-Göttin Athene:
„Penelopeia ist eine nordische Gestalt des 7. vorchristlichen Jahrhunderts […] Diesen Gestalten penelopeischer Art wie sie die persische und germanische Heldendichtung auch kennen, stehen wie in der germanischen Heldendichtung Gestalten von der Art der Walküren gegenüber […]. Athena, die ‚blonde, blauäugige Göttin‘ (Pindaros) ist streitbar bewaffnet wie eine Walküre.“48
Wie man sieht, wird hier in unblutigem mythologischem „Anschluss“ flugs der Olymp Walhalla angegliedert: Beide Mythologien sind Ausdruck der gleichen rassischen Substanz. Gleiches widerfährt den Amazonen, die – wie die beiden genannten weiblichen Gestalten – mit der Kriemhild des Nibelungenlieds verglichen werden.49 Der biologische Determinismus, die Auffassung vom Geist als Folge-Erscheinung des Bluts, dienten Günther dazu, eine Art mythenkundlichen Strukturalismus zu begründen, lange bevor die Bezeichnung Strukturalismus aufam.
Günther greift dagegen selten auf architektonische Vergleiche und Assimilationen zurück. Dieses Defizit glich sein Kollege Carl Schuchhardt aus. Dieser verfasste 1933 einen Artikel zur „Indogermanisierung Griechenlands“50. Für ihn sind die Megalith-Zirkel, die nur aus Steinen bestehenden Dolmen und Kuppeln, die man in Irland, England, in der Bretagne und in Griechenland findet, Beweise für die Herkunft der Griechen aus dem Norden. Laut Schuchhardt haben diese griechischen Gebäude „ihre Brüder und Vettern, oder besser gesagt, Väter und Onkel in Spanien, in Nordfrankreich, in Irland“51. Als guter Pädagoge bietet Schuchhardt, darin den SS-Schulungsheften ähnlich, seinem Leser eine klare Chronologie der indogermanischen Wanderungen nach Griechenland, auf denen der vorfindlichen autochthonen Bevölkerung indogermanisches Blut aufgepfropft worden sei: „Die erste, die ‚achäische‘ (weil sie die homerischen Achäer brachte)“, habe um 1800 vor unserer Zeitrechnung stattgefunden.52 „Um 1200 vor Chr. ist die zweite, die ‚dorische Wanderung‘ gekommen.“53
So wie alle anderen Autoren, die sich mit der Rassengeschichte Griechenlands befassen, versäumt es auch Günther nicht, darauf hinzuweisen, dass wir es in Griechenland mit einer Koexistenz von Rassenprinzipien zu tun hätten: Da gebe es zum einen die Ureinwohner, größtenteils Pelasgen, und zum anderen die Eroberer nordischer Rasse.54 So fänden sich in der griechischen Kunst Darstellungen des hyperboräischen Rassentyps, aber auch solche des Gegentypus, des Orientalen. Die Unterscheidung und Rangfolge der Rassen finde ihren materiellen Ausdruck in einem Dualismus der Künste: Da sei einerseits die edle Kunst, die der Marmorstatue, andererseits die gewöhnliche Kunst, die der Töpferei. „Die hohe Kunst zeigt sich im ganzen als nordischer Richtung und zugleich Darstellerin des nordischen Menschen nach leiblichen und seelischen Zügen“,55 während Kleinkunst und Kunstgewerbe vom westischen und orientalischen Rassentyp geprägt und praktiziert wurden, von „Fremdstämmige[n] (Metöken und Sklaven) […] zum größten Teil morgendländischer und kleinasiatischer Herkunft“56: Dieses unterschiedliche Rassenmaterial bringe unterschiedliche Kunstformen hervor, denn der Unterschied in der Erscheinungsform sei nun einmal Ausdruck spirituellen und mentalen Andersseins.