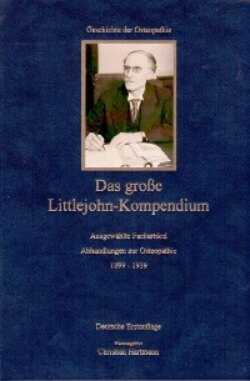Читать книгу Das große Littlejohn-Kompendium - John Martin Littlejohn - Страница 19
7. FIEBER
ОглавлениеVorlesung vor Studenten an der A.S.O.. Journal of Osteopathy (VI), 1900, S. 471–478.
Wir möchten gleich zu Beginn betonen, dass zwischen Temperatur und Fieberzuständen klar unterschieden werden muss. Zweifellos hat Graves Recht, wenn er sagt:
„Im gesamten Spektrum menschlicher Leiden gibt es keine Krankheit, die so außerordentlich interessant und bedeutend ist, wie Fieber.“
Ob in höchst zivilisierten oder in wenig entwickelten Ländern, in urbanen oder in ländlichen Regionen, in Berggegenden oder in flachen Gebieten: Fieber kommt überall vor – und über kaum einen Zustand kursieren derart wirre Meinungen wie über diesen. Die alten Ärzte sagten: Essentia vero febrorum est praeter naturam calamitas71, weil man sie gelehrt hatte, ein Symptom allein zu betrachten. Hautwärme oberhalb der normalen, der Gesundheit entsprechenden Temperatur galt als synonym für jenen fiebrigen oder pathologischen Zustand, der zu Fieber gehört. Vor allem in solchen Fällen muss aber mehr Gewicht auf die Ätiologie als auf die Symptomatologie gelegt werden. Sogar der berühmte Virchow definiert Fieber als „[…] jenen Körperzustand, in dem die Temperatur über den Normalzustand steigt.“ Obgleich wir Virchows unangezweifelte Autorität als Pathologe ersten Ranges anerkennen, weigern wir uns, diese Definition zu akzeptieren, denn hier wird offensichtlich Wirkung mit Ursache und Physiologie mit Pathologie verwechselt.
Es kann durchaus zu einer über den Normalzustand hinausgehenden Temperaturabweichung nach oben kommen, ohne dass es sich dabei um Fieber handelt. Extreme Kälte oder Hitze, der man über längere Zeit ausgesetzt ist, ständiger Aufenthalt in tropischen Regionen, exzessives Essen oder Trinken – insbesondere von Stimulanzien – sowie exzessive und lang andauernde Bewegung können die Temperatur verändern, ohne notwendigerweise einen fiebrigen Zustand hervorzurufen. Freilich können derartige Temperaturzustände sich zu einem Fieberzustand entwickeln, und die erhöhte Temperatur kann die Existenz eines Fieberzustands offenbaren, falls ein solcher existiert. Es besteht jedoch keine unbedingte Korrelation. Wenn also das Thermometer einen Temperaturanstieg anzeigt, ist das noch kein zuverlässiges Anzeichen für Fieber.
Dr. Soullier berichtet in einer neueren Ausgabe des Lyon Medical von dem Fall einer jungen Frau unter 30, bei der über drei aufeinanderfolgende Tage ein Temperaturanstieg auf 43,8° Celsius festgestellt wurde, ohne dass Fieber oder ein verstärkter Puls bestand. Ohne irgendeine vorhergehende hysterische Krankengeschichte verfiel sie plötzlich in den Zustand eines narkoleptischen Schlafs. Dieser Schlaf zeichnete sich durch seine Tiefe aus, der Puls war normal, die Glieder waren entspannt und die Pupillen verengt. Es bestand keine anomale Hauttemperatur, doch die vaginale Temperatur betrug 42,7° Celsius. Die Patientin erhielt ein zehnminütiges Bad von 28° Celsius. Dadurch fiel die Temperatur zwar zunächst auf unter 40° Celsius, stieg aber danach bald wieder auf über 43,8° Celsius. Die Hautflächen fühlten sich noch heißer an als zuvor, der Puls betrug 84. Die Patientin erhielt ein weiteres, 15-minütiges Bad von gleicher Temperatur wie beim ersten Mal. Ihre Körpertemperatur fiel dadurch auf etwa 37,8° Celsius, stieg aber am nächsten Tag erneut, diesmal auf 44° Celsius, und hielt an, bis die Patientin nach einem 36-stündigen Schlaf erwachte. Als sie die Augen aufschlug, hatte sie das Problem vergessen, das dem Beginn des Anfalls vorausgegangen war. Damals bestand weder Fiebrigkeit, noch anomaler Harnzustand, lediglich ein leicht beschleunigter Puls. Am vierten Tag erhielt die Patientin ein drittes Bad mit der gleichen Temperatur wie zuvor, worauf hin ihre Körpertemperatur auf 41,1° Celsius fiel. Am sechsten Tag senkte sich die Temperatur und lag nun leicht unter dem Normalzustand. Soullier betrachtet dies als einen Fall von reiner Hyperthermie ohne irgendwelche anderen Fiebersymptome. Weitere interessante Fälle reiner Hyperthermie im Zusammenhang mit dem Beginn eines Anfalls von Blutspucken und bei Simulation von Schüttelfrost, Meningitis, Peritonitis hat Cuzin dargestellt.
Ist die Temperatur eine fiebrige, steht sie diagnostisch für einen Fieberzustand. Wie kommt es zu dieser erhöhten Temperatur? Sie hat zweifellos mit dem Fehlen der Nervenkontrolle zu tun, die unter physiologischen Bedingungen die Gewebe vor exzessiven Oxidationsprozessen schützt. Bei Fieberzuständen findet diese Nervenkontrolle nicht mehr statt oder sie verliert zumindest ihr Gleichgewicht, was zu einem Temperaturanstieg führt, der die Nervenregulierung zerstört oder stört. Was aber zerstört, hemmt oder stört diese Nervenkontrolle? Möglicherweise Bakterien oder deren Produkte, die sich in den Geweben befinden oder ins Blut und von dort in die Nervenzentren gelangen, die sie dann durch irritieren. Oder die Gewebe sind in einem Krankheitszustand, sodass die reflektorische Irritation dieses Gewebezustands die Nervenzentren beeinflusst. Auch Traumata und Läsionen können die Nervenkraft des Flüssigkeitskreislaufs abschneiden, wodurch die Gewebe in einen fehlernährten Zustand geraten, der in einer vergleichbaren reflektorischen Irritation der Nervenzentren resultiert. Man hat z. B. festgestellt, dass septische Abflüsse von Wunden, Abszessen usf., die von der Nervensubstanz absorbiert werden, einen Temperaturanstieg hervorrufen können und dass die direkte Verletzung eines Nervenzentrums eine Fiebertemperatur herbeiführen kann – ohne irgendeine äußere Ursache. In beiden Fällen stört die resultierende Temperatur die gesunde Balance des Lebens und kann den Körperorganismus später in einen Fieberzustand versetzen.
Bei normalen Körperzuständen wird die Temperatur bei 37° Celsius gehalten. Diese konstante Stabilität hängt vom thermotaktischen Mechanismus ab, der die Generierung und den Verlust von Wärme reguliert. Bei der Wärmeproduktion spielen Muskeln und Drüsen die wichtigste Rolle. Am Wärmeverlust sind dagegen verschiedene physische und physiologische Prozesse beteiligt: Wärme wird in den Körperfunktionen und -aktivitäten verbraucht und der Überschuss durch Verdampfung, Ableitung, Konvektion usf. aus dem Organismus ausgeschieden. Die Regulation dieser Prozesse und insbesondere die Balance von Produktion und Verlust stehen unter der Kontrolle des Nervensystems, womit die thermischen Zentren, die thermischen Fasern und möglicherweise weitere Nerven gemeint sind. In pathologischen Zuständen wird dieser thermotaktische Mechanismus auf vielerlei Art gestört. So kann etwa der Wärmeverlust gehemmt oder modifiziert sein, was zum Wärmestau führt. Oder die Wärmegenerierung ist – bei normalem oder vermindertem Wärmeverlust – gesteigert, was ebenfalls in einer Wärmeakkumulation resultiert. Vermehrte Wärmegenerierung und vermehrter Wärmeverlust können gleichzeitig bestehen, ohne dass dies eine wesentliche Temperaturveränderung bewirkt, obgleich es zu einem fiebrigen Verfall kommt. Oder der Wärmeverlust hat sich – ohne erhebliche Veränderung bei der Wärmegenerierung – erhöht, was zu einer subnormalen Temperatur führt.
Es gibt eine ganze Reihe physiologischer Temperaturschwankungen, wie etwa die maximalen und minimalen Tagesveränderungen, wobei Letztere die zwischen zwei bis vier Uhr morgens eintretende Ebbe des Lebens und Erstere die Aktivitätsperiode während des Tages darstellt. Diese und andere bereits erwähnte Zustände dürfen den pathologischen Veränderungen nicht zugeordnet werden. Abweichungen, die sich nicht auf einer physiologischen Basis erklären lassen, sind als pathologisch zu betrachten. Man hat verschiedene Stufen pathologischer Temperatur nachgewiesen – subnormale, normale, schwach fiebrige, fiebrige, hyperpyretische Temperatur sowie Kollaps. Was den Gefahrenpunkt anbelangt: Er hängt nicht nur vom Temperaturanstieg, sondern auch vom Stadium des pathologischen Zustandes bzw. der Krankheit sowie von deren Dauer ab. Wir befassen uns hier nicht mit den verschiedenen Typen von Fieber, weil diese von der Differenzialdiagnose abhängen.
Ein Temperaturanstieg allein, das dürfte aus dem Gesagten klar geworden sein, stellt kein Fieber dar. Wärmeerzeugung im Körperorganismus beruht nicht allein auf einer Zunahme der Gewebeveränderungen. Der Wärmeanstieg kann auch durch Kohlehydratoxidation entstehen. Aus physiologischer Sicht kann ein Temperaturanstieg erfolgt sein, ohne dass die Exkretionen, die einen verstärkten Gewebestoffwechsel darstellen, zugenommen haben. Der eigentliche Indikator für Fieber ist vielmehr die Modifikation des Wärmesteuerungsmechanismus.
Zu den Phänomenen eines Fieberzustands gehört in erster Linie der Abbau von Gewebe. Sogar dann, wenn das Fieber nicht hoch oder lang anhaltend ist, kommt es zu einem großen Gewebezerfall, was auch zu einer Blutveränderung führt, die ihrerseits eine Störung der Gewebeaktivität sowie Flüssigkeitsschwund bedingt, der sich z. B. in Durst und wenig Harn äußert. Ein weiteres Symptom für den Fieberzustand ist die gesteigerte Pulsfrequenz, verursacht durch den Temperaturanstieg und andere Veränderungen. Bei manchen Fieberzuständen, wie etwa Meningitisfieber, ist der Pulsschlag nicht erhöht. Die beschleunigte Pulsfrequenz lässt sich nicht vollständig mit der Zunahme arterieller Spannung und verstärkter Frequenz des Blutflusses erklären. In der Anfangsphase des fiebrigen Zustands ist für gewöhnlich ein heftiger, starker Puls bei großer arterieller Spannung feststellbar. Später tritt dann meist eine Entspannung ein und der Puls wird weicher. In diesem Zustand ist der Pulsschlag schnell, der schnelle Herzschlag drückt das Blut in die Arterien, ohne bei jedem Schlag die Kammer zu leeren, wodurch sich die Blutzufuhr verringert, obgleich Herz- und Pulsfrequenz erhöht sind. Diese geschwächte Herztätigkeit kann mit jenem Temperaturanstieg erklärt werden, der zum Gewebezerfall führt. Gleiche oder ähnliche degenerative Veränderungen finden in der Leber und in den Nieren statt, was zu einem geschwächten Rhythmus dieser Organe führt. Der verstärkte Herzschlag wird begleitet von einer verstärkten Respirationstätigkeit, bedingt durch die enge Korrelation von Herz und Lungen im Kontext der großen rhythmischen Regulationszentren im Gehirn. Die Beschaffenheit des Blutes bei Fieber vermag direkt auf die respiratorischen Zentren zu wirken, oder die toxischen Elemente im Blut rufen eine indirekte Reizung hervor.
Besonders beachten sollte man die zerebralen Phänomene. Neuronale Erregung und deliriöse Zustände weisen nämlich oft auf die Existenz von Reizzuständen hin. Dass dies nicht ausschließlich auf einem Temperaturanstieg zurückzuführen ist, sieht man schon daran, dass bei bestimmten Fiebern bereits eine Temperatur von 39,4° Celsius mit mentaler Störung oder komatösen Zuständen einhergeht, während eine Temperatur von 40,5° Celsius oder 41,1° Celsius diese Zustände zuweilen nicht hervorruft. Liegen entsprechende Fälle vor, sind sie gekennzeichnet von Benommenheit und mehr oder weniger auch von Erschöpfung und mentaler Trägheit wie bei Typhusfieber. Teils ist das bedingt durch die Wirkung der erhöhten Temperatur auf die großen Nervenzentren im Gehirn, teils aber auch durch die sedierende Wirkung im System verbliebener, in die Gehirnzirkulation gelangter toxischer Elemente auf diese Zentren. Bei einigen Fieberarten wie etwa Scharlachfieber tritt das Gegenteil ein, das heißt: Die Nervenzentren sind exzessiv stimuliert, was zu einem starken Herz- und Pulsschlag, rhythmischen muskulären Kontraktionen und gefährlichen Delirium-Formen führt. In der Mehrzahl der Fälle ist die Temperatur sehr hoch und die Haut gerötet. Sobald die Gehirnzentren erschöpft sind, neigt der Patient dazu, in einen komatösen Zustand zurückzufallen, und dem Koma können sogar Gehirnspasmen vorausgehen. Bedingt ist das zweifellos durch ein toxisches Element, welches in Kombination mit der gestiegenen Temperatur die Wärmeregulation sowie jene Funktionen stört, die speziell mit dem thermotaktischen Mechanismus verbunden sind.
Es ist klar, dass Fieber nicht nur eine erhöhte Temperatur bezeichnet, sondern vielmehr einen systemischen Zustand, erkennbar am Temperaturanstieg, an der Zunahme kardialer und arterieller Pulsaktivität, an einem verstärkten katabolischen Gewebestoffwechsel sowie an einer aus der Ordnung geratenen Sekretion. All diese Zeichen oder Symptome hängen von der Unordnung des Wärmeregulationsmechanismus und anderer funktioneller Zentren des Körperprozesses ab, die durch entzündliche, traumatische oder septische Einflüsse bzw. deren Produkte hervorgerufen werden. Auf welche Weise auch immer, ins Blut gelangte septische oder toxische Stoffe sind die Hauptursachen von Fieberzuständen. Bei der Verzögerung des Blutflusses gerät das Blut schließlich in einen statischen Zustand, das dynamische Prinzip geht verloren und das Blut devitalisiert und wird toxisch. So eine Stase als Ergebnis einer Verletzung, einer mechanischen Läsion oder einer Störung der vasomotorischen Einflüsse, die den Blutfluss regulieren, kann lokal oder generalisiert auftreten. Handelt es sich um eine leichte Form eines solchen Zustands, mag die Vitalität noch ausreichen, um ihn zu überwinden, sodass sich kein Fieberzustand entwickeln kann. Genügt jedoch die Störung, um die Funktion derart zu verändern, dass es zu einer Stase kommt oder auf reflektorischem Weg die kardialen, respiratorischen, sekretorischen oder metabolischen Funktionen verändert werden, dann gelangen toxische Elemente ins Blut und durch den Blutkreislauf zu den Gehirnzentren. Der Blutdruck verändert sich und die Blutverteilung gerät durcheinander, sodass die oberflächlichen und kleineren Gefäße dilatieren und größeres Quantum erhalten als normal. Die Dilatation dieser Oberflächengefäße impliziert einen inhibierenden Einfluss auf die kontraktile Funktion, sodass die elastische Tendenz der Fasern in diesen Oberflächengefäßen von der Tendenz zu dilatieren überwältigt wird, was zu einer Hyperämie an der Oberfläche führt. Daraus entstehen eine lokale Stauung und ein Verlust an Vasotonizität, was wiederum ihrerseits die gesamte Zirkulation, das Nervensystem und die davon abhängigen Funktionen betrifft. Das Ausmaß dieser Störungen wird dann abhängig von der Differenzialdiagnose der verschiedenen Fiebertypen bestimmt.
Ist der Temperaturanstieg physiologisch oder pathologisch? Ich glaube, er ist physiologisch. Leben ist der Kampf um Existenz. Wird der Körper durch Krankheit, Trauma usf. in Erregung versetzt, gerät der normale Wärmeregulationsmechanismus in Unordnung – und zwar durch den Versuch, toxische Stoffe auszuscheiden. Bei normaler Gesundheit hält dieser thermotaktische Mechanismus die Körpertemperatur innerhalb normaler Grenzen, weil der menschliche Körper einen selbstregulierenden Mechanismus repräsentiert. Sobald jedoch toxische Elemente das Körpergleichgewicht zu stören beginnen, versucht der Körper, sich selbst auf dem höchstmöglichen Standard zu halten. Mithin kommt es von der physiologische Seite her zu einer Zunahme des Stoffwechsels. Ein Beweis für diesen Vorgang ist die Tatsache, dass man den Körper unter bestimmten Umständen an diese verstärkte Stoffwechselaktivität und die entsprechend erhöhte Temperatur anpassen und es ihm somit ermöglichen kann, die Krankheit innerhalb der Grenzen der Körpervitalität zu bekämpfen.
Die Temperatur kann jedoch pathologisch werden und eine exzessive Temperatur führt zu Wärmestarre. Todesursachen sind in diesem Fall die Koagulation der Muskelsubstanz und die exzessive Verstärkung des Stoffwechsels bis zum Punkt der Zerstörung, erkennbar an beschleunigtem Herzschlag, Dyspnoe und an den rapiden Veränderungen im Nervengewebe des Gehirns, die zu Koma, Bewusstseinsverlust sowie zum Verlust der Kontrolle über die Körperfunktionen im Allgemeinen führen. Unmittelbar nach der thermogenen Muskelstarre kann jede der z. B. im Blut oder am Herzen hervorgerufenen pathologischen Veränderungen zur Todesursache werden.
Ist Fieber physiologisch oder pathologisch? Es ist pathologisch, weil es die Summe einer Reihe von Zuständen darstellt, die erhöhte Temperatur, verstärkte Gewebedesintegration, beschleunigte Herztätigkeit oder verstärkte arterielle und sekretorische Aktivität mit einschließen. Miteinander kombiniert, bilden sie jene Summe an Kräften, die einer Integrität des Lebens und der vitalen Körperprozesse entgegenwirkt.
Im Lichte der Entdeckung thermogener und thermolytischer Zentren erscheint Fieber als pathologische Folge einer Reihe primärer und sekundärer Ursachen. Dazu gehören als primäre Ursachen u. a. Läsionen, Traumata, Behinderungen und als sekundäre Ursachen aktive Bakterien und ihre Produkte, wobei die giftige Substanz die Zentren zu vermehrter Aktivität stimuliert.72 Die Ergebnisse sind u. a. erhöhte Temperatur, beschleunigter Herzschlag, beschleunigte Atmung und beschleunigter Stoffwechsel. Experimente haben gezeigt, dass bakterielle Produkte künstlich Fieber erzeugen, wenn Gehirn und Rückenmark intakt bleiben. Ist dagegen das Gehirn hingegen abgetrennt, findet keine derartige künstliche Produktion statt. Bei künstlich hervorgerufenem Fieber zeigt sich sogar dann eine markante Erhöhung des respiratorischen Austausches von Sauerstoff und Kohlendioxid, wenn Anstrengungen unternommen werden, die Temperatur zu kontrollieren. Dies scheint zu beweisen, dass verstärkte Stoffwechselaktivität eines der Hauptphänomene bei Fieberzuständen bezeichnet.
Offenbar ist die erhöhte Temperatur also kein primärer Faktor im pathologischen Fieberzustand, sondern ein Symptom des verstärkten Stoffwechsels. Als solche repräsentiert sie den Versuch des Wärmeregulationsmechanismus, sich selbst zu schützen. Die Zunahme an Wärme entsteht dabei eher als ein Heilmittel, um die Bakterien oder ihre Produkte zu zerstören. Die günstigste Temperatur für die Keimentwicklung liegt etwas oberhalb der Körpertemperatur, bei 37,5° Celsius. Das Wachstum von Diphtherie- und Typhusfieberbazillen verzögert sich, sobald die Temperatur 38° Celsius übersteigt. Im Typhuskeim ist bei dieser Temperatur die Fermentation von Zuckersubstanzen unmöglich. Der Varizellen-Zoster-Keim kann durch den Einfluss einer Wärme von mehr als 39,4° Celsius zerstört werden. Pneumokokken schwächt eine Temperatur von 41° Celsius. In diesen Fällen stellt die Temperaturerhöhung also einen physiologischen Zustand oder den Versuch der Natur dar, sich gegen die Keimwirkung zu immunisieren.
Klemperer zufolge dient die erhöhte Temperatur aber noch einem anderen Zweck. Die Produkte der Bakterien oder der bakteriellen Aktivität haben auf die Gewebe einen immunisierenden Einfluss, der sich bei einer Temperatur von 40,5° Celsius verstärkt. In einer Reihe von Experimenten wurde das Serum von Tieren, die man durch künstliche Mittel immunisiert hatte, anderen Tieren mit einer Temperatur von 41° Celsius injiziert mit dem Ergebnis, dass die Temperatur innerhalb von 24 Stunden auf 37,5° Celsius sank. Demzufolge stellt die Pneumoniekrise jenen Punkt dar, an dem sich die von den Pneumokokken produzierten Toxine in solchen Mengen im Blutkreislauf befinden, dass sie in den Geweben Reaktionsprozesse auslösen, die ihrerseits genug antitoxische Stoffe erzeugen, um der Aktivität der Giftsubstanzen entgegenwirken zu können. Das Pneumotoxin oder das bakterielle Produkt ist die Ursache der Krankheit73 und erzeugt die erhöhte Temperatur. Das Antitoxin in Form einer in den Zellen gebildeten Proteinverbindung löst die Gegenwirkung gegen die Krankheit und die Reaktion zugunsten der Zerstörung der Pneumokokken aus. Dies zeigt, wie mir scheint, sehr deutlich, dass es möglich ist, durch reaktive, in den Gewebezellen – seien es nun Leukozyten oder tatsächliche Gewebezellen – bewirkte Veränderungen Immunität im Körpergewebe aufzubauen. In diesem Existenzkampf zwischen Bazillen und Gewebezellen wird die Produktion reaktiver Veränderungen, dank derer die Gewebezellen Proteine generieren, die wiederum die bakteriellen Gifte zerstören können, offenbar entscheidend von der Temperatur beeinflusst. Hier scheinen sich im Blutplasma bestimmte Substanzen zu befinden, welche die Bakterien, wenn sie mit ihnen in Kontakt kommen, lethargisch machen und in Verbindung mit den Produkten der Bakterien die von den Bazillen hervorgebrachten giftigen Substanzen neutralisieren.
Gelingt es der osteopathischen Behandlung, diese Aktivitäten durch das Nervensystem und das Blut zu stimulieren, während die erhöhte Temperatur ihre Rolle im Heilungsprozess der Natur spielt, haben wir gewiss ein mächtiges therapeutisches Mittel, um Fieberzuständen zu begegnen. In diesem Zustand besteht die wahre osteopathische Therapie in dem Versuch, die normale regulierende Funktion des thermotaktischen Mechanismus durch das Gehirn und die spinalen Zentren sowie über die Blutzufuhr und die Zirkulation wiederherzustellen. Sofern unsere Feststellungen physiologisch korrekt sind, ist die Behandlung im zervikalen Bereich zum Zwecke der Temperatursenkung die geeignete Vorgehensweise, insofern wir es lediglich mit erhöhter Temperatur zu tun haben. Handelt es sich dagegen um einen Fieberzustand, ist diese Methode kontraindiziert – es sei denn, sie dient nur als Hilfsmittel, um bei der Regulierung der Vasomotion zu unterstützen oder die Temperatur unter dem Gefahrenpunkt zu halten. Die Wärmezentren befinden sich im zervikalen Bereich und in der Medulla oblongata sowie in den basalen Anteilen des Gehirns. Der Versuch, sie direkt zu beeinflussen, hieße einen symptomatischen Zustand behandeln, während die Ursache – die jeweils vom Fiebertyp abhängt – unberührt bleibt.
Aus therapeutischer Sicht muss die Behandlung folgendermaßen aussehen: Beseitigung der Ursache oder der Ursachen sowie Erleichterung und Reduktion des Fieberzustandes in kontrollierbare Grenzen durch Regulation von Temperatur, Vasomotion, Zirkulation usf. Die Praxis der Medizin und der Osteopathie neigen dazu, sich lediglich mit Letzterem zu befassen. Zu den alten Praktiken der Medizin gehörte es, den Aderlass anzuwenden, um die Temperatur zu senken. Später nahm man dann zu purgativen, diaphoretischen und diuretischen Mitteln Zuflucht, um den vermehrten Abfall zu entfernen und die freie Gewebetätigkeit zu unterstützen – vor allem die Transpiration der Hautund Oberflächengewebe. Man führte Kaltwasseranwendungen durch, indem man den Patienten mehrmals in ein kaltes Bad setzte, um dem Körper Wärme zu entziehen und dadurch die Temperatur zu senken. Manche applizierten Alkohol in der Absicht, die Wärmeabstrahlung vom Körper zu fördern. Andere wiederum haben die Transpiration stimuliert, um die Schweißmenge zu erhöhen und auf diese Weise Wärme durch Verdampfung abzutransportieren.
Bei der Wirkung fiebersenkender Medikamente stellen wir Variationen fest. Chinin verwendete man in großen Dosen, um die erhöhte Temperatur zu blockieren. Es beeinflusst direkt die wärmeproduzierenden Gewebe. Eisenhut wurde benutzt, um die Fiebertemperatur aufgrund seiner sedierenden Wirkung auf die Zirkulation zu blockieren und auf diese Weise dem Fieber entgegenzuwirken. Eisenhut nützt aber nichts und erweist sich im Gegenteil bei Fällen wie Pneumonie, wo eine Krise zu erwarten ist, sogar als kontraindiziert, weil er dem, was die medikamentöse Behandlungsmethode hauptsächlich bezweckt – nämlich Aufrechterhaltung der Konstitution und Unterstützung der physischen Kraft, bis die Krise sich nähert – entgegenwirkt. Die therapeutische Wirkung von Eisenhut soll angeblich direkt auf den Herzmuskel zielen und so den Blutdruck senken, sowie auf die Respirationsmuskeln und dadurch die Atmungsaktivität vermindern. Man nimmt auch an, dass es bei Verabreichung von Eisenhut aufgrund der mit dem größeren Blutangebot in den entspannten Kapillaren zusammenhängenden verstärkten Wärmeabstrahlung zu einem Temperaturrückgang kommt, wozu auch Verdampfung bei der Dilatation der Kapillaren im Bereich der Schweißdrüsen beiträgt.
Aus osteopathischer Sicht befassen wir uns beim Behandeln von Fieber mit Leben, das den Existenzkampf und die vitalen Prozesse mit einschließt. Bei Temperaturerhöhung erfolgt ein rapider Schwund an Gewebesubstanz. Dies stört das Gleichgewicht der Funktionen – und nahezu alles kann diese Störung in Form von Unordnung, Krankheit, Gift, Blutstagnation usf. auslösen. Diese Funktionsstörung wird durch das Nervensystem zu den Gehirnzentren kommuniziert, denn alle vitalen Zentren befinden sich nahe beieinander und in Verbindung miteinander. Sobald das Gleichgewicht dieser Zentren aufgrund der Toxine im Blut kippt, werden die Zentren irritiert, woraus dann u. a. das Herz, den Puls und die Atmung betreffende Phänomene folgen. Wie sollen wir diesen Zustand beheben? Suchen Sie nach der primären Ursache über die Bestimmung der Fiebertypen. Versuchen Sie, die Produktion der toxischen Elemente einzuschränken, die das Blut vergiften und die anomale Aktivität der vitalen Zentren verursachen. Stellen Sie im betroffenen Bereich die normalen nutritiven Zustände wieder her, indem Sie die Knochen-, Muskel-, Nerven- und Blutbeschaffenheit so anpassen, dass sie wieder zur angemessenen Ernährung des betroffenen Teils beitragen. Halten Sie die ständige Zirkulation reinen Blutes aufrecht – und damit ist nicht nur das arterielle, sondern auch das venöse Blut gemeint, denn wenn das venöse Blut rein und normal ist, kann beispielsweise der Diphtheriebazillus nicht in ihm gedeihen. Die spezielle Anwendung dieser allgemeinen Punkte auf die Fiebertypen ist einfach, sobald eine physische Diagnose der Fieberursache erstellt wurde.
Wir fassen zusammen, dass eine erhöhte Temperatur physiologisch ist. Hinter dieser Fiebertemperatur finden wir eine Kette von Zuständen: Irritation der Nervenzentren, toxische Elemente, Blutstauung, Bakterien, Traumata oder Läsionen. Beim Versuch, die fiebrige Störung zu behandeln, die stets mehr oder weniger weit über den Organismus verbreitet ist, müssen wir die Läsionen entfernen, das Traumata heilen, die Bakterien töten, ihren Produkten entgegenwirken und auf diese Weise das Element des Missklangs eliminieren, das in die Nervenökonomie des Friedens, der Koordination und der Harmonie eingebrochen ist. Am erfolgreichsten kann dies die Osteopathie vollbringen.
ABB. 14: FAKULTÄT DER A.S.O. (1899)
Der wohl berühmteste Fakultätsjahrgang in der Geschichte der Osteopathie. In der oberen Hälfte finden Sie die nicht-akademischen Anhänger Stills ,reiner Lehre‘, die sogenannten lesionists, allen voran mit Arthur Hildreth (oben, 2. v.r.) und Stills Söhne Herman und Harry (2. Reihe) und in der unteren Hälfte sieht man die Akademiker, angeführt von John Martin Littlejohn (untere Reihe, 2. v.l.), seinen beiden Brüdern (unten, 2. v.r. und vorletzte Reihe rechts) und dem Arzt William Smith (vorletzte Reihe, links). Die Akademiker vertraten die Ansicht, dass die Osteopathie sich auch anderen Methoden öffnen müsse, solange sie den osteopathischen Prinzipien entsprächen, und wurden daher broadists genannt. Der Streit eskalierte, als John Martin Littlejohn zum Präsidenten der A.S.O. gewählt wurde. Schon bald darauf verließen die Littlejohns Kirksville im Jahre 1900 und gründeten das Chicago School of Osteopathy. A. T. Still hielt sich aus diesem Streit heraus und zwischen ihm und Littlejohn gab es in jener Zeit auch keine nachweisbaren Differenzen. Beide gingen stets respektvoll miteinander um.