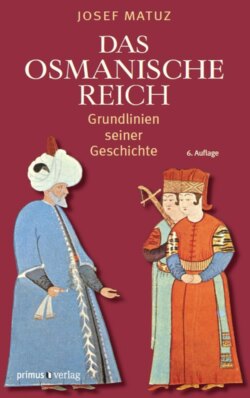Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 11
II. DIE ANFÄNGE DER TÜRKEN
ОглавлениеDie Geschichte der Türken im weiteren Sinne des Volksnamens läßt sich nur bis zum 6. Jh. unserer Zeitrechnung zurückverfolgen. Hinsichtlich der berichtslosen Zeit davor sind wir einstweilen auf Vermutungen angewiesen. Die gemeinsame ‘Urheimat’ der türkischen Völker dürfte sich auf das mittelasiatische Gebiet erstrecken, das von den Gebirgen Altai und Sajan an der sibirisch-mongolischen Grenze, Tienschan an der Grenze zwischen Sowjetisch- und Chinesisch-Turkestan, Altyn-Tag an der Nordwestgrenze Tibets und Chingan in Nordostchina eingefaßt wird. Von hier aus sollen die verschiedenen Türkvölker zu ihren späteren Wohnsitzen gezogen sein.
Hypothesen, wonach die europäischen oder die asiatischen Hunnen, letztere in den chinesischen Annalen unter der Bezeichnung Hiung-nu erwähnt, Türken gewesen seien, lassen sich mangels Überlieferung nicht nachweisen. Das gleiche gilt für die Juan-Juan, die asiatischen und auch für die europäischen Awaren.
So beginnt die eigentliche schriftlich festgehaltene Geschichte der Türken – T’u-küe werden sie in der betreffenden Quelle, den chinesischen Annalen, genannt – mit dem Jahr 552 n. Chr., als das erste – mit Sicherheit türkische – Staatswesen gegründet wurde. Es handelte sich dabei natürlich nur um einen mehr oder weniger losen Verband von Nomadenstämmen. Dieser erste türkische ‘Staat’ zerfiel jedoch bald nach seiner Gründung in einen östlichen Teil, der das Gebiet der späteren Mongolei umfaßte, und einen westlichen, der bis zum Oxus, dem heutigen Amu-Darja, und sogar zum Kaspischen Meer reichend mit Byzanz nicht nur eifrigen Seidenhandel pflegte, sondern mit dem Kaiserreich regelrechte diplomatische Beziehungen unterhielt. Im 7. Jh. gerieten beide ‘Teilstaaten’ unter chinesische Oberhoheit. 682 errichteten die östlichen Türken – auch Köktürken1 genannt – erneut ein Reich, das sich vom chinesischen Einfluß aber nicht ganz befreien konnte. Das Zentrum dieses Staatswesens lag im nördlichen Teil der heutigen Mongolischen Volksrepublik, am Orchon2, einem Nebenfluß der Selenga. Dieser alttürkische Staat wurde etwa um die Mitte des 8. Jh. durch den Einfall mittelasiatischer Türkvölker vernichtet.
An die Stelle der Köktürken trat 744 ein anderes Türkvolk, die Uiguren, die ersten Türken, die mit einer Hochreligion in Verbindung kamen: 762 nahm dieses bis dahin vermutlichschamanistische3 Türkenvolk den Manichäismus4 an. Der Staat der Uiguren bestand weniger als ein Jahrhundert: 840 wurden sie von den ebenfalls türkischen Kirgisen, die zuvor am oberen Jenissei lebten, aus ihrer Heimat verdrängt. Die Uiguren ließen sich dann um 840–860 im Tarim-Becken sowie jenseits der Gobi-Wüste in China nieder, wo sich jeweils ein neuer Staat herausbildete. Der bedeutendere hielt sich im heutigen Ostturkestan – mit Turfan5 als Mittelpunkt –, bis er 1028 von einem tibetischen Volk, den Tanguten, vernichtet wurde. Das andere uigurische Staatswesen wurde in Nordchina, etwa in jenem Gebiet errichtet, wo die heutige chinesische Stadt Kantschou liegt. In China gingen die ursprünglich nomadischen Uiguren zur seßhaften Lebensweise über. Sie vermischten sich mit der einheimischen Bevölkerung und schufen eine relativ gut entwickelte Agrarkultur. Weltoffen und tolerant, unterhielten sie intensive Beziehungen zu den meist buddhistischen Chinesen sowie zu anderen ebenfalls buddhistischen Völkern. Infolge dieser Kontakte nahm die überwiegende Mehrheit bis zum 11. Jh. den Buddhismus6 an, aber auch der Manichäismus konnte fortbestehen. Ein kleinerer Teil der Uiguren bekehrte sich zum nestorianischen7 Christentum. Die in Nordchina angesiedelten Uiguren wurden im 13. Jh. gezwungen, mit den Mongolen8 ein Vasallenverhältnis einzugehen; ihr Staat löste sich ein Jahrhundert später in Duodezfürstentümer auf, die mit der Zeit verschwanden.
Zu den Türkvölkern der Vergangenheit gehören die Chasaren, die zwischen dem 6. und dem 11. Jh. in Südrußland ein bedeutendes Reich errichteten, das insbesondere im Handel zwischen dem Norden und dem Orient eine wichtige Vermittlerrolle spielte. Im Chasarenreich lebten neben der westtürkischen Herrscherschicht die früher dort eingewanderten Ogurenvölker, deren Sprache vermutlich zur Gruppe der Türksprachen gehört, die in der wissenschaftlichen Literatur heutzutage ‘Bulgarisch-Türkisch’, nach anderer Auffassung ‘Chasarisch’ genannt wird. In religiöser Hinsicht waren die Chasaren recht tolerant: Die jüdische Religion, das Christentum und der Islam waren bei ihnen nebeneinander vertreten.
Eine wichtige historische Rolle spielten auch die Türken, die beim arabischen Vormarsch nach Transoxanien9 in Gefangenschaft gerieten und als Beute bzw. Tribut nach Bagdad kamen, wo sie Sklaven der abbasidischen Kalifen10 wurden. Aus diesen Türken, die sich als tüchtige Krieger erwiesen, wurden nun seit Anfang des 9. Jh. Sklaventruppen gebildet, die – ähnlich den Prätorianern in Rom – sich einen immer größeren Machtanteil sicherten.
Das erste türkische Volk, das in seiner Gesamtheit den Islam annahm, waren die sog. Karachaniden. Dieser Name ist von einem der Titel ihrer Herrscher abgeleitet, nämlich von Kara Chan, ‘schwarzer Chan, schwarzer Herrscher’. Das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Karachaniden lag am Fluß Talas in Innerasien. Nach der Annahme des Islams Anfang des 10. Jh. dehnten die Karachaniden ihr Staatsgebiet immer mehr aus, und es gelang ihnen, im Jahre 999 Buchara, die Hauptstadt der hochkultivierten iranischen Samaniden, zu erobern. Trotzdem kann man die Karachaniden nicht schlechthin als Kulturzerstörer ansehen, denn ihnen verdanken die Türken neben anderen Kulturleistungen das älteste islamisch-türkische Sprachdenkmal, einen Fürstenspiegel mit Namen ‘Kutadgu Bilig’ (‘Glücklichmachendes Wissen’). Auch der früheste türkische Philologe, der Karachanide Kaschgari, mit seiner ‘Diwan’11 genannten lexikographischen Glanzleistung ist hier zu nennen.
Die Karachaniden gerieten bald in Konflikt mit den Ghasnawiden12, einer ursprünglich türkischen Dynastie, die später fortschreitend iranisiert wurde. Der bedeutendste Herrscher des Ghasnawidenstaates, Sultan Mahmud (997–1030) war nicht nur ein großer Mäzen der persischen Literatur – der größte Epiker persischer Zunge, Firdausi (gest. um 1020), hielt sich zeitweilig an seinem Hof auf –, er trug als eifriger Muslim den heiligen Krieg sogar bis nach Indien hinein. Mahmud von Ghasna hielt die Karachaniden im Zaum, bis diese von den Kara Kitai, einem mongolischen Nomadenvolk aus China, in der ersten Hälfte des 12. Jh. unterworfen wurden.
1 D. h. ‘blaue’/‘himmlische’ Türken, wobei der Bedeutungsaspekt ‘himmlisch’ zweifellos den Sinn von ‘erhaben’ hat.
2 Hier wurden die in spezieller Runenschrift geschriebenen sog. Orchon-Inschriften aufgefunden, denen wir unsere Kenntnisse über die Orchontürken zum größten Teil verdanken.
3 Anhänger einer Naturreligion also, in der eine besondere Art von Stammeszauberern, die Schamanen, durch Praktiken wie Ekstase und Geisterbeschwörung versuchen, existentiell einschneidende Ereignisse wie Regen, Krieg, Krankheit, Tod usw. zu beeinflussen.
4 Von dem Perser Mani im 3. nachchristl. Jh. gegründete, heute erloschene Religion, die – synkretistisch – buddhistische, jüdische, christliche und zarathustrische Lehrsätze in sich aufnahm. Der dualistischen Grundeinstellung dieser Religion entsprechend werden uranfänglich zwei einander entgegengesetzte Substanzen: Licht (= das Gute) und Finsternis (= das Böse) angenommen. Lediglich die Erkenntnis besitzt die erlösende Funktion, obwohl – trotz dieses gnostischen Prinzips – in manichäischen Glaubensvorstellungen mythologische Elemente (Götter, Dämonen) reichlich vorhanden waren. Auch die Wiedergeburt nach dem Tode gab es in der Glaubenswelt der Manichäer. Erlösendes Ziel sollte das Aufgehen im Lichtreich sein. Die Organisationsform der Gläubigen war streng hierarchisch. Askese, Fasten und Beichte spielten in der manichäischen Religion eine überaus große Rolle.
5 Für die Geschichte der Uiguren stellen die hier aufgefundenen türkischen, chinesischen und iranischen sog. Turfantexte eine wichtige Quellengruppe dar.
6 Die Lehre dieser auf den meist Gautama genannten indischen Königssohn Siddhartha (um 560-um 480 v. Chr.) zurückgehenden Religion, deren Bezeichnung vom Ehrentitel des Religionsstifters Buddha (der ‘Erwachte’, der ‘Erleuchtete’) herrührt, kennt keinen ewigen, allmächtigen Gott, wohl aber zahllose vergängliche Gottheiten, deren Bedeutung allerdings nicht überbewertet werden darf. Die Hauptthese des Buddhismus ist die Vergeltungskausalität, d.h. die Macht der Taten (Karma), die die Kette der Wiedergeburten nach dem Tode in Gang hält. Durch Selbstbefreiung von Lastern soll der einzelne sich zu immer größerer Vollkommenheit vorarbeiten, bis das Nirvana, das Erlöschen individuellen Daseins, erreicht wird.
7 Anhänger des Nestorius (gest. 450), eines Patriarchen von Konstantinopel, der die vollständige Trennung der göttlichen und der menschlichen Person (und nicht lediglich der Natur) in Jesus Christus lehrte. Der Nestorianismus breitete sich bis nach China aus.
8 Es handelt sich um das gleiche, von Dschingis Chan (gest. 1227) gegründete mongolische Weltreich, dessen Truppen 1241 bei Liegnitz und Mohi ihre deutsch-polnischen bzw. ungarischen Gegner und zwei Jahre später die anatolischen Seldschuken vernichtend schlugen. Dschingis Chans Mongolen werden in Europa oft Tataren genannt, obwohl letztere den Türkvölkern angehören.
9 Zentralasiatisches Gebiet zwischen dem antiken Oxus (heute Amu-Darja) und dem Jaxartes (heute Syr-Darja).
10 Die Herrschaftszeit der abbasidischen Kalifendynastie währte von 749 bis 1258, dem Jahr der Eroberung Bagdads durch die Mongolen. Zwar gab es formell noch rund zweieinhalb Jahrhunderte abbasidische Kalifen in Ägypten; sie wurden jedoch völlig von den Mamluken bevormundet. Diesem abbasidischen Scheinkalifat setzte Selim I. mit der Eroberung Ägyptens 1517 ein Ende.
11 Der Terminus Diwan hat in der islamischen Welt zwei Hauptbedeutungen: 1. ‘Sammlung der Gedichte eines Dichters oder der Schriften eines Philologen’ und 2. ‘oberstes Verwaltungsorgan’, meist Ratsversammlung eines Staatswesens oder einer Provinz.
12 So bezeichnet nach der Hauptstadt Ghasna in Afghanistan, südwestlich von Kabul.