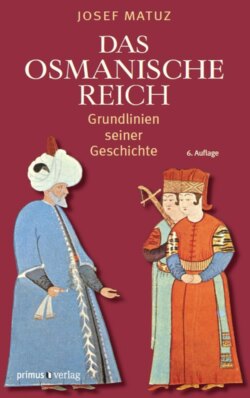Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 14
IV. ENTSTEHUNG UND ANFÄNGE DES OSMANENSTAATES 1. Die Vorgänger der Dynastie Osman
ОглавлениеEines der türkmenischen Kleinfürstentümer, die beim Zerfall des Reiches der anatolischen Seldschuken entstanden, war das osmanische Emirat. Von den Anfängen dieses Duodezfürstentums gibt es kaum gesicherte Kenntnisse. Berichte von Augenzeugen, die die Entstehung und die erste Zeit des Kleinstaates miterlebt und darüber berichtet hätten, sind nicht bekannt. Der Mangel an solchen zeitgenössischen Berichten ist sicher einfach darauf zurückzuführen, daß die Macht und das Ansehen der allerersten Osmanen so gering waren, daß es sich nicht lohnte, darüber nur ein Wort zu verlieren.
Erst später, als sich das Osmanenhaus eine gewisse Machtfülle angeeignet hatte, erschien es höfischen Historikern der Mühe wert, die Anfänge ihrer Herren und Brotgeber näher zu ergründen. Die einzelnen Berichte decken sich freilich nicht immer, sie widersprechen sich oft.
Unter den zahlreichen Türkmenenfürstentümern gab es damals nicht wenige, die sich mit den Osmanen messen konnten, ja sogar noch bedeutender waren, wenn man nur an Germiyan, Hamit, Saruhan, Aydin, Menteşe oder Eretna denkt. Wenn dennoch gerade die Frühgeschichte des osmanischen und nicht etwa eines anderen Emirats an dieser Stelle besonders herausgearbeitet werden muß, so deshalb, weil der Kleinstaat der Osmanen die Keimzelle für die spätere osmanische Weltmacht bildete. Die hervorragende Leistung der Osmanen ist gerade darin zu sehen, daß sie aus so unbedeutenden Anfängen heraus ein zeitweilig zu den stärksten Weltmächten zählendes Imperium zu begründen vermochten. Diese ersten Anfänge der Osmanen sind sagenumwoben, panegyrisch ausgeschmückt und durch verschiedene Traditionen unterschiedlich überliefert. Einer dieser Darstellungen, die mehr oder weniger plausibel erscheint, wollen wir hier folgen:
Die Osmanen sollen demnach zum Oghusenstamm Kayı gehört haben. Ein Angehöriger dieses Stammes, ein gewisser Süleyman Schah, soll der Padischah, der ‘Großkönig’ von Mahan, einem Ort in der Nähe von Merw1, gewesen sein; wahrscheinlich handelte es sich um einen einfachen Stammeshäuptling. Als diese Gegend von den Mongolen Dschingis Chans verwüstet wurde (1221), soll Süleyman mit seinem Volk2 westwärts gezogen und nach Ostanatolien gekommen sein, wo er mit seinen Leuten im Gebiet um Erzincan nomadisierte. Zeitweilig entstand östlich des Siedlungsgebiets der Türkmenen Süleymans ein politisches Vakuum: Dschingis Chans Tod (1227) hinderte die Mongolen vorübergehend daran, ihre Expansion nach Südwesten fortzusetzen. Zur gleichen Zeit fügten die anatolischen Seldschuken dem mächtigen Choresm-Schah3, der damals Westpersien beherrschte, eine schwere Niederlage zu. Das Zusammentreffen dieser Umstände ermöglichte es Süleyman, mit seinen Leuten aus dem unwirtlichen ostanatolischen Gebirgsland ostwärts, in Richtung des fruchtbaren Zweistromlandes zu ziehen. Beim Überqueren des Euphrat nahe Aleppo um das Jahr 1231 ertrank Süleyman.4 Sein Stammesverband fiel daraufhin auseinander. Einige seiner Leute zogen nach Syrien, andere kehrten nach Anatolien zurück.
Einer der vier Söhne Süleymans, Ertoğrul (gest. 1281?), begab sich mit einer kleinen Schar in das Gebiet östlich von Erzurum, wo man eine geraume Zeit nomadische Viehzucht betrieb. Angeblich wegen der Verdienste, die er sich bei der Abwehr der Mongolen erwarb, wurden dem Häuptling Ertoğrul durch den rumseldschukischen Sultan Alaeddin Kaikubad I. neue Weidegründe zugewiesen: Diese lagen bei Söğüt, in der Nähe von Eskişehir. Wahrscheinlich bezweckte diese Maßnahme zweierlei: Der Seldschukenstaat selbst sollte einerseits von dem unruhigen Türkmenenhäuflein freigehalten werden, andererseits konnten Ertogruls Leute dazu beitragen, die Pufferzone zu bevölkern, die das Reich der Seldschuken von den ‘Ungläubigen’ des Kaiserreichs Nizäa trennte.
Ertoğrul gelangte über seine ursprüngliche gesellschaftliche Stellung nicht hinaus: Er war und blieb Häuptling eines in sozialer und ethnischer Hinsicht vorerst einheitlichen kleinen Hirtenstammes, der nach wie vor den Namen Kayı trug. Das Nomadendasein scheint in dem neu zugewiesenen Gebiet allerdings ein Ende gefunden zu haben, denn hier begegnen uns bereits unverkennbare Züge der Transhumanzwirtschaft: Der Stamm weidete sein Vieh im Sommer auf der Alm (yaylak), im Winter auf der Winterweide (kişlak).
Ertogrul soll ein friedliebender Stammeshäuptling gewesen sein, dem jeglicher religiöser Fanatismus abging. Seine Toleranz gegenüber den benachbarten Christen ging angeblich so weit, daß er sie sogar vor seinen eigenen Glaubensgenossen, den Türkmenen aus Germiyan oder den Tataren, schützte.