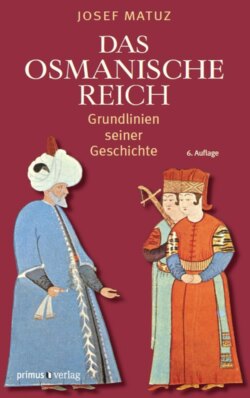Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 15
2. Vom Emirat zum Sultanat
ОглавлениеWährend die Angaben über die osmanische Frühzeit nicht nur spärlich, sondern auch höchst widersprüchlich sind, liegen über die Herrschaftszeit Osmans5 (1281?–1326) schon wesentlich genauere Informationen vor. Der schon über Dreißigjährige wurde nach dem Tode seines Vaters Ertogrul Häuptling des Stammes. Anfänglich war Osmans Macht wohl kaum größer als die des Vaters. Osmans Stamm war so klein, daß er alle seine schwer zu transportierenden Habseligkeiten beim benachbarten christlichen Seigneur6 zur Aufbewahrung hinterlassen konnte, wenn er im Sommer auf die Alm zog.
Osman muß im Gegensatz zu seinem Vater zu den aktiven Glaubenskriegern gehört haben, denn er führte den Beinamen Ghasi, den man damals nur erhielt, wenn man es sich zum Lebensziel machte, den Islam mit Waffengewalt zu verbreiten. Osman war zweifellos ein frommer Muslim; hierauf deutet die Tatsache, daß er die Tochter des Vorstehers einer Derwischgemeinschaft, eines gewissen Scheich Edebali, heiratete. Dem besonders tapferen Osman folgten nicht nur die eigenen Untertanen widerspruchslos, auch viele Türken der benachbarten Gebiete stießen zu ihm, um sich an seinen erfolgreichen militärischen Aktionen zu beteiligen. Mit dem Zulauf einer großen Zahl von Kriegern stellte sich Osman eine neue Aufgabe: Aus dem Häuptling eines unbedeutenden Hirtenstammes entwickelte sich eine Art Kondottiere, der zusammen mit seinen beutehungrigen Kampfgefährten ständig in Kleinkriege verwickelt war. Obgleich er Glaubenskrieger war, hatte er auch mit den islamischen Rivalen in der Umgebung Auseinandersetzungen. Auch konnte er sich gegebenenfalls den christlichen Nachbarn gegenüber pragmatisch verhalten; ja seine Beziehungen zu dem einen oder anderen waren ausgesprochen herzlich, wie etwa zu dem byzantinischen Herrn von Bilecik oder zu einem anderen Burgherrn namens Köse Mihal, der später zum Islam übertrat. Durch den starken Zuzug von Kriegern wurde nicht nur der Rahmen des ethnisch einheitlichen Stammes gesprengt; tiefgreifende soziale Veränderungen wurden sichtbar. Konnten sich die Stammesangehörigen ursprünglich auf der Grundlage der eigenen Viehzucht ernähren, so reichte diese eigene Produktion für den Unterhalt der neu hinzugekommenen Berufskrieger nicht mehr aus. Letztere waren – sie hatten dem beschwerlichen Hirtendasein ein für allemal den Rücken gekehrt – darauf angewiesen, sich Beute zu verschaffen: So wurde der Krieg zur Dauererwerbsquelle. Daß die Kämpfe zugleich als ‘Heiliger Krieg’ deklariert werden konnten, war der Sache nur um so dienlicher. Im Laufe solcher kriegerischer Auseinandersetzungen konnte Osman sein anfänglich mehr als bescheidenes Herrschaftsgebiet rasch ausdehnen: Melangeia, das spätere Karacahisar (westlich Eskişehir), İnegöl, Bilecik, Yenişehir wurden rasch nacheinander eingenommen. Dabei wurde die Methode der ‘verbrannten Erde’ angewandt, zumal den Osmanen zu dieser Zeit noch keine Belagerungsgeräte zur Verfügung standen: Das Umland der einzelnen Städte wurde verwüstet und entvölkert, so daß diese kapitulieren mußten. Osman war schon fast 60 Jahre alt, als er 1317 den Oberbefehl seinem Sohn Orhan übertrug. Osman konnte noch erleben, wie das Vorfeld von Brussa (heute Bursa) erobert wurde. Er starb 1326, vermutlich kurz vor der Eroberung dieser bedeutenden byzantinischen Stadt nahe am Marmarameer.
Die Bedeutung Osmans für die osmanische Geschichte kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Denn er war es, der aus der von Ertoğrul ererbten Stammesführerschaft ein regelrechtes Staatswesen entwickelte. Es war kein Zufall, daß nicht nur die Dynastie nach Osman benannt wurde, sondern schließlich auch der Staat, den er gründete. Schon kurz nach der Eroberung von Karacahisar ließ sich Osman im freitäglichen Kanzelgebet (hutbe) namentlich erwähnen; er erhob somit Anspruch auf die Anerkennung als souveräner Herrscher, denn gerade die Erwähnung des Herrschers im Kanzelgebet galt nach islamischer Rechtsauffassung – neben dem Münzrecht – als wesentlicher Ausdruck der Souveränität. Eine gewisse Abhängigkeit gegenüber den Ilchanen blieb wohl dennoch bestehen, da die Osmanen bis in die Mitte des 14. Jh. hinein – wie auch die anderen anatolischen Emire – Steuern an die mongolischen Oberherren zahlten. Des Einflusses der rumseldschukischen Schattensultane scheint Osman sich hingegen schon völlig entledigt zu haben.
Auch im Hinblick auf die Ausgestaltung der inneren Struktur des Osmanenstaates wurden während der Herrschaftszeit Osmans die Weichen gestellt. Die Wurzeln des späteren – so gut durchdachten und durchorganisierten – osmanischen Feudalsystems reichen zweifelsohne in die Zeit Osmans zurück. Die damaligen Eroberungen warfen nicht nur reichlich Beute ab, es fielen Osman und seinen Gefährten auch ausgedehnte, bebaute Ländereien in die Hände. Die Eroberer waren nun aber keine Hirtennomaden, die das eroberte Land für ihre extensive Viehzucht benötigt hätten. Osmans Leute, alle Berufskrieger, waren an einer Abschaffung des Ackerbaus in den eroberten Gebieten nicht interessiert. Selbst die aus militärtaktischen Gründen zeitweilig verwüsteten Regionen bevölkerten sich bald wieder, als bekannt wurde, daß Osman die Bauern und die Agrarwirtschaft respektierte. Osman vergab aus dem Fundus der eroberten Ländereien große Domänen an Verwandte oder Militärführer; aber auch Ghasis wurden je nach Verdienst belehnt. Aus der Schar der Krieger, die bisher lediglich einen Anteil an der Beute erhalten hatten, konnte allmählich eine feudale Mittelschicht werden. Die Entwicklung vom Hirtenstamm zu einem Staatsgebilde mit festem Territorium rief tiefgreifende Veränderungen im Militärwesen hervor; an die Stelle der bisher dominierenden Streifzüge trat nun die Gebietsverteidigung, die ihrerseits ein hierarchisch geordnetes, permanentes Berufsheer anstelle des früheren Stammeskriegertums erforderlich machte. So wird es verständlich, daß gerade Osman – der sich nunmehr als Emir bezeichnen ließ – einen Oberkommandierenden für das Heer, den Beglerbeg (beglerbegi, später beylerbeyi) einsetzte.
Das erheblich gewachsene Staatsgebiet Osmans konnte nicht mehr – wie bisher geschehen und wie auch bei den anderen anatolischen Emiraten üblich – nur gewohnheitsrechtlich auf Stammesebene regiert werden. Eine staatliche Verwaltung war nunmehr dringend erforderlich. Freilich konnte sich zur Zeit Osmans noch keine fest institutionalisierte Administration herausbilden, wenngleich sich gewisse Elemente – sozusagen als Vorstufe einer Berufsbürokratie – bereits damals herauskristallisierten. Neben dem gerade genannten Beglerbeg berief Osman schon nach der Eroberung von Bilecik einen Kadi sowie einen weiteren, dem Beglerbeg unterstellten Militärführer (subaşi), der in Friedenszeiten neben militärischen Aufgaben polizeiliche Funktionen zu erfüllen hatte.
Befehle und Entscheidungen im Rahmen der staatlichen Verwaltung wurden in der Regel mündlich erteilt und weitergegeben. Mit Klagen wandte man sich sehr häufig persönlich an den Fürsten, der in solchen Fällen selbst Recht sprach und sich auch sonst höchstpersönlich um sämtliche Belange des Emirats kümmerte. Bei einigen wenigen Angelegenheiten, die einer schriftlichen Fixierung bedurften,7 fungierten umherreisende Ulemas als Gelegenheitskanzlisten, insbesondere bei Schenkungen von Domänen und Stiftungen, bei denen ja die Rechtsgültigkeit über den Tod des Emirs hinaus garantiert werden mußte.
Die Weidegründe um Söğüt, die Ertoğrul Osman seinerzeit hinterlassen hatte, waren wohl kaum größer als 1500 qkm: ein Gebiet, höchstens doppelt so groß wie die Fläche des Bodensees. Das Fürstentum, das Osman seinem Sohn Orhan (1326–1360) vererbte, umfaßte hingegen schon über 18.000 qkm und war damit etwa so groß wie Rheinland-Pfalz oder fast die halbe Schweiz.
Die territoriale Expansion des jungen Osmanenstaates setzte sich auch unter Orhan fort. Zunächst wurden die beiden wichtigen byzantinischen Städte Nizäa (İznik) um 1331 und Nikomedia (İzmit) 1337 eingenommen; das nach dem Zwischenspiel des lateinischen Kaiserreiches 1261 wiederhergestellte Byzantinische Reich war unter anderem wegen einer chronischen Überschuldung des Staatshaushaltes außerstande, den Osmanen militärischen Widerstand zu leisten. Gleichzeitig mit den Operationen gegen die byzantinischen Territorien wurde unter Orhan mit der Einverleibung der benachbarten anatolischen Emirate begonnen. Karesi, westlich von Osman, war das erste Opfer. Es dauerte immerhin ein ganzes Jahrzehnt (1335–1345), bis die Eroberung dieses von inneren Wirren geplagten Kleinfürstentums abgeschlossen war. Mit der Annexion dieses Fürstentums erlangten die Osmanen einen Zugang zum Ägäischen Meer. Von Europa trennte sie nur noch der in byzantinischer Hand verbleibende Bereich der Dardanellen.
Die innere Zwietracht in Byzanz gab Orhan die Möglichkeit, sich in die Angelegenheiten dieses mächtigen Nachbarn einzumischen. Orhan setzte geschickt auf einen byzantinischen Thronprätendenten, auf Johannes Kantakuzenos. Er verbündete sich 1346 mit ihm, heiratete dessen Tochter noch im selben Jahr und verschaffte dem Schwiegervater den byzantinischen Thron. Johannes Kantakuzenos seinerseits gab Orhan (und nicht etwa einem der beiden ebenfalls ans Ägäische Meer grenzenden Duodezfürstentümer Saruhan oder Aydın) nicht nur deshalb den Vorzug, weil dieser der nächste Nachbar war; zweifellos versprach er sich von den kometenhaft aufsteigenden Osmanen effektivere militärische Hilfe als von den anderen türkmenischen Kleinfürstentümern.
Schon bald nach der Thronbesteigung seines Schwiegervaters leistete ihm Orhan mit einem kleineren Truppenkontingent gegen die Serben Beistand. Als der Serbenkönig Duschan dann 1349 Saloniki überfiel, half Orhan auf Bitten des Basileus – dies war der Titel der byzantinischen Kaiser – mit einer 20.000 Mann starken Hilfstruppe unter dem Oberbefehl seines eigenen Sohnes, des tüchtigen Süleyman Pascha, aus. Dieses militärische Unternehmen war insofern bemerkenswert, weil hier zum ersten Mal Türken in größerer Anzahl tief auf europäisches Gebiet vorrückten.8 Die osmanischen Truppen kehrten zwar, nachdem sie die Gegend um Gallipoli (Gelibolu) verwüstet und das belagerte Saloniki entsetzt hatten, wieder nach Kleinasien zurück; die osmanische Staatsspitze dürfte aber gerade dank dieser Militärexpedition erkannt haben, daß eine Expansion auch im Südosten Europas durchaus im Bereich des Möglichen lag. Als es im Byzantinischen Reich erneut zu Thronwirren kam, fiel es den Osmanen nicht schwer, unter Süleyman Paschas Leitung im Jahre 1353 mit Cympe (Çimenlik9) einen Brückenkopf auf europäischem Boden in Besitz zu nehmen. Ein Jahr später fielen den Osmanen das damals von einem Erdbeben heimgesuchte und dadurch wehrlose Gallipoli sowie große Teile der Nordküste des Marmarameers nebst Rodosto (Tekirdag) in die Hände. In diesen durch die Naturkatastrophe entvölkerten Gebieten faßten immer mehr Türken Fuß, nicht nur aus dem Fürstentum Osman, sondern etwa auch aus den Emiraten Aydın und Saruhan. Mehrere Kleinfürstentümer entstanden in diesem Raum: Yakup, Hacı Ilbeyi, Bedreddin, ähnlich wie ein Jahrhundert früher in Westanatolien, nur daß sie von Anfang an mehr oder weniger von den Osmanen abhängig waren. Das Ghasitum blühte in Rumelien – wie die Osmanen den Balkan bezeichneten – wieder auf, wie zuvor in Kleinasien. Einen besonderen Einfluß erlangten wieder die Derwische auch dann, wenn Kadis und mehrere subaşı als Vorposten der osmanischen Zentralregierung eingesetzt wurden.
In Kleinasien konnte ebenfalls ein bedeutender Erfolg verbucht werden: Süleyman Paschas Truppen gelang es im Jahre 1354, Ankara einzunehmen, eine Stadt, die nominell zwar zum Herrschaftsbereich des zentralanatolischen Emirats Eretna10 gehörte, in der jedoch de facto die dortige ahi-Gemeinschaft tonangebend war, ein Umstand, der noch Folgen haben sollte.
Als Orhan 1360 starb, zählte sein Land zu den bedeutendsten Kleinfürstentümern in Anatolien: Es umfaßte etwa 75.000 qkm und war damit mehr als viermal so groß wie bei Beginn der Herrschaft Orhans, fast so groß wie das heutige Österreich. Aber auch der Ausbau des Staatsapparats ist bemerkenswert. Es herrscht in der Forschung keine Einigkeit darüber, ob dabei das seldschukische Erbe oder aber der Einfluß von Byzanz das ausschlaggebende Vorbild war; immerhin wurde nicht nur in Brussa und in anderen mehr oder weniger friedlich übernommenen byzantinischen Städten, wie Nikomedia oder Nizäa, ein intakter Verwaltungsapparat vorgefunden, sondern auch die Hofhaltung und Staatsverwaltung des byzantinischen Kaisers, des Schwiegervaters von Orhan, dürften auf den Emir und seine Gefolgschaft einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben.
Wie dem auch sei, Orhan ging in der machtpolitischen Verselbständigung einen Schritt weiter als Osman. Hierbei war ihm die fortschreitende Auflösung des Reichs der Ilchane, der bisherigen Oberherren, besonders dienlich. So hat ihn niemand mehr daran gehindert, nach der Einnahme Brussas im eigenen Namen Münzen prägen zu lassen. Er praktizierte also neben dem Kanzelgebet auch das zweite der islamischen Souveränitätsinsignien. Unter den Osmanen wird man zudem bei ihm das erste Mal mit dem Titel eines selbständigen islamischen Monarchen konfrontiert: Er ließ sich als Sultan11 bezeichnen, auch wenn nach den islamischen Rechtsvorstellungen mehr oder weniger usurpatorisch, ohne daß ihm dieser Titel vom Kalifen verliehen worden wäre.
Bei der Größenordnung, die das Land der Osmanen inzwischen erreicht hatte, konnte der Herrscher sich nicht mehr um sämtliche Staatsgeschäfte selbst kümmern; ein gewisses Delegieren der Macht war unvermeidlich geworden. Mit dem Theologen Alaeddin Pascha12 wurde zunächst ein Wesir ernannt. Nach dessen Tod 1333 (?) übernahm Orhans eigener Sohn, der bereits erwähnte Süleyman Pascha (1333?–1357), dieses Amt. Der Wesir hatte vorerst eher eine beratende denn eine exekutive Funktion; er durfte sich auch nicht in militärische Angelegenheiten einmischen. Diese sowie die oberste Lenkung der Staatsverwaltung oblagen nach wie vor dem Beglerbeg. Als konsultatives Gremium stand dem Herrscher und seinem Wesir der Diwan (Staatsrat) zur Verfügung. Auch die spätere Provinzialeinteilung bildete sich zu Orhans Zeiten aus. Die eroberten Städte mit dem jeweils angrenzenden Land wurden hohen Militärführern, den sog. Sandschakbegs13 zugewiesen, denen somit neben dem Truppenkommando eine neue Aufgabe zufiel: Entsprechend den Direktiven des Staatsoberhaupts hatten sie in ihren Provinzen – nunmehr Sandschak genannt – für die Aufrechterhaltung der Ordnung auch im nichtmilitärischen Bereich Sorge zu tragen. Diese Verschmelzung von Militärwesen und Zivilverwaltung blieb im Osmanenstaat über Jahrhunderte erhalten. Zur Rechtsprechung wurden in den Städten Kadis eingesetzt, ausschließlich Vertreter der islamischen Orthodoxie. Neben dieser nüchternen, rationalistischen Religiosität war die sufisch gefärbte Heterodoxie der Ghasis insbesondere in Rumelien einflußreich.
Auch das Militärwesen wurde während Orhans Herrschaftszeit weiter ausgebaut. Es wurde erwähnt, daß der Stammesverband bereits unter Osman zerfiel und daß man allmählich dazu überging, bewährte Krieger mit Pfründen zu belehnen. Dies geschah auch unter Orhan; dazu aber stellte man auch besoldete Fußtruppen (yaya oderpiyade) und eine ebenfalls besoldete Reiterei (müsellem14) auf, um die Schlagkraft der Armee zu erhöhen. Die Angehörigen dieser Fuß- wie Reitertruppen erhielten allerdings nur während der Feldzüge Sold. Im Frieden konnten sie ihnen eigens zugewiesene Bauernhöfe (çiftlik) bewirtschaften, ohne dabei die sonst üblichen Abgaben leisten zu müssen.
An die Stelle Orhans trat der jüngere Sohn Murat I. (1360–1389), da der ältere, Süleyman Pascha, frühzeitig verstorben war. Der etwa 35jährige Murat hatte keinen leichten Stand, als er den Thron bestieg. Denn die ahi- Gemeinschaft in Ankara, das erst vor einem halben Jahrzehnt in den Osmanenstaat eingegliedert worden war, nahm den Thronwechsel zum Anlaß, um ihre Stadt der osmanischen Herrschaft zu entziehen.15 Warum es eigentlich zu dieser Auflehnung der ahi kam, ist noch nicht geklärt; es ist nicht auszuschließen, daß die Osmanen auch in Ankara wie überhaupt ein zu straffes Regiment geführt hatten und die ahi sich deshalb in ihren Privilegien beeinträchtigt fühlten. Die ahi wurden bei dieser Revolte von den Karamanen unterstützt, für die der schnelle Aufstieg der Osmanen eine immer bedrohlichere Gefahr darstellte. Murat fiel es trotzdem nicht schwer, den Widerstand zu brechen und seine Herrschaft in Ankara zu festigen. Nachdem er den Rücken in Anatolien frei hatte, konnte er die Expansion in Thrazien, einer Balkanlandschaft zwischen dem Unterlauf der Maritza und dem Rhodopegebirge, fortsetzen. Dazu bot sich auf dem Balkan eine besonders günstige politische Konstellation: Byzanz war durch einen permanenten Bürgerkrieg geschwächt. Der Tod des ehrgeizigen Serbenkönigs Stefan Duschan (1355) – er strebte nach dem oströmischen Thron – hatte gleichzeitig eine feudale Zersplitterung im Gebiet der Slawen zur Folge.
Unter diesen Umständen war es nicht verwunderlich, daß es dem Beglerbeg Lala Şahin 1361 gelang, die zweitwichtigste byzantinische Stadt, Adrianopel (Edirne), einzunehmen. Kaum vier Jahre später verlegte Murat I. den Sultanssitz von Bursa in diese Stadt; von dieser Zeit an hatte im Osmanenstaat die europäische Reichshälfte eine größere Bedeutung als die asiatische. Byzanz selbst konnte seine Selbständigkeit noch wahren: Für die junge osmanische Militärmacht waren die starken Verteidigungsanlagen der Metropole am Bosporus vorerst noch ein unlösbares Problem. Es blieb beiden Mächten nichts anderes übrig, als sich vorerst auf eine friedliche Koexistenz zu einigen: Byzanz entrichtete dem Sultan Tribut und als Gegenleistung versorgten die Osmanen die Stadt mit Getreide, weil diese nur noch über wenig Hinterland verfügte. Lala Şahin führte übrigens den Reisanbau in den europäischen Gebietsteilen des Osmanenstaates ein; anfangs war es jedoch nur Muslimen erlaubt, Reis anzubauen.
Da nun dem osmanischen Eroberungsdrang kein nennenswertes Hindernis mehr im Wege stand, konnte die Expansion nordwärts fortgesetzt werden; 1363 fiel Philippopel (Plovdiv) in die Hände der Osmanen. Papst Urban V. spielte daraufhin mit dem Gedanken an einen Kreuzzug; einem solchen Unterfangen war aber wegen des allgemeinen Desinteresses der abendländischen Mächte kein Erfolg beschieden.16 Die Stadt Ragusa (Dubrovnik) beeilte sich sogar, mit dem Sultan einen Handelsvertrag abzuschließen.
Im Jahre 1371 bekamen die Serben die Macht der Osmanen zu spüren: Die vereinigten Heere der serbischen Teilstaaten wurden an der Maritza entscheidend geschlagen. Mit diesem Sieg fiel den Osmanen Mazedonien zu. In den achtziger Jahren wurden Saloniki und Sofia eingenommen. Als sich Murat I. jedoch zu Feldzügen in Anatolien aufhielt, gelang es den Heeren der vereinigten slawischen Balkanvölker (Bulgaren, Serben und Bosnier), ein bedeutendes osmanisches Heer am Fluß Wardar zu vernichten. Der osmanische Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten; bald darauf mußten sich die Bulgaren den Osmanen unterwerfen und die osmanische Oberherrschaft akzeptieren. 1389 erschien dann Murat auf dem Amselfeld17 (Kosovo Polje) und stellte sich der verbündeten serbischen, bosnischen, bulgarischen und albanischen Streitmacht. Diesmal waren nicht nur in Europa stationierte osmanische Kontingente auf dem Schlachtfeld, der Sultan brachte auch anatolische Hilfstruppen mit. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der christlichen Koalitionstruppen trug die straff geleitete osmanische Armee den Sieg über die zusammengewürfelten gegnerischen Einheiten davon. Serbiens Schicksal war damit besiegelt: Es sank zu einem Vasallenstaat der Osmanen herab. Murat war es nicht beschieden, diesen militärischen Erfolg auszukosten. Ein serbischer Einzelkämpfer hatte ihn noch während oder kurz nach der Schlacht erdolcht.
Eine bedeutende Erweiterung des osmanischen Staatsgebiets wurde während der Herrschaftszeit Murats auch in Kleinasien vorgenommen. Als Methode der Expansion diente hier nicht nur die bewaffnete Auseinandersetzung; auch auf friedlichem Wege wurden bedeutende Gebietsteile für den Osmanenstaat erworben. Der Machtgewinn in Europa und das damit verbundene Ansteigen des Ansehens des osmanischen Herrschers stellten hierfür eine günstige Ausgangsposition dar. Murat verheiratete seinen Sohn Bayezit mit einer Prinzessin von Germiyan, wodurch der größte Teil dieses Fürstentums den Osmanen zufiel (1381). Sieben Jahre zuvor hatte die osmanische Staatsspitze schon ein anderes Emirat erwerben können: Der Fürst von Hamit hatte sich bereit erklärt, für bares Geld, achtzigtausend Goldstücke, denjenigen Gebietsteil seines Staates abzutreten, der früher zum Fürstentum Eşref gehört hatte.18 Die Osmanen gerieten dadurch in die unmittelbare Nachbarschaft der Karamanen, deren Staatswesen ebenfalls einen rapiden Aufschwung genommen hatte. Die Tatsache, daß Murats Sohn Savci, Gouverneur, d.h. Sandschakbeg von Bursa, sich um 1385 gegen den Vater auflehnte, kam den Karamanen wie gerufen. Trotz ihrer Unterstützung war Savcı dem Vater aber nicht gewachsen. Murat schlug den Rebellen in Anatolien bei Konya vernichtend.19 Bei dieser Auseinandersetzung setzte Murat erstmalig in der osmanischen Militärgeschichte Kanonen ein.
Aus dem kleinen osmanischen Fürstentum war unter Murat I. ein stattlicher Staat geworden: Beim Tode des Sultans 1389 erstreckte er sich – die tributpflichtigen Länder nicht hinzugerechnet – über 260.000 qkm, ein Territorium, um einen aktuellen Bezug zu nennen, größer als das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. So ist es kaum verwunderlich, daß der Herrscher nunmehr ständig den Titel Sultan – oder mit einem persischen Wort Hudavendigar (‘Herrscher’) – führte.
Die bedeutenden Gebietserweiterungen machten weitere Schritte im Ausbau der inneren Organisation des Staates erforderlich. Die Tatsache, daß das Hauptgewicht der Staatsmacht eindeutig beim Militär lag, zeigte sich auch darin, daß das wichtigste Amt der zivilen Rechtspflege mit dem entsprechenden militärischen Posten verbunden wurde: Anfang der sechziger Jahre wurde – übrigens nach seldschukischem Vorbild – ein Heeresrichter (kadiasker oder kazasker) ernannt, der zugleich oberster Richter des Osmanenstaates war. Als erster wurde Çandarli Kara Halil (Hayreddin) mit diesem neugeschaffenen Amt betraut. Die oberste richterliche Instanz war bisher der Kadi von Bursa gewesen. Waren in der Urteilsfindung bisher lediglich das Religionsgesetz und gegebenenfalls das Gewohnheitsrecht (örf) verwendet worden, so ging man nun dazu über, für Fälle, für die das Religionsgesetz keine Bestimmungen hatte, ‘weltliche’ Gesetze (kanun) zu erlassen. Auch in der Staatsverwaltung kam es zu einer bedeutenden Änderung. Hatte der Wesir bisher lediglich eine beratende Funktion innegehabt, so übertrug Murat zwischen 1381 und 1387 seinem neuernannten Wesir die Leitung der Staatsverwaltung. Dieser neue Wesir war Çandarlı Kara Halil, der bisherige Heeresrichter, der beim Überwechseln in das Wesiramt zugleich auch den Titel Pascha erhielt. Wesir und Pascha blieben von jetzt an bis ins 16. Jh. hinein Synonymbegriffe. Die oberste militärische Führung hatte weiterhin der Beglerbeg inne. Um jedoch den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde 1385 für die Belange der europäischen Gebietsteile ein zweiter Beglerbeg ernannt: der ‘Beglerbeg von Rumelien’.20 Die Zuständigkeit seines Amtskollegen beschränkte sich nunmehr auf Anatolien, der fortan die Amtsbezeichnung ‘Beglerbeg von Anatolien’ trug. Da die europäische Reichshälfte eine größere Bedeutung besaß, erhielt der Beglerbeg von Rumelien das Oberkommando über die osmanische Gesamtarmee. In diese neue, höchste militärische Funktion wurde der bewährte Çandarlı Kara Halil, der bisherige Wesir, eingesetzt.
Auch das Timar-System erhielt unter Murat I. 1368 seine definitive Gestalt. Es wurde gesetzlich verankert, daß nunmehr jeder bewährte Krieger Anspruch auf eine Kleinpfründe (timar21) geltend machen konnte. Als Gegenleistung hatte er als belehnter Reitersoldat (spahi) zu dienen. Für höhere militärische Ränge führte Murat 1375 die Großpfründen (ziamet22) ein. Erst später wurden auch Zivilbeamte Nutznießer des zunächst exklusiv militärischen Timar-Systems. Die Kriegsbeute blieb seit der allgemeinen Einführung des Timar-Systems für die Belehnten nur noch ein freilich höchst willkommenes Zubrot. Auf diese Weise kam eine besondere Form des Feudalismus zustande, die ähnlich wie das entsprechende seldschukische System erhebliche Abweichungen gegenüber dem europäischen Lehnswesen aufweist. Da dieses System noch ausführlicher erörtert wird, soll hier nur hervorgehoben werden, daß die zugewiesenen Domänen keine Lehen, sondern Pfründen waren. Die Nutznießer konnten von ihren Bauern lediglich eine festgesetzte Rente beanspruchen, hatten über die betreffenden Personen jedoch keine Verfügungsgewalt. Die Pfründen waren ferner nicht erblich; abgesehen davon, daß sie jederzeit zurückgezogen werden konnten, fielen sie mit dem Tod des Inhabers automatisch dem Fiskus zur Neuvergabe zu. Das Timar-System fand vor allen Dingen in den europäischen Besitzungen des osmanischen Staates eine breite Verwendung, wo die vormaligen christlichen Grundherren ihre Besitzungen bei der Eroberung durch die Osmanen in der Regel verließen. In den vereinnahmten vormaligen Kleinfürstentümern in Anatolien blieb der Privatbesitz (mülk) an Boden bis auf weiteres vorherrschend.
Zu den bereits vorhandenen Waffengattungen, den Spahis, den müsellem, den yaya und den akinci, einer unbesoldeten, halbregulären leichten Reiterei, deren Hauptaufgabe in der Beunruhigung des Feindes bestand, gesellten sich wahrscheinlich seit der Zeit Murats I. die später so gefürchteten Janitscharen23. Diese neue Fußtruppe war eine Art Fremdenlegion. In den ersten Zeiten behielt die Hohe Pforte24 ein Fünftel der jugendlichen Kriegsgefangenen25 zu ihrer Verfügung und ließ diese bei türkischen Bauernfamilien in Anatolien umerziehen. Die jungen Fremden mußten dort so lange in der Landwirtschaft arbeiten, bis sie das Türkische hinlänglich beherrschten. Danach wurden sie dem Truppendienst zugeteilt, wo sie in einer eigens zu diesem Zweck errichteten Einheit, dem acemi ocaği (‘Rekrutentruppe’), eine harte Ausbildung erhielten. Im Gegensatz zu den anderen Waffengattungen blieben die Janitscharen auch nach der Ausbildung in den Kasernen und mußten sich einer harten Zucht unterwerfen. Sie durften nicht heiraten, es war ihnen sogar jegliche sexuelle Betätigung verboten. Die Quartiere der Janitscharen wurden zu Zentren des Sufitums, das jene bis zur Besessenheit und zu lebensverachtender Verwegenheit trieb. Die Janitscharen waren dem Sultan besonders ergeben. Sie folgten dem Herrscher auf Schritt und Tritt und bildeten somit vorerst eine Art Leibgarde. Die Aufstellung einer derart hart disziplinierten, kasernierten und daher ständig und ohne Zeitverlust einsatzbereiten Truppe war eine bahnbrechende Errungenschaft im osmanischen Heereswesen, mit der die Osmanen der europäischen Militärentwicklung erheblich voraus waren.
Einem weiteren, geradlinigen Aufstieg des Osmanenstaates schien nun auch in der Folgezeit nichts mehr im Wege zu stehen. Denn das Land der Osmanen hatte sich in rund einem Jahrhundert nicht nur zu einer weit über seine Grenzen hinaus bedeutenden Macht entwickelt, ihm stand mit Murats I. Ableben in der Person Bayezits I.26 (1389–1402) wiederum ein Herrscher vor, der sich seinen Vorgängern durchaus ebenbürtig erwies. Der neue Sultan hatte sich schon zu Lebzeiten seines Vaters durch schnelle, unerwartete Eroberungszüge hervorgetan, was ihm den Beinamen Yıldırım, d.h. der ‘Blitz’, einbrachte. Auch auf dem Amselfeld hatte er sich – als Befehlshaber des rechten Flügels – ausgezeichnet.
Bei der Thronbesteigung ließ Bayezit I. seinen Bruder Yakup hinrichten, um keinen Zweifel an seinem Herrschaftsanspruch aufkommen zu lassen. Damit wurde eine Praxis eingeführt, die bei der Dynastie Osman bis ins 17. Jh. hinein weiterlebte.
Bayezit, der ‘Blitz’, setzte die Eroberungspolitik seiner Vorgänger an beiden Fronten fort, in Europa und in Anatolien. Zunächst hatte er allerdings mit einem Aufstand fertig zu werden, der in Anatolien auf die Nachricht von Murats Tod hin entbrannt war; die Karamanen hatten wieder einmal die Hand im Spiel. Auch diesmal aber blieb ihnen der Erfolg versagt. Bayezit gelang es zunächst in den Jahren 1391–1392, das mächtigste Emirat Westanatoliens, Aydın, wie auch alle übrigen Emirate dieser Region, Saruhan, Menteşe, Hamit und Germiyan, seinem Herrschaftsgebiet einzuverleiben. Anschließend unternahm er gegen den Urheber der obenerwähnten antiosmanischen Verschwörung, das Fürstentum Karaman, eine Strafexpedition. Konya, die Hauptstadt der Karamanen, wurde belagert. Die Stadt konnte mit Rücksicht auf die Kräftebildung, die durch die neuen politischen Entwicklungen in Rumelien nötig wurde, zwar nicht eingenommen werden, der Friedensvertrag mit den Karamanen erkannte jedoch sämtliche neuen Eroberungen Bayezits in Kleinasien an.
Wie Serbien war auch Byzanz nur noch ein Vasall des Osmanensultans. Mit dem Paläologen27 Manuel II. (1391–1425) bestieg indes ein Kaiser den byzantinischen Thron, der nicht länger bereit war, diesen Zustand hinzunehmen. Zu Beginn seiner Regierungszeit genoß Manuel II. zwar noch Bayezits Wohlwollen, er nützte jedoch den gerade erörterten anatolischen Feldzug des Sultans geschickt aus, um sich von ihm loszulösen. Zunächst nahm der byzantinische Herrscher Saloniki und Teile Mazedoniens wieder in Besitz. Die Walachei und Bosnien verbündeten sich ihrerseits mit dem mächtigen König von Ungarn und brachten Gebiete südlich der Donau – so etwa auch die gesamte Dobrudscha – unter ihre Kontrolle.
Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung verließ Bayezit I. Anatolien. Er eilte an die europäische Front und eroberte – getreu seinem Beinamen – in kürzester Zeit die Territorien zurück, die ihm in Südosteuropa abgenommen worden waren. 1393 wurde dazu noch Bulgarien dem osmanischen Staat einverleibt. Die Walachei mußte sich 1394 mit dem Status eines Vasallen abfinden. Nun machte sich Bayezit daran, Konstantinopel zu erobern. Zu diesem Zweck ließ er 1395 eine starke Festung mit Namen Anadolu, Hisarı (‘Anatolische Festung’) auf dem asiatischen Ufer des Bosporus erbauen. Die Belagerung der Stadt mußte jedoch, wenn auch nicht ganz eingestellt, so in ihrer Intensität doch stark eingeengt werden: Von den Nordwestgrenzen, von dem in seiner Macht ungebrochenen Königreich Ungarn drohten Gefahren. Der magyarische König und spätere deutsche Kaiser Sigismund organisierte 1396 einen Kreuzzug gegen die Osmanen. Den aus ganz Europa herbeiströmenden Kreuzrittern war jedoch kein Erfolg beschieden; ihr Heer erlitt Ende September 1396 bei Nikopolis an der Donau eine verheerende Niederlage, woraufhin osmanische Stoßtrupps mordend und brandschatzend bis nach Griechenland und Syrmien vordrangen. Auf diesen Erfolg hin soll der abbasidische Scheinkalif in Kairo, al-Mutawakkil II., dem Osmanenherrscher offiziell den Titel Sultan des ‘Römerlandes’ (= Rum) verliehen haben.
Den Umstand, daß den Osmanen alle Hände durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa gebunden waren, nutzten wiederum die Karamanen, um ihrem Rivalen Ankara erneut zu entreißen. Nachdem Bayezit aber durch den Sieg in Europa seine Handlungsfreiheit zurückgewonnen hatte, wandte er seine Militärmacht gegen die Feinde im Osten. Die Karamanen erlitten 1397 eine derart katastrophale Niederlage, daß ihr Staat auseinanderfiel und der größte Teil seines Gebiets dem Osmanenstaat angegliedert werden konnte.
Auch das vormalige Emirat Eretna fiel den Osmanen in der Folgezeit zu. Kadi Bürhaneddin (1381–1398), ein hochgebildeter Mann, der sich auch als Literat betätigte, hatte sich nämlich vom Posten eines Kadis zum Nachfolger der Emire von Eretna aufgeschwungen und war eine der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten unter den anatolischen Kleinfürsten geworden. Bei einer bewaffneten Auseinandersetzung mit dem im angrenzenden Gebiet nomadisierenden türkmenischen Stammesverband namens ‘Weißer Hammel’ (Akkoyunlu) verlor Bürhaneddin jedoch sein Leben, woraufhin seine Untertanen das Land den mächtigen Osmanen übergaben.
Dem osmanischen Eroberungsdrang schienen keine Grenzen mehr gezogen zu sein. Nunmehr wurden sogar Gebiete besetzt, die – wie Malatya oder Elbistan – bisher dem allerdings an schweren inneren Zersetzungserscheinungen krankenden Mamlukenreich gehörten. Als Bayezit im Jahre 1400 bei weiteren Unternehmungen auch Erzincan an sich riß, stieß er mit der Macht Timurs zusammen, als dessen Einflußbereich dieses Gebiet galt.
Auf die Auseinandersetzung mit diesem mächtigen Gegner konzentrierte sich nun der Osmanensultan. Er mußte 1401 die Belagerung von Konstantinopel nun ganz abbrechen, die sechs volle Jahre gedauert haben soll. Er schloß mit Kaiser Manuel II. einen Frieden, der der schwer bedrängten Stadt am Goldenen Horn neue Zugeständnisse abverlangte. Byzanz mußte sich zur Abtretung weiterer Gebiete und zu erneuten Tributzahlungen verpflichten. Außerdem mußte die Kaiserstadt hinnehmen, daß innerhalb ihrer Mauern eine Moschee für die muslimischen Einwohner errichtet und ein Kadi eingesetzt wurde. Um den Handel zu beleben, erteilte Bayezit I. den Genuesen und Ragusanern für das Gebiet des osmanischen Staates weitgehende Handelsprivilegien.