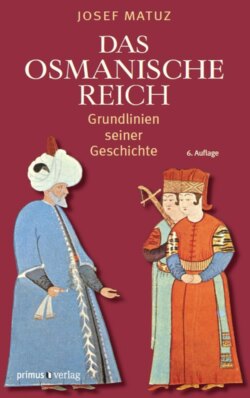Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 12
III. DIE SELDSCHUKENZEIT 1. Großseldschuken und anatolische Seldschuken
ОглавлениеDie Vorgänger der Türken im Gebiet der heutigen Türkei standen mit den zuletzt genannten Völkerschaften in keinerlei Verbindung. Sie stammten von den Oghusen ab, einem nomadisierenden Türkvolk, das noch im 10. Jh. größtenteils in der heutigen Kasachensteppe (nördlich vom Kaspischen Meer, dem Aral- und Balchasch-See) umherzog.
An der Spitze eines oghusischen Stammesverbandes namens Kinik, der weiter südlich, am unteren Lauf des Syr-Darja, nomadisierte, stand ein Häuptling namens Selcuk. Dieser nahm um 970 samt seinen Untertanen den Islam an, trat in den Dienst der persischen Samaniden in Buchara – ihr Staat erstreckte sich auf Ostpersien – und ließ sich mit seinen Leuten in der Gegend der Hauptstadt nieder. Mit der Bekehrung dieser oghusischen Kınık zum Islam war eine Grundentscheidung für die Herausbildung des späteren Osmanenstaates getroffen.
Als die Macht der hochkultivierten Samaniden durch die Karachaniden im Jahre 999 gebrochen wurde, war die Zeit für die Nachkommenschaft des genannten Häuptlings Selcuk, für die Seldschuken gekommen. Die Brüder Çağrı Beg Davud und Toğrıl Beg Mohammed (etwa 1037–1063) eroberten an der Spitze ihrer nomadischen Reitertruppen blitzartig riesige Gebiete. Sie setzten sich zunächst in der Landschaft Chorasan fest. Dann wandte Çağrı seine Waffen gegen die Ghasnawiden, die er 1040 vernichtend schlug.
Für die Geschichte des Osmanischen Reiches sind jedoch die Eroberungen Toğrıls viel wichtiger: Seine Kriegszüge richteten sich gegen Westen. Nischapur, die Landschaft Choresm, Hamadan und Isfahan fielen nach und nach in die Hände der von ihm befehligten Nomaden. Dies wiederum entging nicht der Aufmerksamkeit des Abbasidenkalifen al-Kaim. Er war der seit mehr als einem Jahrhundert währenden Bevormundung durch die schiitische Dynastie der Bujiden überdrüssig und rief Toğrıl nach Bagdad. Im Jahre 1055 zog dieser im Sitz des Kalifats ein. Bald darauf erhielt Toğrıl Beg vom Kalifen den Titel Sultan verliehen. Das künftige Reich der Großseldschuken1 war damit etabliert.
Auf die historischen Ereignisse, auf Wirtschaft, Kultur und Staatsverwaltung der Großseldschukenzeit soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Für unsere Fragestellung ist lediglich von Bedeutung, daß auch das Byzantinische Reich die militärische Macht der Seldschuken bald zu spüren bekam.
Anatolien gehörte vor der türkischen Eroberung größtenteils zum Byzantinischen Reich. Dies bedeutete aber nicht, daß Kleinasien, wie die anatolische Halbinsel ebenfalls bezeichnet wird, in seiner Gesamtheit einen hohen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand aufgewiesen hätte und durchweg in hohem Maße urbanisiert und völlig hellenisiert gewesen wäre. Schon aus geomorphologischen und klimatischen Gründen war es in Anatolien nicht überall möglich, Ackerbau zu treiben. Gebiete, die sich dafür eigneten, waren allerdings dicht besiedelt, wobei die Bauernschaft vorwiegend aus Griechen, Armeniern und eingewanderten Slawen bestand. Die für die Bebauung ungeeigneten Gebietsteile waren nur dünn besiedelt und auch nur schwach hellenisiert; sie wurden meistens von einer zahlenmäßig schwachen Grenzbevölkerung verteidigt, den sog. Akritai. Diese christlich-orthodoxen Grenzer, vorwiegend armenischer Abstammung, waren nicht nur fanatische Glaubenskrieger, sondern strebten auch begierig nach Beute und Ruhmestaten. In Armenien, das heute nur mit seiner westlichen Hälfte zur Türkischen Republik gehört, spielten nichtarmenische Bevölkerungsgruppen keine Rolle; in diesem Gebiet hatten damals ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit verschiedene selbständige, rein armenische Königreiche bestanden, die nun von Byzanz unterworfen worden waren. Ebenfalls rein armenisches Siedlungsgebiet war das sog. Kleinarmenien in Kilikien, der Mittelmeerküstenlandschaft im Südosten Anatoliens.
Schon Ende der 20er Jahre des 11. Jh. unternahmen türkmenische Reiter – in den islamischen Quellen werden die islamisierten Oghusen Türkmenen genannt – einen Beutezug in das armenischbyzantinische Grenzgebiet, in dem sich seit den 40er Jahren derartige Überfälle dann zusehends häuften. Sie sollten schließlich das Ende der Herrschaft von Byzanz in Anatolien zur Folge haben. Alp Arslan (1063–1072), ein Neffe und zugleich der Nachfolger Toğrıl Begs, schlug 1071 bei Manzikert2 die byzantinischen Streitkräfte. Kleinasien wurde in den folgenden Jahren von den Türkmenen überflutet. Sie stellen in ethnischer Hinsicht im wesentlichen die Urahnen des türkischen Bevölkerungsteils der heutigen Türkei dar.
Das Reich der Großseldschuken war nicht von langem Bestand, da das Staatswesen viel zu sehr auf die Person eines starken Herrschers ausgerichtet war. Sobald es keinen Sultan mehr gab, der ohne Widerspruch die Macht ausüben konnte, wurden Auflösungserscheinungen sichtbar. Kaum war Melik Schah, Alp Arslans Sohn und Nachfolger, 1092 nach wenigen Wochen seinem Wesir, dem großen Organisator und Wissenschaftsförderer Nizam al-Mulk, in den Tod gefolgt, tauchten bereits mehrere Prätendenten für die verschiedenen Teile des Seldschukenreichs auf. Die tatkräftige Regierungsführung Mohammeds (1105–1118), eines Sohnes von Melik Schah, konnte diesen Zersetzungserscheinungen nur vorübergehend Einhalt gebieten. Sandschar (1118–1157), Bruder und Nachfolger Mohammeds, vermochte seine Herrschaft nur noch in Chorasan zu behaupten. Nach seinem Tode kam es dann auch hier sehr schnell zur Auflösung des Staatswesens. Das Reich der Großseldschuken zerfiel endgültig in sich gegenseitig befehdende Duodezfürstentümer. Es bildeten sich die Machtbereiche der Chorasanseldschuken, der Kermanseldschuken, der syrischen, der irakischen und der anatolischen Seldschuken, deren Schicksal hier von besonderem Interesse ist.
Aus der türkmenischen Besiedlung Anatoliens nach der Schlacht von Manzikert gingen mehrere Kleinfürstentümer hervor: Die Danischmendiden errichteten ihren Staat um Malatya, die Mengutschekiden am Oberlauf des Euphrat, die Saltukiden im Gebiet von Erzerum, dem heutigen Erzurum, und die Ortokiden in der Gegend von Mardin.
Am wichtigsten für den weiteren Verlauf der Geschehnisse in Kleinasien war eine weitere Staatsgründung, die eines Seldschukenprinzen in Westanatolien: Er hieß Süleyman und war ein entfernter Verwandter Alp Arslans. Dieser Süleyman arbeitete sich aus verhältnismäßig bescheidenen Verhältnissen empor. Er war anfangs Heerführer des Sultans der Großseldschuken in Westanatolien. In den 70er Jahren des 11. Jh. erweiterte er das von ihm beherrschte Gebiet innerhalb kürzester Zeit, wobei er sich zunächst mit dem Byzantinischen Reich arrangierte. Aus der Herrschaft Süleymans entstand nach und nach das Sultanat der anatolischen Seldschuken. Dieses neue Staatswesen mußte sich gegen Byzanz und das östlich gelegene Emirat der obenerwähnten Danischmendiden behaupten. Doch die Seldschuken brachten den Byzantinern 1176 bei Myriokephalon3 eine vernichtende Niederlage bei und liquidierten nur zwei Jahre später (1178) auch das danischmendidische Fürstentum. Als die Kreuzfahrer des vierten Kreuzzuges zusammen mit den Venezianern Konstantinopel 1204 eroberten, war für die Seldschuken Kleinasiens die Bedrohung durch Byzanz endgültig gebannt. Als machtpolitischer Höhepunkt der Geschichte der auch als Rumseldschuken4 bezeichneten anatolischen Seldschuken kann zweifellos die Herrschaftszeit des Sultans Alaeddin Keikubad I. (1220–1237) bezeichnet werden. Das Reich – mit der Hauptstadt Konya – besaß nun seine größte Ausdehnung, von Ostanatolien bis tief in den Westen Kleinasiens hinein. Nur das byzantinische Kaiserreich Nikaia (Nizäa) in Westanatolien, das – ebenfalls byzantinische – Kaiserreich Trapezunt an der Schwarzmeerküste sowie Kleinarmenien konnten ihre Unabhängigkeit von den Seldschuken wahren. Der Staat der anatolischen Seldschuken erlebte seine höchste Blüte aber auch auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet.
Die ökonomische Grundlage bildete die hochentwickelte Landwirtschaft. Die – wie wir sahen – zumeist aus Griechen, Armeniern und Slawen bestehende Bauernschaft verließ das Land nach der seldschukischen Eroberung nicht, sondern bebaute es auch weiterhin. Bewässerungsanlagen waren reichlich vorhanden; es gab reichen Obstanbau, an Getreide wurden überwiegend Weizen und Gerste produziert. Da jedoch die – byzantinischen – Landbesitzer flüchteten, fiel das Eigentumsrecht am Boden den Seldschuken zu. Die Bauern hatten gegen die veränderten Herrschaftsverhältnisse kaum etwas einzuwenden, da sie unter den neuen Herren lediglich die religionsgesetzlich vorgesehene Kopfsteuer zu entrichten hatten, die geringer war als die Summe der verschiedenen byzantinischen Steuern. Aber auch die seldschukische Oberschicht war nicht interessiert, etwas an dieser Lage zu ändern, da der durch die Arbeit der Bauern garantierte Bestand der Kulturlandschaft die Basis für gesicherte Steuereinnahmen darstellte. Privateigentum am Boden war jedoch verhältnismäßig selten; das Gros des bebaubaren Bodens ging in Staatseigentum über, der dann, in Pfründen (ikta5) aufgeteilt, – anstelle von Besoldung – Militärs und Staatsbeamten zur Nutznießung bis auf Widerruf überlassen wurde. Die Inhaber dieser ikta besaßen gegenüber den Bauern ihrer Pfründen keine Hoheitsrechte; die Pflichten der Bauernschaft wurden vom Staat reglementiert. Dieses System garantierte der Staatsgewalt, daß die Pfründeninhaber sich nicht allzusehr verselbständigen konnten.
Eine zunehmend größere Bedeutung neben dem Ackerbau gewann schließlich die von den Türkmenen betriebene nomadische Viehzucht. Da die sozialen Folgen, die sich aus der nomadischen Erschließung großer Teile Anatoliens ergaben, im folgenden Kapitel erörtert werden, sei hier nur vermerkt, daß die großen Schaf- und Ziegenherden nicht nur der Fleischversorgung dienten, sondern auch Wolle und Ziegenhaar lieferten, Rohstoffe für das türkmenische Handwerk, besonders für die Teppichherstellung.
Auch das städtische Handwerk spielte bereits eine ansehnliche Rolle. Der Handel florierte nicht nur auf lokaler Ebene, wobei den städtischen Märkten eine wichtige Funktion zukam, sondern auch auf mehreren Handelsrouten, die die verschiedenen Regionen des Reiches, das Reich aber auch mit den angrenzenden Staaten verbanden. Auf diesen Wegen standen den Reisenden gut ausgestattete Karawansereien zur Verfügung, in denen sie sich vor den Unbilden der Witterung schützen, essen und übernachten konnten.
Auf die kulturellen Leistungen der anatolischen Seldschuken kann hier nicht näher eingegangen werden. Es sei nur erwähnt, daß neben der Baukunst, von der einige hervorragende, vor allem sakrale Bauwerke zeugen, auch die Wissenschaft und die Literatur florierten, wenn auch die türkische Sprache dabei kaum eine Rolle spielte. Die weitgehend urbanisierte seldschukische Oberschicht, die das kulturelle Leben bestimmte, war nämlich von der persischen Kultur so stark beeinflußt, daß sie das eigene türkische kulturelle Erbe geringschätzig als barbarisch ansah.6
Die Blütezeit hielt jedoch nicht lange an. Kaum sechs Jahre nach dem Tode Kaikubads I. schlugen die hereinbrechenden Mongolen das Seldschukenheer 1243 am Kösedağ7. Den Seldschuken blieb keine andere Wahl, als sich den Eroberern zu unterwerfen und deren Vasallen zu werden. Die latenten Zersetzungskräfte, die während der Regierung starker Herrscherpersönlichkeiten nicht zutage getreten waren, wurden nun bestimmend. Das anatolische Seldschukenreich zerfiel in einen westlichen und einen östlichen Teil, mit dem Kızıl Irmak als Grenzfluß. Der Weststaat verbündete sich – schon aus geographischen Gründen – mit dem Kaiserreich Nizäa, während das Ostreich die Gunst der mongolischen Oberherren genoß. Einem hohen Würdenträger, Muinuddin Süleyman, der zugleich Vertrauensmann der Mongolen war, gelang es zwar, die staatliche Einheit der anatolischen Seldschuken wiederherzustellen. Nach dem Einfall des Mamlukensultans Baibars in Kleinasien wurde Muinuddin, der in der Regel nach seinem Titel einfach als Parwane8 bezeichnet wird, jedoch des Verrats bezichtigt und 1277 hingerichtet. Von nun an führten die Mongolen ein strafferes Regiment in Anatolien, was einen fortschreitenden Gebietsverlust für die Seldschuken mit sich brachte. In den Grenzgebieten bildeten sich de facto unabhängige Kleinfürstentümer, die die politische Szene in Kleinasien für ein Jahrhundert bestimmen sollten. Der Staat der anatolischen Seldschuken selbst ging unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Die Mongolen besetzten im ersten Jahrzehnt des 14. Jh. den Seldschukenthron nicht mehr, sondern übernahmen die Verwaltung des noch verbliebenen Gebiets des ehemaligen Staates der anatolischen Seldschuken selbst.