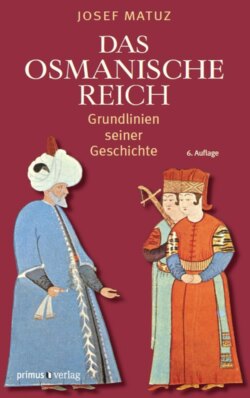Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 16
3. Timur. Die zeitweilige Auflösung des Osmanenstaates
ОглавлениеBayezit I. trat Tim ur (gest. 1405) voller Zuversicht entgegen. Er verfügte schließlich über ein Herrschaftsgebiet, das für damalige Verhältnisse eine ansehnliche Macht darstellte. Der Osmanenstaat umfaßte nicht nur nahezu ganz Anatolien,28 sondern auch große Teile des Balkan – ein Gebiet von mehr als 690.000 qkm, schon erheblich größer, als heute die Fläche von Frankreich und den Benelux-Staaten zusammen. Die Osmanen verfügten über ausreichende wirtschaftliche Ressourcen und eine gut organisierte, erprobte Armee, die den Heeren der Nachbarn in jeder Beziehung gewachsen war.
Vorerst kam es noch zu keiner größeren Auseinandersetzung zwischen den beiden Mächten. Timur begnügte sich einstweilen damit, noch im Jahre 1400 in Ostanatolien eine Strafexpedition gegen Erzincan und Sivas, die mit der Annexion des Fürstentums von Kadi Bürhaneddin osmanisch geworden waren, zu unternehmen, unter Anwendung gezielten Terrors: Er ließ die Bewohner der eroberten Gebiete, die sich ihm nicht gleich ergaben, einfach grausam hinmorden. Anschließend griff er das Reich der Mamluken an, wodurch den Osmanen jedoch nur eine Galgenfrist gewährt wurde. Denn schon bald forderte Tim ur den Osmanensultan auf, sich ihm zu unterwerfen und den ehemaligen anatolischen Kleinfürsten ihr Land zurückzugeben, das sie an die Osmanen verloren hatten. Mehrere anatolische Emire hatten sich nämlich, nachdem sie von den Osmanen um ihren Besitz gebracht worden waren, zu Timur geflüchtet, um bei ihm Schutz zu suchen. Nur bei der Erfüllung dieser Bedingungen – so lautete Timurs Botschaft – würde der osmanische Sultan sein Kernland behalten können.
Timurs erpresserischer Vorschlag war für den mächtigen Osmanensultan freilich unannehmbar. So kam es zur bewaffneten Auseinandersetzung. Bayezit I. schätzte jedoch das Kräfteverhältnis völlig falsch ein. Das Land der Osmanen war zwar eine bedeutende und für damalige Maßstäbe hervorragend durchorganisierte, aber dennoch nur regionale Größe. Timurs Reich besaß zu dieser Zeit indes schon die Dimensionen einer Weltmacht. Timur hatte als Sohn des Häuptlings des unbedeutenden Tatarenstammes Barlas zu seinem Heimatgebiet Transoxanien nach und nach Ostturkestan, die Landschaft Choresm, ganz Persien, Georgien, Armenien, Nordmesopotamien und Nordindien hinzuerobert. Er verfügte nicht nur über eine vielfache militärische Übermacht, auch sein wirtschaftliches Potential war unvergleichlich größer.
Timurs Truppen bestanden überwiegend aus Türken, die aus Turkestan stammten. Die mongolischen Kontingente waren nicht sehr zahlreich.29 Timur selbst war kein Mongole30: Er gehörte ethnisch ebenfalls dem Türkentum an. Auch sein Name ist türkischen Ursprungs, er kommt vom mitteltürkischen temür und bedeutet ‘Eisen’. Da er hinkte, bekam er den persischen Spitznamen Läng, ‘der Lahme’. Aus Timur Läng entstand dann der europäische Name des großen Eroberers: Tamerlan. Timur war ein fanatischer Muslim – auch sufische Züge sind bei ihm zu erkennen –, der den Islam um jeden Preis unter den ‘Ungläubigen’ verbreiten wollte. Die Osmanen hielt er für dekadent, da diese zu den ‘Ungläubigen’ zeitweise friedliche Beziehungen pflegten. Timurs sprichwörtliche Greueltaten sind allerdings nicht nur aus dieser religiösen Einstellung heraus zu interpretieren, sie waren für ihn zugleich nüchtern kalkulierte Einschüchterungsmaßnahmen: Sie sicherten ihm den unbedingten Gehorsam der eigenen Untertanen und jagten der feindlichen Bevölkerung panischen Schrecken ein. Gerade diese Greueltaten lehnte aber die islamische Orthodoxie, mithin die osmanische Staatsspitze, aus religiös-moralischen Gründen entschieden ab, was den Widerstandswillen der Osmanen noch verstärkte. Wenn Timur von der Geschichtsschreibung bis heute als barbarisch und unkultiviert charakterisiert wird, so ist dies vorrangig auf den von ihm verbreiteten Terror zurückzuführen. Andererseits förderte er – vor allem in Transoxanien, seinem Kernland – Handwerk, Wissenschaften und Künste: So ließ er zahlreiche Handwerker und Künstler aus den eroberten Ländern in seine Hauptstadt Samarkand umsiedeln. Wie dem auch sei, Timur kann auf jeden Fall als einer der genialsten Feldherren der Weltgeschichte bezeichnet werden.
Sultan Bayezit – ebenfalls ein tüchtiger Militärführer – kam an ein Genie wie Timur nicht heran. Auch rein zahlenmäßig war Timurs Streitmacht Bayezit weit überlegen: Der Osmanenherrscher konnte lediglich etwa 70.000 Mann gegen Timurs 160.000 Krieger aufbieten. Das osmanische Heer wurde außerdem noch stark dezimiert, weil alle aus den kurz zuvor eroberten Emiraten stammenden Krieger zur gegnerischen Seite überliefen. So war es nicht verwunderlich, daß die Osmanen Ende Juli 1402 in der Schlacht von Ankara eine vollständige Niederlage erlitten. Der Sultan geriet dabei in Gefangenschaft. Timur bot ihm erneut einen Vasallenvertrag an, den Bayezit jedoch auch jetzt ablehnte. Daraufhin behandelte Timur den Exsultan weiterhin als Gefangenen, den er auf seinen Feldzügen vorsichtshalber mit sich nahm; angeblich ließ er ihn dabei – demütigend – in einer Frauensänfte mittragen; er starb schließlich in der Gefangenschaft.
Diese katastrophale Niederlage konnte der Osmanenstaat nicht verkraften: er zerfiel. Die von den Osmanen entrechteten Emire bekamen ihre Länder von Timur zurück. Auch dreien der Söhne Bayezits wies Timur einen Erbteil zu: Süleyman erhielt die europäischen Besitzungen, İsa das osmanische Stammland um Bursa und Mehmet Zentralanatolien mit Amasya und Tokat. Nachdem Timur die Gefahr, die ihm von seiten eines starken und vereinigten osmanischen Staates hätte drohen können, gebannt hatte, ließ er die gegnerischen Kriegsgefangenen – Bayezit ausgenommen – frei und stieß auf Smyrna (İzmir) an der Ägäisküste vor, das sich in der Hand der Ritter des Johanniterordens von Rhodos befand. Nach der Eroberung der Stadt richtete er ein Blutbad an: Auch hier ließ er aus den Schädeln der getöteten Gegner – einer seiner gefürchteten Gewohnheiten folgend – eine Pyramide als grausames Zeichen seines Machtwillens errichten.
Als Timur dann 1403 Anatolien mit seinem blutrünstigen Heer verließ, um nunmehr quer durch den Kontinent nach Osten zu ziehen, um China zu erobern, ließ er ein aus vielen Wunden blutendes, durch die Streifzüge verwüstetes Land zurück, das nun auch noch von der Pest heimgesucht wurde. Europa aber konnte aufatmen, denn die Gefahr, die bisher von seiten der Osmanen gedroht hatte, war – zumindest für einige Zeit – gebannt.
Kaum hatte Timur Anatolien verlassen, da kam es auch schon zu Auseinandersetzungen zwischen den neu entstandenen bzw. wiederbelebten Kleinstaaten. Auch die Osmanenprinzen waren in Kämpfe verwickelt. Es handelte sich dabei allerdings nicht ausschließlich um persönliche Rivalitäten. Süleyman31, Bayezits ältester Sohn, wollte die feudalstaatlichen Prinzipien so verwirklichen, wie sie sich zu Zeiten Murats I. und Bayezits I. herausgebildet hatten. D.h., er strebte nach Erhaltung des Timar-Systems und nach staatlicher Zentralisierung. Im religiösen Bereich galten seine Sympathien der islamischen Orthodoxie. Außerdem pflegte er freundliche Beziehungen zu den christlichen Balkanstaaten. Das Leitprinzip der anderen Brüder – Mehmet ausgenommen, der die Politik eines Mittelwegs zu repräsentieren scheint – war hingegen die Dezentralisation und insbesondere die Förderung der Ghasi-Tradition, die Duldung der Eigenständigkeit der Türkmenenstämme, d.h. Machtzersplitterung und in religiöser Hinsicht die sufısche Heterodoxie. Im Kampf der Brüder um die Vormachtstellung mußte sich entscheiden, welche politische Richtung ein wiedervereinigtes Osmanisches Reich einschlagen würde.
Seitens auswärtiger Mächte war kein Hindernis mehr vorhanden, das den Kampf um die Macht in Anatolien hätte unterbinden können. Timur war weit weg; sein Augenmerk war nur noch auf China gerichtet. Er verschwand so jäh, wie er erschienen war. Sein Riesenreich bröckelte nach seinem Tod Anfang 1405 auseinander. Mehmet, der spätere Sultan Mehmet I., konnte ungehindert die Emirate Saruhan, Menteşe, Aydin und Tekke als Vasallenstaaten wieder in sein Teilreich einbeziehen. İsa, der im osmanischen Stammland residierende Bruder Mehmets, konnte ihn – trotz Süleymans Unterstützung – ebenfalls nicht aufhalten; nach wiederholten Niederlagen trat İsa seit 1405 endgültig nicht mehr in Erscheinung. Die Auseinandersetzung zwischen Mehmet und İsa hatte jedoch Süleyman ausgenützt, um sein auf Rumelien beschränktes Teilreich durch Gebiete in West- und Mittelanatolien abzurunden: Bursa und Ankara gingen in seinen Besitz über. Da griff plötzlich Musa, ein weiterer Bruder, ein, der bei der Aufteilung des väterlichen Erbes mit leeren Händen ausgegangen war.32 1410 gelang es ihm, Süleyman zu schlagen, der kurz darauf starb.
Diese Ereignisse hatten eine Änderung auch im politisch-religiösen Kurs des osmanischen Teilstaates in Europa zur Folge. Musa huldigte nämlich der extremsten Form des Sufıtums, und sein Ghasi-Bewußtsein steigerte sich bis zur Besessenheit. Diese Geisteshaltung manifestierte sich in einer brutalen Unterdrückung der europäischen Besitzungen, wobei es zu einer regelrechten Verwüstung Serbiens kam. Gegenüber Byzanz wurde ebenfalls eine härtere Linie verfolgt: Der Tribut wurde drastisch erhöht. Kaiser Manuel II. konnte daher nicht umhin, einen Hilferuf an Mehmet zu richten, der diese Gelegenheit – der Unterstützung durch den Basileus und die Serben gegen Musa gewiß – gerne wahrnahm, um den Osmanenstaat unter seiner eigenen Herrschaft wiederzuvereinigen. Die militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Osmanenprinzen fand 1413 statt33 und endete mit Musas totaler Niederlage und seinem Tod. Das Ende Musas bedeutete nicht nur das Ende des Interregnums im Osmanenstaat; auch das Ghasitum und die religiöse Heterodoxie hörten auf, für die Osmanen staatstragende Prinzipien zu sein.
1 Heute: Mary, in der Türkmenischen Sowjetrepublik.
2 Eine Angabe des frühosmanischen Chronisten Aşikpaşazâde, wonach ihre Zahl 50.000 (!) Zelte betragen haben soll, ist zweifellos viel zu hoch gegriffen. Ähnliche Zahlenangaben der früheren islamischen Geschichtsschreibung sind mehr rhetorisch, lediglich im Sinne von ‘viel’ zu werten.
3 Den Choresm-Schahs unterstand ein Staatswesen, das beim Auseinanderbröckeln des Reiches der Großseldschuken zustande gekommen war. Der Titel der Choresm-Schahs rührt vom Namen des Kernlandes ihrer Besitzungen her, der auf beiden Seiten des Unterlaufs des Amu-Darja liegenden Landschaft Choresm.
4 Nach einer anderen Überlieferung soll es zu diesem Rückmarsch erst gar nicht gekommen sein. Ihr zufolge ist Süleyman Schah schon vorher, anläßlich des Zuges nach Anatolien, im Euphrat ums Leben gekommen.
5 Die Nebenform des Namens, ‘Ottoman’, geht entweder auf einen Lesefehler oder auf eine Dialektform zurück.
6 Es handelt sich um den Herrn von Bilecik, einer Stadt etwa 80 km östl. von Bursa.
7 Mit der Annahme des Islams übernahmen die Türken auch die arabische Schrift.
8 Schon zuvor wurden kleinere Raubüberfälle auf europäischem Gebiet unternommen, vor allem seitens der Fürstentümer Saruhan und Aydın.
9 Auf der Halbinsel Gallipoli.
10 Dieses Emirat umfaßte einen bedeutenden Teil Zentralanatoliens und verfügte über eine gewichtige Militärmacht.
11 Titel, der seit Mahmud von Ghasna unabhängigen islamischen Herrschern – in der Regel – vom Kalifen verliehen wurde.
12 Nicht, wie früher angenommen, identisch mit Alaeddin Beg, dem Bruder Orhans.
13 Sandschak, ‘Fahne’, war ursprünglich die Bezeichnung der größeren Militäreinheiten des osmanischen Heeres.
14 Der Terminus müsellem ist arabischen Ursprungs und bedeutet ‘befreit’, hier: ævon Steuern befreit’.
15 Annahmen, wonach die ahi-Bewegung bei der Errichtung des Osmanenstaates eine wesentliche Rolle gespielt hätte, dürften folglich kaum stichhaltig sein.
16 Die zeitweilige Eroberung von Gallipoli durch Amadeo VI. von Savoyen ist lediglich als eine – unerhebliche – Episode zu werten.
17 Südlich von Nisch, in Südserbien; es handelt sich um die erste Schlacht auf dem Amselfeld, eine zweite fand 1448 statt.
18 Das Emirat Eşref wurde mit Aussterben des Herrscherhauses zwischen den Karamanen und dem Fürstentum Hamit geteilt.
19 Der rebellische Prinz selbst wurde gefangengenommen und später hingerichtet.
20 Der Titel Pascha stand diesen Beglerbegs vorerst nicht zu.
21 Das Wort timar bedeutet ursprünglich soviel wie ‘Pflege’ und wird auch im speziellen Sinne von ‘Verpflegung’ gebraucht. Wenngleich das osmanische Timar-System eine gewisse Ähnlichkeit mit dem seldschukischen ikta-System aufweist, kann es wegen des verschiedenen Ursprungs nicht ohne weiteres als dessen unmittelbare Nachfolgeeinrichtung angesehen werden.
22 D.h. – ursprünglich – ‘Führerschaft’ und erst im weiteren Sinne: ‘die dafür zur Verfügung gestellte Pfründe’.
23 Von türk. yeni çeri, ‘neue Truppe’.
24 So wird die osmanische Staatsspitze bezeichnet.
25 Türk, pencik, von pers. pandsch-jak, ‘Fünftel’.
26 Der Name wird heute Beyazıt ausgesprochen.
27 So hieß die letzte byzantinische Kaiserdynastie.
28 Lediglich das südöstliche Küstengebiet in Kleinasien gehörte zu dieser Zeit nicht zum Osmanenstaat.
29 Die Mongolen waren zahlenmäßig immer eine schwache Volksgruppe.
30 Er hat sich – unberechtigterweise – als Dschingis Chans Nachfahre ausgegeben.
31 Da die europäischen Vasallen Süleyman als Sultan anerkannten, wurde er lange als Sultan Süleyman I. bezeichnet. Die spätere offizielle osmanische Reichsgeschichtsschreibung betrachtete ihn jedoch nicht als Sultan. Daher gilt heutzutage Süleyman der Prächtige (1520–1566) als Süleyman I.
32 Musa geriet zusammen mit seinem Vater in Timurs Gefangenschaft. Nach dessen Tod wurde er freigelassen und konnte nach Anatolien zurückkehren.
33 In der Nähe von Samokow, etwa 50 km südl. von Sofia.