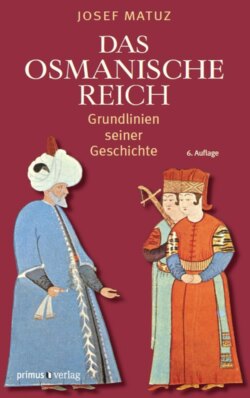Читать книгу Das Osmanische Reich - Josef Matuz - Страница 13
2. Die kleinasiatischen Emirate
ОглавлениеEines der Duodezfürstentümer, die aus der allmählichen Auflösung des anatolischen Seldschukenreiches hervorgingen, war das osmanische Emirat. Um die Entstehung und die Entwicklung dieser Fürstentümer, namentlich des Emirats Osman, klar zu vergegenwärtigen, ist es angebracht, noch einen Blick zurück auf jene Türkmenenstämme zu werfen, die nach der Schlacht von Manzikert 1071 Anatolien überflutet hatten. In sozialer und ethnischer Hinsicht entstand durch das Einströmen der Türkmenen nach Anatolien ein eigenartiger Dualismus von Nomadentum und Seßhaftigkeit. In den dichter besiedelten Gebieten blieb der Boden auch weiterhin in den Händen des seßhaften, Ackerbau treibenden Bevölkerungsteils. So lagen die Dinge vor allem im Gebiet um Konya, das sich zum Herzstück des rumseldschukischen Staates entwickelte, nachdem diese Stadt Ende des 11. Jh. zum Sitz der Sultane bestimmt worden war.
Den nomadisierenden Türkmenen standen nur weniger dicht besiedelte, zugleich, wie bereits erwähnt, schwach hellenisierte Gebiete zur Verfügung, wo auch der Bevölkerungsanteil der Bauern gering und das Niveau der Landwirtschaft verhältnismäßig niedrig war. Diese Gebiete – vor allem im Fürstentum Danischmend um Sivas – eigneten sich für die Lebensweise der türkmenischen Hirtennomaden besonders gut. Hier konnten sie ihre extensive Viehzucht betreiben. Hier standen ihnen genügend Weidegründe zur Verfügung. Ähnlich war die Situation in den Grenzgebieten (uç) im Westen Anatoliens, die den Türkmenen von den anatolischen Seldschukensultanen zugewiesen wurden. Hier weideten sie ihre Herden im gebirgigen Inneren des Landes, bis nach Dorylaion (Eskişehir), und bewachten gleichzeitig die Grenzen des Seldschukenstaates. Ihnen standen die Akritai, die byzantinischen Grenzwächter gegenüber. Die Zahl der nomadischen Türkmenen – uns sind 24 Stämme bekannt – war recht bedeutend: Sie dürfte im 12. Jh. eine halbe bis eine Million Menschen betragen haben und erhöhte sich durch die stetige Zuwanderung weiterer Türkmenen aus Zentralasien.
Die seldschukische Oberschicht war, wie erwähnt, am Ackerbau der Bauern lebhaft interessiert, ganz im Gegensatz zu den Danischmendiden und den Türkmenen des Grenzgebietes: Sie hegten als Nomaden nicht nur eine starke Abneigung gegen die seßhafte Bevölkerung; als ‘Proselyten’, die den Islam erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit angenommen hatten, waren die Türkmenen Anatoliens auch besonders eifrige Glaubenskrieger. Mit der Zeit wurde ein Teil der türkmenischen Hirtennomaden gar zu ‘Berufs-Glaubenskriegern’ (Ghasi), die – ohne Bindung an immobilen Besitz und feste Wohnsitze – einen ständigen Kleinkrieg führten, Beute- und Raubzüge unternahmen oder sich als Söldner verdingten. Es versteht sich daher von selbst, daß sich die Interessen des Seldschukensultanats mit denen der Türkmenen nicht immer deckten. Eine weitere Gruppe der Türkmenen suchte ihren Erwerb in den dichten, für die Viehzucht ungeeigneten anatolischen Wäldern als Holzfäller und Köhler. Aus dieser Gruppe rekrutierten sich in der Folgezeit die Tagelöhner in den Städten.
Der im vorangehenden Kapitel erwähnte Sieg der anatolischen Seldschuken über die Danischmendiden (1178) stellte, was die Sozialstruktur Anatoliens betraf, nicht nur den Abschluß einer zwischenstaatlichen Auseinandersetzung dar, sondern gleichzeitig auch den – zumindest vorübergehenden – Sieg der Seßhaftigkeit und des Ackerbaus über die nomadische Viehzucht. Mit der Niederwerfung der Danischmendiden war für den Staat der anatolischen Seldschuken das Türkmenen-, sprich Nomadenproblem, indes lediglich aufgeschoben. Denn schon nicht ganz ein Jahrzehnt später, Mitte der 80er Jahre des 12. Jh., tauchte ein Türkmenenhäuptling namens Rüstern auf, der mit seiner nomadischen Anhängerschaft in Ostanatolien, in Kilikien und in Nordsyrien ohne Rücksicht auf Religion oder auf ethnische Zugehörigkeit alles niedermetzelte, was seßhaft war: sowohl muslimische Kurden als auch christliche Georgier.
Anfang der 30er Jahre des 13. Jh. erhielten die nomadischen Türkmenen Anatoliens eine besonders bedeutsame Verstärkung: In Stammesverbänden, Gruppen oder als Einzelpersonen kamen zahlreiche Türken nach Kleinasien, die vor den Mongolen die Flucht ergriffen hatten. Unter den Flüchtlingen befanden sich nicht nur Oghusen, sondern auch Angehörige anderer Türkvölker, die später von den oghusischen Türkmenen absorbiert wurden. Diese permanente Einwanderung von Türken bewirkte, daß Anatolien sich in ethnischer Hinsicht zusehends veränderte: Schon vor dem Auftreten der Osmanen dürfte der türkische Bevölkerungsteil größer als der byzantinisch-armenische gewesen sein.
Auch hinsichtlich des Zahlenverhältnisses von seßhaftem und nomadisierendem Bevölkerungsteil fand eine Verschiebung zugunsten der Nomaden statt. Dies brachte schwerwiegende soziale Probleme mit sich. Die vielen Nomaden – für die Mitte des 13. Jh. hat man eine Zahl von siebzigtausend Zelten geschätzt – benötigten für ihre großen Herden in zunehmendem Maße Weideplätze, die jedoch nicht zur Verfügung standen. Eine Umwandlung der bäuerlichen Anbaufläche in Weiden kam nicht in Frage, da die seldschukische Staatsmacht eher an der Erhaltung des Ackerbaus interessiert war als an der extensiven Viehzucht der Nomaden. Dazu kam, daß die Türkmenen an die Staatsmacht Schafe abzuführen hatten – eine drückende, oft existenzgefährdende Naturalabgabe. Die wachsende Unzufriedenheit der Türkmenen wurde durch sufische religiöse Tendenzen noch geschürt.
Das Sufıtum ist eine mystisch-asketische Ausrichtung des Islams mit häufig – mehr oder weniger ausgeprägten – schiitischen Zügen. Der Sufi, d.h. ‘der Asket, der ein grobes Wollkleid trägt’, setzt sich zum Ziel, schon zu Lebzeiten völlig und unmittelbar in Gott aufzugehen. Der höchsten Stufe der Vollkommenheit, der Vereinigung mit Gott, will er sich allmählich durch Kontemplation wie durch Ekstase annähern. Die an der Lebensweise des Sufıtums teilhaben und auf weltliche Güter verzichten, werden mit dem persischen Wort Derwisch oder mit dem arabischen Ausdruck Fakir bezeichnet. Beide Wörter haben die Bedeutung ‘arm’. Die Derwische organisieren sich in Derwischorden, für die die unterschiedlichen religiösen Praktiken beim Ersteigen der Vollkommenheitsstufen im Mittelpunkt stehen. Deshalb werden die Orden tarika genannt, was im Arabischen ‘Weg, Methode’ bedeutet. Obwohl das Sufıtum sich in der Regel einer weltentrückten Lebensweise zuwandte, gab es in ihm Richtungen mit ausgeprägten Welterlösertendenzen, so daß einzelne Orden auf weltlicher Ebene sozialrevolutionäres Gedankengut vertreten haben.
Bedingt durch die gespannte politische Atmosphäre, brach bei den Türkmenen 1240 ein stark religiös gefärbter Aufstand gegen die in großem Maße persifizierte und urbanisierte seldschukische staatliche Obrigkeit los, der nach seinem Führer, Baba İshak, als Babai- Aufstand bezeichnet wird. Zwar konnte diese Revolte blutig niedergeschlagen werden, aber eine Lösung des Türkmenenproblems wurde dadurch nicht erreicht.
Durch solche Kraftakte vermochte die seldschukische Oberschicht die unruhigen Türkmenen allerdings zu bändigen, solange die Staatsmacht intakt war. Nach der Niederlage gegen die Mongolen 1243 war diese Macht jedoch geschwunden. Das System der Pfründen, der ikta, das bisher Garant der staatlichen Einheit war, wurde immer mehr durchbrochen. Infolge der fortschreitenden Schwächung der Zentralgewalt wurden viele ikta in privaten Grundbesitz umgewandelt; parallel dazu wurden Staatsdomänen verschenkt. Die nicht konsequent durch staatliche Maßnahmen eingeschränkte Herrschaft der Großgrundbesitzer über ihre Ländereien war ein vorzüglicher Nährboden für die Herausbildung von quasi selbständigen, lokalen Staatsgebilden.
Anfang der 60er Jahre, als das Reich der anatolischen Seldschuken vorübergehend zweigeteilt war, entstanden – insbesondere im Westen – die ersten turkmenischen Emirate. Diese Entwicklung wurde noch dadurch begünstigt, daß die militärische Oberschicht sich bei der genannten Teilung überwiegend dem östlichen Teilstaat anschloß, der ja auch von den Mongolen protegiert wurde. Der Westteil stand also im wesentlichen ohne soldatische Führungskräfte da. Notgedrungen griff man hier deswegen auf Türkmenenhäuptlinge zurück, die als Emire eingesetzt wurden. Als das Reich dank der Tüchtigkeit des im vorangehenden Kapitel erwähnten Parwane wieder geeint wurde, konnte die Zentralgewalt das westliche Grenzgebiet nicht mehr recht unter Kontrolle bringen, und die Türkmenenhäuptlinge verselbständigten sich zusehends. Diesem Prozeß konnten auch die mongolischen Oberherren kaum entgegenwirken, denn ihre Kraft war durch eine schwere Niederlage erheblich geschwächt: Sie waren von den Mamluken 1260 am ‘Goliathsquell’9 geschlagen worden.
An der Spitze des turkmenischen Verselbständigungsprozesses standen die Karamanen in Südwestanatolien. Die Entstehungsgeschichte des karamanischen Emirats gewährt zugleich einen guten Einblick in die anatolischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 13. Jh. Die Dynastie Karaman, die sich später zu einem gefährlichen Rivalen der Osmanen entwickelte, war von einfacher Herkunft: Ihr Gründer und Namengeber war ein turkmenischer Köhler, der sich dann als Anführer von Wegelagerern auszeichnete. Der tüchtige, kampferprobte Haudegen wurde Anfang der 60er Jahre des 13. Jh. zum Emir erhoben. Der Enkel dieses Karaman Beg10, nach dem Großvater Karamani Mehmet Beg genannt, übernahm die Führung derjenigen Türkmenen, die sich 1277 gegen die Mongolen auflehnten. Die Haltung der Aufständischen war weder ‘nationalistisch’ noch entschieden antimongolisch: Sie wollten sich lediglich der drückenden Steuern entledigen, die sie den Ilchanen – so werden die mongolischen Herrscher von Persien bezeichnet – und ihrem Vasallen, dem Seldschukensultan, schuldeten. Auf die Verweigerung der Steuerablieferung blieb die mongolische Reaktion nicht aus: Es kam zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Türkmenen die Ilchane mit ihren persischen Söldnern besiegten. Nun dachte Karamani Mehmet Beg nicht daran, sich selbst zum Sultan des Seldschukenstaates aufzuschwingen. Er verbündete sich mit einem Thronprätendenten, einem angeblichen Seldschukenprinzen namens Cimri, den er als seine Marionette unter dem Namen Giyasuddin Siyavuş auf den Thron setzte; er selbst begnügte sich mit der Würde des Wesirs. Konya, die bisherige Hauptstadt der anatolischen Seldschuken, wurde daraufhin von den ‘barbarischen’ Türkmenen, die die Herrschaft Cimris und der Karamanen stützten, besetzt. Im Zuge dieser Machtübernahme wurde auch die bisherige persische Amtssprache durch das Türkische ersetzt – entsprechend der nunmehr führenden Rolle der Türkmenen. Seit dieser sprachpolitischen Entscheidung ist die offizielle Sprache in der Türkei das Türkische geblieben.
Die Mongolen wollten sich nicht damit abfinden, daß ihnen die Macht in Anatolien aus der Hand glitt. Sie versuchten die Herrschaft ihres Vasallen, des ‘legalen’ rumseldschukischen Herrscherhauses wiederherzustellen. Karamani Mehmet Beg selbst kam im Laufe der militärischen Auseinandersetzungen um; Cimri konnte sich im westlichen Grenzland noch eine Weile halten, unterlag dann aber der mongolischen Übermacht und wurde grausam hingerichtet.
Die Karamanen waren nach dieser Niederlage jedoch keineswegs ausgeschaltet. Die seldschukische Staatsführung, von den Ilchanen wieder in ihre Rechte eingesetzt, war so schwach, daß sie sich nach Kayseri zurückziehen mußte, einer Stadt, die näher zum Reich der Ilchane lag und besser zu verteidigen war als die bisherige Hauptstadt Konya. Die durch die Mamluken ebenfalls erheblich geschwächten Ilchane waren froh, ihren rumseldschukischen Vasallen überhaupt noch halten zu können. Die Lage im weit entfernten westanatolischen Grenzgebiet kümmerte sie wenig, solange das Grenzland sich nicht direkt mongolenfeindlich verhielt.
Hier, im machtpolitischen Vakuum im nördlichen, südlichen, vor allem aber im westlichen Randgebiet des Seldschukenstaates entstanden die ersten de facto unabhängigen Türkmenenfürstentümer. Im Grenzland zu Byzanz blühte das Ghasitum wieder voll auf; die Begs waren nicht nur Oberhäupter und Militärbefehlshaber ihrer Duodezfürstentümer, sie waren zugleich religiöse Anführer. Die ständigen Grenzstreitigkeiten mit den Byzantinern waren für sie einerseits Versuche, sich durch Beute zu bereichern und ihr Herrschaftsgebiet auszudehnen; andererseits galt der Kampf gegen die ‘Ungläubigen’ aber auch als Dschihad, als ‘Heiliger Krieg’, und war somit Ausdruck ihrer Frömmigkeit. Für den Grad der Verschmelzung religiöser Vorstellungen mit militärischen Intentionen war es kennzeichnend, daß selbst der Titel Pascha11, der uns als hoher militärischer Rang im Verlauf der Geschichte der Osmanen immer wieder begegnet, zu jener Zeit von militanten Derwischen übernommen wurde: Verschiedene Mitglieder der Herrscherfamilien gingen dazu über, sich ebenfalls als Pascha zu bezeichnen.
Infolge der stets unruhigen Lage im Grenzland waren die Kleinfürstentümer keine konstanten politischen Größen: Es entstanden neue, alte wurden umgestaltet oder verschwanden. Es wäre verfehlt, anzunehmen, daß das Land in dieser Zeit der Wirren in den Zustand der Kulturlosigkeit zurückgefallen sei. Zweifellos hatte die seßhafte Bevölkerung durch das ständige Hin und Her viel zu leiden; viele kamen bei den bewaffneten Auseinandersetzungen ums Leben. Die Mongolen beuteten durch hohe Steuern die Bauernschaft aus. Eine starke Landflucht war die Folge. Der Ackerbau wurde dadurch zwar beeinträchtigt, jedoch nicht in einem solchen Maße, daß man von einem allgemeinen Verfall sprechen müßte. Auch in den Städten ging das Leben seinen gewohnten Gang: Gewerbe und Handel florierten weiterhin. Die Anzahl der muslimischen Stadtbewohner nahm immer mehr zu. Die Emire, die die wärmeren Jahreszeiten außerhalb der Städte in Zelten verbrachten, ließen in den Städten Winterresidenzen errichten. Moscheen und Medresen wurden erbaut.
Eine besondere Bedeutung kam in den Städten den sog. ahi zu, einer Organisation junger Männer mittleren Standes, deren Zweck nicht nur in geselligem Zusammentreffen, sondern auch in wohltätigen Aktionen bestand: Vor allem Reisenden bot man Hilfe an. Durch Organisationsform und Ideale hatten die ahi große Ähnlichkeiten mit der sog. futuwwa-Bewegung, die im 9. Jh. in Städten des Irak und in Chorasan entstanden und durch hilfsbereites Verhalten Schutzbedürftigen gegenüber hervorgetreten war. Wenngleich die ahi nicht aus einem einheitlichen sozialen Milieu stammten, so kann ihre Bewegung zweifellos als Standesorganisation der städtischen Bürgerschaft angesehen werden. In die ahi-Vereinigungen wurden Angehörige ‘niederer’ Berufe nicht aufgenommen. Die ahi-Vereinigungen genossen hohes Ansehen. Dies ging zeit- und ortsweise so weit, daß sie sogar polizeiliche oder zunftartige Aufgaben wahrnehmen konnten, etwa die Kontrolle der Gewerbeausübung. In Städten, in denen keine Fürsten regierten, waren die ahi sogar das bestimmende politische Element.
Die zahlreichen Kleinfürstentümer, die mit dem Zerfall des Seldschukenstaates entstanden waren, waren keineswegs gegenseitig isoliert. Die einzelnen Städte und Fürstentümer waren auch weiterhin durch Handelswege verbunden, die den zahlreichen Karawanen trotz gelegentlicher Überfälle durch türkmenische Wegelagerer eine mehr oder weniger sichere Reise ermöglichten.
1 Diese Bezeichnung wird für das Einheitsreich bzw. dessen Sultane gebraucht, zur Abhebung gegenüber den Benennungen der späteren Teilreiche.
2 Türk. Malazgirt, nordwestl. des Van-Sees.
3 Heute Çardak, östl. von Denizli.
4 Die Bezeichnung ‘Rum’ geht auf mittelgriech./lat. ‘Rōmē/Roma’ (Rom) zurück; das Gebiet war vorher im Besitz von Byzanz, (Ost-)Rom.
5 Das System der ikta weist mit dem späteren osmanischen mukataa-Wesen keine Gemeinsamkeit auf. Jedoch sind beide Wörter etymologisch verwandt, von denselben drei arabischen Radikalen q, ṭ und ʿain abgeleitet. Das seldschukische ikta-System kann eher mit der osmanischen Praxis der timar verglichen werden.
6 Die Dichtkunst des großen Poeten Mevlâna Celâleddin Rumî (1207–1273) vermittelt uns einen gewissen Einblick in die Geisteshaltung der seldschukischen Oberschicht. Die wichtigsten seiner Werke sind persisch geschrieben, nur wenig in der türkischen Muttersprache oder in einer persisch-türkischen Mischsprache.
7 D. h. ‘lichter Berg’; etwa 80 km in nordöstl. Richtung von Sivas entfernt gelegen.
8 Würdenträger, der für Staatsschatz- und Lehensangelegenheiten zuständig ist.
9 Arab. Ain Dschalut, Ort in Palästina.
10 Der arab. Titel Emir und der türkische Beg (seit der osmanischen Spätzeit Bey ‘bäi’ ausgesprochen) haben dieselbe Bedeutung: ‘Fürst.’
11 Durch Ausspracheverschleiß des pers. Titels Padischah, in der Bedeutung von ‘großer Herrscher’, entstanden.