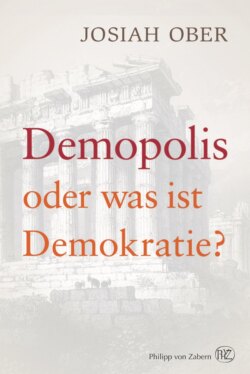Читать книгу Demopolis - Josiah Ober - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3. Normative Theorie, positive Theorie, historisches Denken
ОглавлениеWenn man wissen will, was Demokratie ist, wozu sie gut ist und welche Voraussetzungen sie braucht, muss man drei Ansätze miteinander verbinden. Da wäre zunächst einmal die normative politische Theorie, die sich hier mit der Frage beschäftigt, was wir als menschliche Wesen benötigen, damit es uns als Individuen und als Mitgliedern von Gemeinschaften gut geht, und wie wir versuchen könnten, dies sicherzustellen. Weiterhin brauchen wir die positive politische Theorie, die strategisches Verhalten analysiert: Auf diese Weise lässt sich erklären, wie Probleme kollektiven Handelns so gelöst werden können, dass die Gesellschaftsordnung ebenso stabil wie anpassungsfähig bleibt und soziale Kooperation möglichst viele Vorteile bringt. Drittens ist schließlich historisches Denken wichtig, das Veränderungen in der dynamischen Beziehung zwischen Normen und Institutionen sowie sozialem Verhalten im zeitlichen Verlauf nachzeichnet. Dieser gemischte Ansatz ist in der zeitgenössischen politischen Theorie nicht unbedingt üblich, wohl aber bei vielen sehr bekannten politischen Theoretikern der klassischen Antike und der frühmodernen westlichen Tradition, etwa bei Thukydides, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Smith, Montesquieu, Madison, Paine und Tocqueville. Die gegenläufigen und einander (gelegentlich) überschneidenden politischen Theorien zweier dieser Denker, nämlich Aristoteles (vor allem in Politik) und Thomas Hobbes (vor allem in Leviathan) werden in den folgenden Kapiteln eine wichtige Rolle spielen.26
Aristoteles, Hobbes und andere antike wie frühmoderne Theoretiker stellten fundamentale normative Fragen: Wie sollten in ihrer Entscheidung freie moralische Akteure ihr Gemeinwesen in Bezug auf Macht, Entscheidungsgewalt, Rechtswesen, Verteilung und Verhältnis zu anderen Einheiten ordnen? Was bräuchte man, um diese Gemeinwesen gerechter, legitimer oder demokratischer zu machen? Doch sie stellten auch fundamentale Fragen der „positiven Theorie“: Warum entscheiden sich einzelne Akteure so und nicht anders, und wie führen ihre Entscheidungen zu einem bestimmten Gemeinwesen, das im Hinblick auf Macht, Entscheidungsgewalt, Rechtswesen, Verteilung und Verhältnis zu anderen Einheiten so und nicht anders geordnet ist? Was würde man brauchen, um jene Ordnung so zu verändern, dass sie effizienter würde – dass sie zuverlässig mehr Menschen mehr und bessere Güter zu geringeren Kosten bereitstellen würde?
Die antiken und frühmodernen Autoren begriffen, dass ihre normativen und positiven Theorien eine empirische Grundlage brauchten, und jene suchten sie üblicherweise in der Geschichte. Sie kannten sich in diesem Bereich sehr gut aus und interessierten sich für historische Entwicklung. Trotzdem gehörten sie nicht zu den Anhängern des Historizismus, der jede Gesellschaft als das einzigartige und unvergleichliche Produkt ihrer eigenen Vergangenheit behandelt oder historische Prozesse als unausweichlich auf ein benennbares Ende zulaufend begreift. Vielmehr verwendeten sie die Geschichte, um den Bereich des Möglichen zu definieren und auszuweiten. Sie erkannten, dass die frühere Existenz einer bestimmten Gesellschaftsordnung das Argument, dass „eine solche Gesellschaft unmöglich“ sei, widerlegt. Sie glaubten, aus historischen Beispielen des Erfolgs und des Scheiterns lernen zu können.27
Wenn normative politische Theorie und positive Theorie heute scheinbar verschiedenen intellektuellen Welten angehören, hat das zumindest teilweise damit zu tun, dass die Fachleute der beiden Unterbereiche so unterschiedliche Sprachen verwenden: auf der einen Seite die Sprache der analytischen oder kontinentalen Philosophie und auf der anderen Seite die Sprache der Kausalschlüsse und der mathematischen Spieltheorie. Beide Sprachen können höchst technisch und für Nichteingeweihte undurchdringlich sein. Doch wie Bernard Williams (1993, 2005, 2006) gezeigt hat, kann politische Philosophie in eleganter Prosa geschrieben werden, und Michael Chwe (2013) hat mit Rückgriff auf die Romane von Jane Austen bewiesen, dass man für die Analyse sozialer Interaktion auf Basis spieltheoretischer Intuition nicht unbedingt Algebra braucht. Wenn wir die unterschiedlichen Sprachen außer Acht lassen, in denen zeitgenössische politische Philosophen und Sozialwissenschaftlicher ihre Theorien ausdrücken, und uns stattdessen den Ähnlichkeiten in den grundlegenden Fragen antiker wie frühmoderner politischer Theoretiker widmen, können wir sehen, dass die normative und die positive Theorie logisch miteinander verbunden sind. Sie bilden zwei Aspekte eines gemeinsamen Vorhabens, nämlich der Klärung der Frage, wie Entscheidungen, die Akteure in Gemeinschaften treffen, zu Formen sozialer Ordnung führen oder führen könnten, die mehr oder weniger wünschenswert sind.