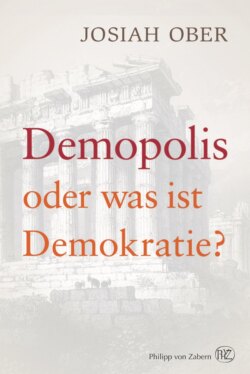Читать книгу Demopolis - Josiah Ober - Страница 20
Anmerkungen
Оглавление1 Athenische Demographie, politische Institutionen und historische Entwicklung im Verhältnis zu athenischer Politik und Gesellschaft: Ober 1989, 2008.
2 „Ungeheuerlich“: Xenophon, Hell. 1.7.12: Die Volksversammlung verurteilt die Generäle der Schlacht bei den Arginusen summarisch zum Tode. Reue: ebenda, 1.7.35.
3 Ober 2008: Kap. 2 bemisst Athens Leistungsfähigkeit als Stadtstaat im Verhältnis zu anderen griechischen Stadtstaaten. Ober 2016 schätzt Wohlstands- und Einkommensungleichheit innerhalb der gesamten athenischen Bevölkerung im späten 4. Jahrhundert v. Chr.
4 Dieser Abschnitt ist angepasst und aktualisiert Ober 2008b entnommen, wo das philologische Argument für die ursprüngliche Bedeutung von Demokratie erstmals eingeführt wurde.
5 Mögliche Daten für die Entstehung des Begriffs demokratia: Hansen 1986. Kritiker der Demokratie: Ober 1998. Demokratische Agonisten: unten, Kapitel 8, Anm. 5.
6 Zur Demokratie im hellenistischen 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. siehe Grieb 2008; Hamon 2010; Ma 2013; Teegarden 2014.
7 Das erste Auftauchen der griechischen Begriffe (mit Beispielstellen in den klassischen Autoren): Anarchia: Herodot 9.23; Aischylos, Suppl. 906. Aristokratia: Thukydides 3.82. Demokratia (und Verbformen): Herodot 6.43, Thukydides 2.37. Gynaikokratia: Aristoteles, Pol. 1313b. Dynasteia (als die schlechteste Form der Oligarchia): Aristoteles, Pol. 1292b10, 1293a31. Isegoria: Herodot 5.78, Demosthenes 21.124. Isokratia: Herodot 5.92.a. Isomoiria: Solon apud Aristoteles, Ath. pol. 12.3. Isonomia: Herodot 3.80; 3.142 (als Gegensatz zur dynasteia: Thukydides 4.78). Isopsephia: Dionysios von Halikarnassos 7.64. Isopsephos: Thukydides 1.141. Monarchia: Alkaios, Frag. 12; Herodot 3.82. Oligarchia (sowie aktive und passive Verbformen): Herodot 3.82.2; 5.92b; Thukydides 6.38 und 8.9; als Personifikation (auf dem Grabstein des Kritias): Scholion zu Aischines 1.39. Ochlokratia als negativ besetzte Form einer Herrschaft der vielen: Polybios 6.4.6 und 6.57.9. Timokratia: Platon, Pol. 545b; Aristoteles, Eth. Nic. 1160a. Ausführlichere Listen mit Belegstellen in Liddell, Scott und Jones 1968; Thesaurus Linguae Graecae: http://www.tlg.uci.edu/.
8 Demarchia bezieht sich nicht auf eine Regierungsform, sondern auf ein relativ untergeordnetes, lokales Amt (ho demarchos = der oberste Amtsträger in einer Stadt, der „Bürgermeister“). In diesem Fall bezieht sich das Präfix auf den Zuständigkeitsbereich des Amtes, nicht auf die Zahl der Herrschenden.
9 Alle diese Bezeichnungen sind im 5. Jahrhundert belegt, wobei oligarchia und aristokratia wahrscheinlich etwas später entstanden sind als demokratia, isokratia und monarchia.
10 Das Wort arche hat im Griechischen verschiedene miteinander verbundene Bedeutungen: Anfang (oder Ursprung), Reich (oder hegemonische Kontrolle eines Staates durch einen anderen), ebenso wie Amt oder Magistrat. Im klassischen Athen wurden jedes Jahr neun Archonten gewählt – neben mehreren Hundert anderen Amtsträgern: Hansen 1999. Zur Rolle von Ämtern im klassischen, insbesondere aristotelischen politischen Denken siehe Lane 2016.
11 Zum weiten Bedeutungsspektrum von kratos siehe Liddell, Scott und Jones 1968, s. v. Williams 1993: 105 verweist auf kratos als „physischen Zwang“ und die Assoziation des Wortes mit bia (Gewalt) in Aischylos’ Der gefesselte Prometheus. Vorherrschaft ist das, was Geuss 2008 als die Beziehung „wer über wen“ charakterisiert.
12 Positive Konnotationen: Liddell, Scott und Jones 1968, s. v. Aristoteles zur aristokratia: Politik 1279a34–37. Den Bedeutungsunterschied zwischen dem altgriechischen Begriff und mittelalterlichen und modernen Verwendungen von „Aristokratie“ betonen Fisher und van Wees 2015.
13 Isomoiria: „gleicher Anteil“ ist ein Begriff mit der Wurzel iso-, der offenbar aus einem etwas anderen semantischen Feld stammt. Solon, den die Athener später als den Vater der Demokratie betrachteten (Mossé 1979), spricht davon, dass die Unterschicht isomoiria im reichen Land Attika mit den Edlen forderte (kakoisin esthlous is[omoirian] echein: Ps.-Aristoteles, Ath. pol. 12.3 und Solon, fr. 34,9 West). Dies kann sich auf eine geplante Umverteilung von Land beziehen (siehe Rhodes 1981 ad loc.), obwohl auch andere Deutungen möglich sind. Thukydides (7.75.6) bezieht sich auf eine gewisse isomoiria, eine „Gleichheit im Unglück“ bei den sich zurückziehenden Soldaten in Sizilien 413 v. Chr., und merkt an, dass normalerweise mit vielen (polloi) geteiltes Leid Erleichterung bringe.
14 Leider kann ich die Gegenposition, dass in allen Fällen das, was betont wird (in normaler griechischer politischer Sprache, wenn auch nicht im philosophischen Vokabular eines Platon oder Aristoteles), das definierende Merkmal (besonders gut, weiblich, ehrenhaft, untereinander gleich) der Gruppe ist, die andere beherrscht, nicht widerlegen. Doch im Licht der positiven Konnotationen der betreffenden Begriffe (vielleicht mit der Ausnahme der gynaikokratia) und der allgemeinen griechischen Missbilligung einer brutalen Vorherrschaft von Herrschern über potenzielle Herrscher (freie, einheimische Männer im Gegensatz etwa zu Sklaven) wirkt dies weniger wahrscheinlich.
15 Daraus kann man auch ableiten, warum es keine monokratia oder oligokratia gibt: „der Eine“ und „die Wenigen“ gelten, wenn sie die Herrschaftsgewalt haben, als inhärent stark und befugt, durch Kontrolle über Geld, besondere Ausbildung und hohe Geburt. Ihre Befugnis, Dinge zu tun, stand also nicht infrage – es ging eher darum, ob sie den Regierungsapparat kontrollierten oder nicht.
16 Aristoteles macht sich darüber im Buch 3 der Politik Gedanken. Siehe die Diskussion bei Lane 2013.
17 Liddell, Scott und Jones 1968, s.v;Donlan 1970.
18 Athenische Revolution von 508 v. Chr.: Ober 2007; generelles Stimmrecht ansässiger Männer nach der Revolution: Badian 2000. Demos in der Versammlung als Synekdoche für die gesamte Bürgerschaft im athenischen öffentlichen Diskurs: Ober 1996: 117–122.
19 Thukydides 6.39.1: „Man wird behaupten, Demokratie sei weder klug (xyneton) noch billig (ison);die, die das Geld hätten, seien auch am besten geeignet, zu herrschen (archein). Ich aber behaupte erstens, dass ‚Volk‘ (demos) ein Name für das Ganze sei (xympas), ‚Oligarchie‘ nur für einen Teil (meros) …“
20 Platon, Polit., behält die Terminologie der Regierungsformen des 5. Jahrhunderts meist bei, „verdoppelt“ jedoch die Bezeichnung demokratia, sodass sie sich auf die Macht des Demos im positiven Sinn der „gesetzestreuen, begrenzten Herrschaft“ und im negativen als „gesetzlose Vorherrschaft“ bezieht. Bei Polybios (6.4.5) wird demokratia im 2. Jahrhundert v. Chr. zum generischen Begriff für „legitime, rechtstreue, republikanische Regierung“ – und steht damit im Kontrast zur ochlokratia, einem Neologismus für „gesetzlose Herrschaft des Pöbels“.
21 Diese Deutung ist konsistent mit der Verbindung von demos und kratos in Aischylos’ Die Schutzflehenden aus der Zeit um 463 v. Chr., wo sich angeblich die frühesten Umschreibungen des Wortes demokratia finden: „die herrschende Hand des Volkes“ (demou kratousa cheir: 604); „das Volk, die Macht, die die polis regiert“ (to damion, to ptolin kratynei: 699).
22 Zu den philosophischen Fundamenten einer methodologisch individualistischen Theorie des gemeinsamen Handelns folge ich Bratman 2014; Bratmans Theorie gemeinsamen Handelns haben Ober 2008; Stilz 2009; Pettit 2013 auf die Demokratie im Großen übertragen. Siehe dazu auch Kapitel 6.2.
23 Teilhabenorm, die reichlich Raum für die Verfolgung individueller Projekte lässt: Thukydides 2.40.2; politische Freiheit: Hansen 1996; politische Gleichheit: Raaflaub 1996; staatsbürgerliche Würde: Ober 2012.
24 Griechische Demokratie außerhalb Athens: Robinson 1997, 2011. Polybios über Demokratie: bes. 6.4.5; zur gemischten Regierung: 6.11.11.
25 Ostrakismos: Forsdyke 2005; Ober 2015b: 174–175.
26 Athenische Verfassungsreformen des späteren 5. Jahrhunderts v. Chr. und danach: Hansen 1999; Canevaro 2015; ihr Kontext: Shear 2011; Carawan 2013. Motivation für Veränderungen: Carugati 2015, mit Literaturüberblick.
27 Zur Bedeutung der Präambel für eine demokratische Lesart der Verfassung siehe Amar 2005.
28 Repräsentative Demokratie: Pitkin 1967; Manin 1997; Urbinati 2006. Achen und Bartels, 2016 und Caplan 2007 sind markante Vertreter des Arguments, dass das Volk unter den Bedingungen der Moderne zu einer effektiven gemeinsamen Selbstregierung nicht fähig sei. Wie andere liberale Kritiker der Demokratie legen sie aber dennoch offensichtlich großen Wert darauf, den Begriff „Demokratie“ für die von ihnen bevorzugte Regierungsform beizubehalten, eine Strategie, die an Polybios erinnert. Natürlich ist Demokratie als eine Form organisatorischer Führung nicht nur für Staaten möglich; siehe zum Beispiel Manville und Ober 2003.