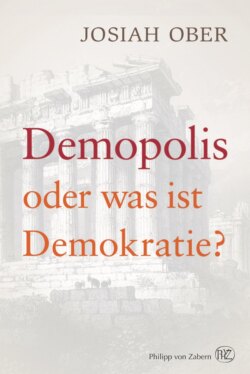Читать книгу Demopolis - Josiah Ober - Страница 17
2.1. Die politische Geschichte Athens
ОглавлениеMit einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 250.000 Personen, einer (erwachsenen männlichen) Bürgerschaft von mehreren Zehntausend Personen (vielleicht bis zu 50.000+ um 431 v. Chr.; etwa 30.000 im 4. Jahrhundert v. Chr., dem Zeitalter des Platon und Aristoteles) und einem Heimatterritorium von etwa 2500 km2 handelte es sich bei Athen um einen besonders großen Stadtstaat. Es war zudem außergewöhnlich vielfältig, umfasste mehrere unterschiedliche Regionen, viele lokale Kulte und Hunderte ökonomische Spezialisierungen. Die Athener waren sich der Unterschiede zwischen den einzelnen Schichten sehr bewusst. Die Organisation dieser Vielfalt innerhalb der Bürgerschaft gehörte zu den vorrangigen Aufgaben stadtstaatlicher Institutionen (Ober 1989). Athens Größe erwies sich erst dann als Vorteil, als nach der Revolution von 508 v. Chr. die bürgerliche Identität durch mehrere dramatische Reformen gestärkt und ein koordiniertes politisches Handeln einer großen Bürgerschaft bei Angelegenheiten von allgemeinem Interesse möglich wurde.
Bedeutende postrevolutionäre demokratische Reformen machten alle männlichen Einwohner und (in der Zukunft) ihre männlichen Nachkommen ohne jede Besitz- oder Einkommensqualifikation zu mitbestimmenden Bürgern. Die neue Ordnung schuf auch einen Bürgerrat, der per Los aus den verschiedenen Regionen der Polis bestimmt wurde. Dieser Rat erledigte den Großteil des alltäglichen Regierungsgeschäfts und bestimmte die Tagesordnung einer gesetzgebenden Versammlung, an der alle Bürger teilnehmen durften. Im 4. Jahrhundert v. Chr. trat diese Versammlung jährlich 40-mal zusammen; durchschnittlich nahm ein Fünftel bis ein Viertel aller Bürger daran teil. Die versammelten Bürger diskutierten über Gesetzesvorschläge und stimmten direkt darüber ab. Jede Stimme besaß das gleiche Gewicht. Auch die Geschworenen in den Volksgerichten und die meisten Magistrate wurden per Los bestimmt. Einige wenige Amtsträger, vor allem Militärbefehlshaber, Bautechniker und (später) bestimmte Finanzbeamte wurden für ein Jahr mit der Möglichkeit einer Verlängerung gewählt. Alle Bürgerbeamten mussten sich nach einem Dienstjahr einer offiziellen Befragung stellen.
Die Demokratie Athens war eine unmittelbare Regierung durch die Bürger. Die versammelten Bürger stimmten direkt über die politischen Entscheidungen ab; sie wählten keine Repräsentanten, um für sie zu entscheiden. Und doch führt die gängige Ansicht, dass die Repräsentation ein rein modernes Konzept und dem antiken demokratischen Denken völlig fremd sei (z.B. Rosanvallon 2006: 62), in die Irre. Man stellte sich nämlich den athenischen Demos (also die Gesamtheit der Bürger) in Gestalt jener Bürger vor, die an der jeweiligen Versammlung teilnahmen. So wurde der Demos konzeptuell durch einen Teil der Bürger repräsentiert. Ähnlich wurden die Entscheidungen von den 500 ausgelosten Ratsherren, von Geschworenengerichten (üblicherweise bestehend aus 201 oder 501 Bürgern, die älter als 30 Jahre waren) und ausgelosten „Gesetzgebern“ (s.u. 2.3) als Entscheidungen des gesamten Volkes verstanden und waren für die gesamte Gemeinschaft bindend (Ober 1996: Kap. 8). Weil Athen verglichen mit den meisten modernen Nationalstaaten sehr klein war, sahen sich die Athener nicht mit den Problemen konfrontiert, die entstehen, wenn man die Regelsetzung an gewählte Repräsentanten delegiert (Kapitel 7). Es gibt aber in der athenischen Vorstellung von Demokratie, der wir uns unten (Kapitel 2.2) zuwenden, nichts, das eine politische Repräsentation unmöglich machen würde.
Athens Demokratie dauerte mit zwei kurzen oligarchischen Zwischenspielen (410, 404 v. Chr.) bis 322 v. Chr. an. Die athenische politische Kultur entfaltete sich 180 Jahre lang, und die athenische Regierung erwies sich als überaus anpassungsfähig. Verständnis und Praxis der Demokratie wurden immer weiter verfeinert. Rede- und Versammlungsfreiheit, Gleichheit der Stimmen und des Zugangs zu Ämtern und staatsbürgerliche Würde als Freiheit von Demütigung und Bevormundung wurden durch formale Regeln und damit verbundene Verhaltensnormen gestärkt. Die Athener justierten die institutionellen Mechanismen ihrer Regierung regelmäßig. Im Laufe des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurden Gesetze beschlossen, die eine Bezahlung für viele Formen des öffentlichen Dienstes einführten, darunter auch für den Dienst als Geschworener in den Volksgerichten. Im Jahr 451 v. Chr. wurde das Bürgerrecht von Geburt an auf die legitimen Söhne einheimischer Frauen, die mit einheimischen Männern verheiratet waren, beschränkt, und damit wurden im Grunde die Athenerinnen als Mitteilhabende an der Bildung der Bürgerschaft anerkannt (während den Söhnen ausländischer Ehefrauen athenischer Männer das Bürgerrecht verweigert wurde). Im späten 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. beschränkten Verfassungsänderungen, die weiter unten in diesem Kapitel dargestellt werden, die direkte gesetzgeberische Macht der Bürgerversammlung, ohne die kollektive Macht der Bürger über alle Aspekte der Staatsregierung zu verringern. Es gab einige weitere institutionelle Innovationen Athens, die wir im Folgenden betrachten werden; doch vom Anfang bis zum Ende der demokratischen Ära blieb die Demokratie im Kern als Selbstregierung der Bürger erhalten.
Die athenische politische Entwicklung bietet erste, historisch bedingte Antworten auf die Fragen, mit denen wir angefangen haben – Fragen dazu, was Kerndemokratie ist, warum sie entsteht, wie sie aufrechterhalten wird und wozu sie gut ist. An unseren heutigen Normen gemessen war Athen von einer liberalen Gesellschaft weit entfernt: Die athenische Demokratie entstand in einem kulturellen Rahmen, in dem aktive Teilhabe an der Regierung als Gesetzgeber, Geschworener oder Beamter strikt auf Männer und im Normalfall auf einheimische Männer beschränkt war. Die Sklaverei war stark verbreitet (vielleicht waren bis zu einem Drittel aller Einwohner Athens Sklaven) und galt weitgehend als selbstverständlich. „Frevel gegen die Götter“ war zwar nicht im Einzelnen im athenischen Recht definiert, stellte aber ein Kapitalverbrechen dar. Der Ostrakismos vertrieb in bestimmten Fällen (immerhin nur temporär) Einzelne aus dem Staatsterritorium – ohne Prozess oder den Vorwurf eines Verbrechens –, wenn eine Mehrheit der Mitbürger sie als gefährlich oder in anderer Weise störend empfand. Und doch erfüllt die klassische athenische Definition von Demokratie zumindest meiner Ansicht nach die im ersten Kapitel angebotene vorläufige Definition von Kerndemokratie. Das Gedankenexperiment Demopolis, wie ich es im nächsten Kapitel darstellen werde, versucht, die Merkmale der Kerndemokratie zu verallgemeinern, indem es sie von den Besonderheiten der antiken griechischen Geschichte, Kultur und politischen Praxis loslöst.
Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, kann keine Definition von Demokratie letzte Gültigkeit beanspruchen. Wichtig ist aber, dass Demokratie ursprünglich – und für die griechische Demokraten in der gesamten klassischen Antike – nicht „Tyrannei der Mehrheit“, sondern vielmehr „gemeinsame Selbstregierung durch die Bürger“ bedeutete. Zudem war die kollektive Macht der Bürger, einfach das zu tun, was sie wollten, wann immer sie sich als Körperschaft versammelten, von Anfang an durch Verfassungsregeln beschränkt. Sicher konnten athenische Populisten behaupten: „Es ist ungeheuerlich, wenn der demos nicht tun kann, was er will“, und populistische Demagogen brachten den versammelten Demos auch gelegentlich dazu, unüberlegt zu handeln, gegen seine eingeführten Normen, gegen seine Interessen und so, dass er es später bereute.2 Doch dabei handelte es sich um Ausnahmen von der gängigen Praxis der an Regeln und Normen gebundenen Entscheidungsfindung. Wenn es häufiger solche irrationalen Akte gegeben hätte, wäre Athen in der kompetitiven Welt griechischer Stadtstaaten schnell gescheitert. Historisch entwickelten sich sogar klarere Regeln mit dem Ziel, den populistischen Opportunismus von Demagogen zu sanktionieren. Die athenische Demokratie erwies sich als robust angesichts extremer Erschütterungen wie der Zerstörung der Stadt durch Invasoren, einer Seuche, die wenigstens ein Viertel der Bevölkerung innerhalb weniger Jahre dahinraffte sowie eines extrem verlustreichen, sich lange hinziehenden Krieges. Zudem vermochte sie die meiste Zeit und für einen Großteil der Bevölkerung Athens ein relativ hohes Niveau an Sicherheit und Wohlstand zu bieten.3
Da die Kerndemokratie in der komplexen athenischen Gesellschaft lange Zeit mehr oder weniger stabil und effektiv funktionierte, lässt sich das Argument, es könne keine Kerndemokratie gegeben haben, ipso facto widerlegen. Es ist somit bewiesen, dass die Kerndemokratie mit den Ansprüchen der menschlichen Natur und des menschlichen Verhaltens, wie sie sich in relativ großen Gesellschaften zeigen, vereinbar ist. Natürlich war das antike Athen, wie bereits erwähnt, mit seiner Gesamtbevölkerung von einigen Hunderttausend Menschen winzig in Vergleich zu wichtigen modernen Nationalstaaten. Zudem besaß Athen zwar nach den Maßstäben der griechischen Antike eine überaus breit gefächerte Bevölkerung, und diese Vielfalt wurde auch schnell als ein Merkmal der Demokratie erkannt (Platon, Staat, Buch 8), doch war der Stadtstaat sicher nicht pluralistisch in dem Sinne, dass er größere Minderheiten mit primären Identitäten und politischen Präferenzen aufwies, die sich anhand unflexibler und anspruchsvoller monotheistischer Traditionen definierten. Fragen danach, wie weit eine Kerndemokratie wohl wachsen und ob sie den Anforderungen eines großen und pluralistischen Nationalstaats unserer Zeit gerecht werden könnte, sollen später beantwortet werden.