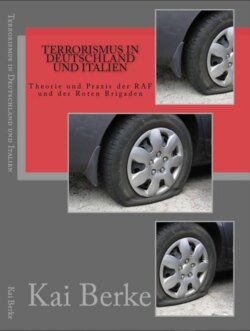Читать книгу Terrorismus in Deutschland und Italien: Theorie und Praxis der RAF und der BR - Kai Berke - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Notstandsgesetze
ОглавлениеSeit 1955 gab es in der Bundesrepublik einen Streit darum, ob das Grundgesetz hinreichend Gewähr für die gesetzliche Bewältigung eines Krisen- oder Verteidigungsfalles bieten konnte. Strittig war dabei insbesondere die Frage, inwieweit alliierte Vorbehaltsrechte durch den Deutschlandvertrag von 1955 und die Verabschiedung der Wehrverfassung 1956 bereits abgelöst waren und inwieweit eine mögliche Krisensituation einer eigenen Gesetzgebung einschließlich einer Grundgesetzänderung bedürfe.
Der Konflikt, der sich über 13 Jahre hinzog, ist an dieser Stelle nicht im Detail nachzuzeichnen. Zu erwähnen ist aber, dass mit den verschiedenen Einzelgesetzen eine systematische Suspendierung elementarer Grundrechte für den Verteidigungsfall verbunden war, die SCHLENKER zu einem Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten 1933 provoziert.
Gegen die verschiedenen Entwürfe der verschiedenen Innenminister regte sich entschiedener und grundsätzlicher Widerstand zunächst nur von Gewerkschaften und prominenten Einzelpersonen wie Jürgen Seifert, Heinrich Hannover u.a. Die SPD dagegen war grundsätzlich zur Mitarbeit bereit und bezweifelte nicht die Notwendigkeit von Notstandsgesetzen sondern nur einzelne – teilweise sehr wichtige- Details. Zur Verbreiterung des Widerstandes kam es ab 1966 durch das wachsende Engagement von studentischen Gruppen wie dem SDS, der die Ablehnung des Gesetzespakets als „Klassenkampf im Innern“ mit einer Kritik des Gesellschaftssystems verband.
Nachdem die Teile des Gesetzespakets, die keiner Grundgesetzänderung bedurften, bereits 1965 verabschiedet worden waren, blieb es der Großen Koalition 1968 vorbehalten, die symbolträchtige Grundgesetzänderung zu beschließen.