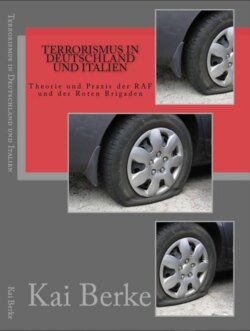Читать книгу Terrorismus in Deutschland und Italien: Theorie und Praxis der RAF und der BR - Kai Berke - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStrukturelle und gesellschaftspolitische Gründe für die Isolation des bewaffneten Kampfes
Ich stelle nun einige Thesen über die gesellschaftliche und politische Lage in der Zeit der SPD/FDP- Koalition bis 1977 auf, die die Isolation des bewaffneten Kampfes von der Bevölkerung zu begründen geeignet erscheinen.
1. Die materielle Lage möglicher Zielgruppen, wie Arbeiter, Studenten oder soziale Randgruppen ist so weit abgesichert, dass das ökonomische Konfliktpotential zur Begründung einer Totalopposition nicht ausreicht.
2. Die Außenpolitik der Bundesregierung ist nicht geeignet, als Beleg für aggressiv- imperialistisches Machthandeln zu gelten.
3. Ebenso wenig kann die Reformpolitik im Innern als faschistisch bezeichnet werden.
4. Insgesamt hat die Reformphase der Brandt- Ära die postmateriellen Bedürfnisse, die die 68‘er- Revolte getragen hatten, in vielen Bereichen befriedigt.
Die Lage der Arbeiterklasse
Die Industriearbeiter sind Subjekt eines materialistischen Gegensatzes zwischen Lohnarbeit und Kapital, der – wie erwähnt – nicht im Mittelpunkt der Revolte (und auch nicht im Mittelpunkt der RAF- Theorie) stand. Trotzdem sollen hier einige Bemerkungen zur Integration der Arbeiterklasse in das Gesellschaftssystem der Bundesrepublik gemacht werden.
Zunächst muss festgestellt werden, dass das Klassenbewusstsein und die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse und ihrer Parteien und Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland erheblich niedriger ist als z. B. in Italien. Das hängt zum einen mit der auf Konsens ausgerichteten betrieblichen wie gesellschaftlichen Konfliktregulierung zusammen, zum anderen mit dem ständig steigenden Reallohn und dem entsprechend steigenden Lebensstandard. Da dieser in den Zeiten wirtschaftlicher Prosperität grundsätzlich für alle anstieg, wurde die durch die größer werdende Einkommensschere bedingte relative Deprivation der Arbeiter als gerechtfertigtes Leistungsprinzip akzeptiert. SCHEERER bezeichnet die Einbindung der Arbeiterklasse als Kooptation in einen korporativen Rahmen, die sich z. B. in der Mitverantwortung der Arbeitervertretungen für das Betriebswohl äußert.
Kommt es in Folge einer Wirtschaftskrise wie 1966/67 doch einmal zu einer realen Verschlechterung – damals wurden die Arbeitsbedingungen in vielen Betrieben intensiviert und monotonisiert- wird der Frust darüber aufgrund mangelnden Klassenbewusstseins eher auf ethnischer als auf Klassen- Basis abgebaut.
Insgesamt kann man sagen, dass die gewerkschaftlichen wie die (wenigen) wilden Streiks auf höheren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen ausgerichtet sind, nicht jedoch auf Systemveränderung und Sozialismus. Insofern war die Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972, in dem u.a. die betriebliche Mitbestimmung erheblich erweitert wurde, ein gelungener Beitrag zur festen Integration der Arbeiter in das kapitalistische Wirtschaftssystem der Bundesrepublik.
Die Entwicklung des Bildungssektors
Kritik an der Politik der Bundesregierung ging Ende der 60‘er Jahre, wie dargestellt, in erster Linie von Intellektuellen und Studenten aus. Da die ökonomischen Erklärungsansätze wenig überzeugend sind und mithin die Inhalte und Aktionsformen der Studentenbewegung nicht erklären können, ist es m. E. eher die allgemeine Reformpolitik als die spezielle Bildungspolitik der neuen Regierung, die die Studenten wieder in das Gesellschaftssystem reintegrierte. Trotzdem soll nicht verschwiegen werden, dass die Zugangschancen zu weiterführenden Schulen und zur Universität durch die Brandt- Regierung nicht zuletzt durch Einführung des BAföG für Kinder aus Arbeiterfamilien erhöht wurden.
Die Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition
Als bleibende Leistung der Amtszeit Willy Brandts gilt (zu Recht) die Entspannungspolitik gegenüber den Staaten des Ostblocks. Nach der von den Vorgängerregierungen vollzogenen Westintegration der Bundesrepublik war es das große Verdienst des Sozialdemokraten und späteren Friedensnobelpreisträgers Brandt, die europäische Nachkriegsordnung anerkannt und die Aussöhnung mit den Staaten Osteuropas vorangetrieben zu haben. Grundlage hierfür waren die Verträge von Moskau und Warschau von 1970, die einen Gewaltverzicht und die Anerkennung der bestehenden Grenzen –einschließlich der Aufgabe des Anspruchs auf die deutschen Ostgebiete- umfassten und der Grundlagenvertrag mit der DDR von 1972, der ein geregeltes Nebeneinander auf friedlicher Basis ermöglichte.
Diese Abwendung von der Ideologie des „Kalten Krieges“, die die USA und die UdSSR schon in den 60‘er Jahren im Rahmen der „friedlichen Koexistenz“ begonnen hatten, fand die Zustimmung sehr großer Teile der deutschen Bevölkerung, wie die zum Plebiszit über die Ostverträge stilisierten vorgezogenen Bundestagswahlen von 1972 eindrucksvoll bestätigten. In dieser Phase, in der die Regierung ihre ganze Aufmerksamkeit der Entspannungspolitik und der Sicherung des Friedens widmete, war eine Mobilisierung der breiten Massen für den bewaffneten Kampf mit dem Argument der angeblich „aggressiven imperialistischen Politik“ nicht möglich.
Innenpolitische Reformen
In der Innenpolitik ist eine systematische Bestandsaufnahme schon schwieriger, da hier auf den verschiedenen Themenfeldern nicht so konsequent ein „roter Faden“ verfolgt wurde wie in der Außenpolitik. Es wird aber oft zwischen zwei Phasen der sozialliberalen Koalition unterschieden. Einer Reformphase von 1969 bis ca. 1972/73 unter dem Kanzler Brandt und eine pragmatische oder technokratische Phase von 1973/74 bis 1982. Die Politik bis 1973 hat durch ihren Akzent auf der Liberalisierung und Demokratisierung des Staates zur gesellschaftlichen Isolation der RAF beigetragen, die den Staat faschistisch reden wollte; die Folgejahre waren eher bestimmt von der juristischen Isolation der RAF, deren Wirkung im fünften Kapitel beschrieben werden wird und die in ihrem willkürlichen Charakter eher zur Verlängerung des Phänomens RAF beigetragen haben.
Ich habe schon ausgeführt, dass es sich bei der 68‘er- Bewegung in Deutschland- anders als in Italien- nicht um eine am Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital orientierte Bewegung handelte, sondern dass es um postmaterielle Werte ging. Dieses Streben nach individueller Freiheit und nach Partizipationsmöglichkeiten und „echter“ Demokratie wurde z. T. schon mit dem Regierungswechsel als solchem befriedigt. Die Tatsache, dass ein Regierungswechsel zu einer Regierung jenseits der CDU überhaupt möglich war, bewies das Funktionieren der Demokratie und es war mehr als nur ein Symbol, dass die neue Regierung im Mai 1970 eine Amnestie für Straftaten im Zusammenhang mit der APO erließ und zugleich das Demonstrationsrecht liberalisierte. Auch der Forderung nach Lockerung der Moralvorstellungen, die am vehementesten von der Kommune 1 vertreten wurde, kam die Koalition mit der Streichung des Kuppelei- Paragraphen und der Entschärfung der Pornographie- Vorschriften nach. Die sozialliberale Koalition ging auf beinahe allen Politikfeldern mit einem solchen Elan an die Arbeit, dass es als Ironie des Schicksals zu werten ist, dass sie gerade in dieser demokratischsten Periode der Bundesrepublik durch das Verschrecken der neuen Mittelschichten den Grundstein für spätere Wahlniederlagen legten.