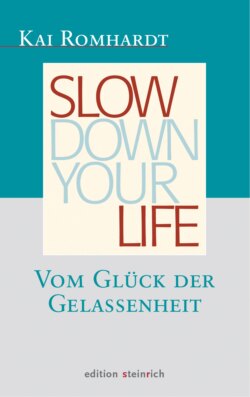Читать книгу Slow down your life - Kai Romhardt - Страница 20
Der fünfte Schlüssel: Rhythmik
ОглавлениеUnser Leben ist in vielfältige innere und äußere Rhythmen eingebettet. Wenn wir diese Rhythmen erkennen und respektieren, werden wir von ihnen getragen.
Das menschliche Leben hat sich über die Jahrhunderte immer weiter von natürlichen Rhythmen losgelöst. Heute können wir die Nacht zum Tage machen und im Winter Erdbeeren essen. Mit der Uhrzeit haben wir uns einen künstlichen Takt geschaffen, über den wir unsere Aktivitäten immer stärker aufeinander abgestimmt haben. Der Ausdruck und die Wahrnehmung unserer inneren Rhythmen ist dabei schwieriger geworden. Der Gerontologe Heinz Jürgen Kaiser macht dies am Beispiel der Interpretation eines Musikstücks deutlich:
Vor der Erfindung des Metronoms wurde das Zeitmaß der Musik von der individuellen Befindlichkeit des jeweiligen Interpreten gesteuert. Was ›lebhaft‹ oder ›getragen‹ bedeuten sollte, bestimmte er im Augenblick des Musizierens. Das Metronom hat den individuellen Rhythmus durch einen von außen fest vorgegebenen, reproduzierbaren Takt ersetzt. Es hat eine Entrhythmisierung zugunsten starrer Taktgefüge stattgefunden und damit bezeichnenderweise auch eine immer stärkere Beschleunigung.
Dieser Zusammenhang ist für Slowing down essenziell. Welche Metronome ticken in uns und um uns herum? Welchem Takt folgen wir? Tanzen oder marschieren wir durchs Leben?
Um unser Gefühl für Rhythmik zu vertiefen, braucht es Freiräume. Dort strukturiert nicht das Ticken der Uhr unser Leben, sondern die jeweilige Situation in ihrer Einmaligkeit. Stundenpläne, Projektpläne und Arbeitszeiten können sehr sinnvoll sein, doch sie dürfen nicht alles andere dominieren. Sie sind Mittel zum Zweck, nicht mehr.
Als John Franklin 1823 nach etlichen Jahren von einer Nordmeerfahrt nach London zurückkehrte, stellte er eine charakteristische Veränderung fest: Jetzt waren die Londoner Zifferblätter weiß. Viele Uhren hatten Sekundenzeiger wie vorher nur die Schiffschronometer. Uhren und Menschen waren genauer geworden. John hätte das gutgeheißen, wenn daraus mehr Ruhe und Gemessenheit entstanden wäre. Stattdessen beobachtete er überall nur Zeitknappheit und Eile.1
Was heutzutage an Zeit »eingespart« wird, wird häufig nicht ans Leben zurückgereicht, sondern für weitere Beschleunigung genutzt. Diese Entwicklung gilt es zu brechen. Seit ich keine Armbanduhr mehr trage, entwickeln sich meine Tage entspannter. Erstaunlicherweise bin ich nicht weniger pünktlich geworden. In diesem Buch finden Sie viele Übungen, wie Sie sich aus einem starr gewordenen Zeitkorsett befreien können.
Wenn wir uns »uhrzeitfreie Nischen« schaffen, sehen wir klar, dass unser Leben voller lebendiger Rhythmen ist, die Beachtung verlangen und verdienen. Müdigkeit und Wachheit. Tun und Lassen. Alleinsein und Gemeinschaft. Geschwindigkeit und Langsamkeit. Das Leben will zwischen diesen natürlichen Polen tanzen, statt im starren Takt voranzumarschieren. Im Einklang mit diesen Rhythmen zu leben, fördert Slowing down.
Wir sollten uns immer wieder klarmachen, dass Zeit lediglich eine Idee ist. Eine äußerst kraftvolle, eine alles durchdringende, aber eben nur eine Idee. Das Zeitverständnis, das den Westen prägt, ist linearer Natur. Die Dinge folgen einander. Eins nach dem anderen. Es gibt aber auch zirkuläre Vorstellungen von Zeit. Sie verweisen auf das Gesetz der Wiederkehr und zeigen uns die Interdependenz der Phänomene auf. Ohne Ebbe keine Flut. Ohne Einatmen kein Ausatmen. Wir können wählen, welchem Zeitverständnis wir uns wie weit anvertrauen.
Lineares, zielorientiertes Denken versucht Pausen und nicht produktive Zeiten aus einem Leistungsprozess zu eliminieren. Zirkuläres Denken sieht die Pausen hingegen als integrativen Teil des Gesamtprozesses und vermeidet die Unterscheidung in produktiv und unproduktiv.
Die subtilen Wechselwirkungen zwischen Aktivität und Pause zu erkennen, ist für Slowing down zentral. Wir sollten uns fragen, wie wir wieder zu unseren kleinen und großen Pausen kommen, die im Namen der Effizienz aus unserem Leben verschwunden sind.
Wenn alte Rhythmen wegbrechen (Entlassung, Pensionierung, Scheidung) oder wir sie bewusst aufgeben (Sabbatical, Reisen), mag zunächst natürliche Angst aufsteigen. Viele von uns sind es nicht mehr gewohnt, mit unstrukturierter Zeit umzugehen. Doch durch die Angst hindurch steigen bald neue Rhythmen in uns auf. Auf diese gilt es zu hören. Dann finden wir auch Umfelder, in denen unser neuer Takt lebbar ist. Es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche »Zeitnischen« in unserer Gesellschaft nebeneinander existieren. Solange wir in der »Mühle« stecken, ist dies schwer vorstellbar. Slowing down heißt zu wählen, welchen Rhythmen wir uns bewusst aussetzen und welchen wir uns bewusst entziehen.
Wenn sich unsere Rhythmik verfeinert, entwickeln wir natürliches Taktgefühl. Taktgefühl bezeichnet die Fähigkeit, die aktuelle Situation umfassend zu erspüren und das Angemessene, das Förderliche zu tun. Wir fühlen uns ein. Wir schwingen mit. Und die Schwingungen sind in jeder Situation andere. Slowing down kultiviert das Gefühl für Rhythmus und Takt. Wer Taktgefühl hat, ist das Gegenteil von einem Metronom, das im Gleichtakt tickt. Wer seinen Rhythmus gefunden hat, dem gehen die Dinge mühelos von der Hand und seine Tätigkeiten strahlen Würde aus.