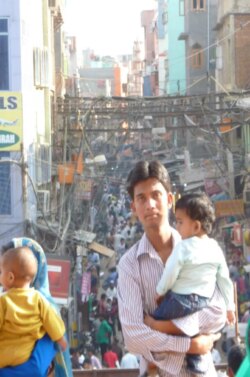Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 101
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAufklärung, Zeitalter der
In seiner bahnbrechenden Studie „O wär‘ ich nie geboren!“ führt Rölleke über das Zeitalter der Aufklärung aus: „Jene vernunftgläubige, sich optimistisch gebende Epoche hatte kaum Sorgen mit existentiellen Fragen und Nöten grundsätzlicher Art; ganz im Gegenteil: Hier mehren sich die Stimmen, die das Geschenk des menschlichen Lebens freudig preisen.“ (Rölleke, S. 29f) Denken wir neben anderen an Voltaire, Ratschky (Ach! Wär‘ ich kinderlos!), Lessing oder Kant, war die Epoche der Aufklärung vielleicht doch nicht so durchgängig daseinsfroh wie Rölleke unterstellt.
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724–1803)
Als Reaktion auf die unheilvolle Kette der Fortzeugungen, in die hineingestellt man sich vorfindet und in die man andere hineinstellt, gestaltet Klopstock einen selten anzutreffenden antinatalistischen Doppelfluch:
„Wenn mit gerungenen Händen die Braut um den Bräutigam wehklagt;
Wenn nun, aller Kinder beraubt, die verzweifelnde Mutter
Wütend dem Tag', an dem sie gebar, und geboren ward, fluchet.“
(Klopstock, Der Messias, AW, S. 260)
Sophie von La Roche (1730–1807)
In „Rosaliens Briefen“ der deutschen Salonnière Sophie von La Roche (1730–1807) begegnet uns die philanthropisch-antinatalistische Madame Fr**, die deshalb nicht den Existenzbeginn eigener Kinder bewirken möchte, weil diese unweigerlich leiden oder anderen Menschen Schaden zufügen würden (Heils- und Unheilspropensität). Man macht ihr deswegen – im daseinsfrohen Sinne, den Rölleke der Aufklärung insgesamt unterstellt – einen Vorwurf, der sich vielleicht dahingehend deuten lässt, sie halte diese Kinder lebendig begraben, indem sie „sie“ nicht zeugt:
„Die gute Madame Fr** wünschte kinderlos zu seyn, um dem doppelten Elend zu entgehen, ihre Kinder leidend, oder übelthätig zu sehen: und mir kam es höchst traurig vor, dass das mütterliche und menschenfreundliche Herz der Frau Fr** für das Glück und die Tugend ihrer Kinder keinen andern Zufluchtsort erblickte, als das Grab.“ (Sophie von La Roche, Rosaliens Briefe, Bd. 1, S. 209)
Matthias Claudius (1740–1815)
Gegen den nach seinem Dafürhalten dunklen Topos des Nichtgeborenseinwollens bringt Rölleke die lichte Daseinsdankbarkeit eines Matthias Claudius‘ ins Spiel, die für das Zeitalter des Aufklärung typisch gewesen sei. Doch ausgerechnet Claudius macht sich nachstehend Gedanken, die die Sorgen der oben erwähnten guten Madame Fr** zu bestätigen scheinen:
„Sieht Er, wenn ich die Welt und das Leben, wie es darin geführt wird, ansehe; so gehen mir alle Kinder und sonderlich meine eigne, die da hinein und da durch sollen, im Kopf herum, und ich möchte sie wohl gegen das Verderben einbalsamieren und feuerfest machen können. Wahrlich die Leute haben nicht unrecht, die darüber in Ernst nachsinnen und in sich zu Rat gehen.“ (Claudius, Asmus omnia sua secum portans, S. 310) Man möchte Claudius mit dem paradoxen Satz stärken: Den größten Dienst erweist man Kindern, indem man sie nicht hat.