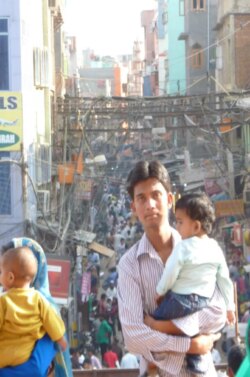Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 92
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеArendt, Hannah (1906–1975) – Mutter der Natalität (Gebürtlichkeit)
Hannah Arendt ist die Mutter des Natalität (Gebürtlichkeit). Manche ihrer Adepten versuchen gar, diesen Begriff ins Zentrum ihrer Philosophie zu stellen, um von dort aus gegen eine vermeintliche Todesversessenheit der Philosophie vorzugehen und auf die Geburtsvergessenheit aufmerksam zu machen.
Arendt sieht der Conditio inhumana durchaus ins Auge, sie erwähnt das „Leiden, von dem es immer zu viel auf der Erde gegeben hat...“ (Arendt, Elemente…, S. 941) Und als Gesellschaftstheoretikerin stellt sie nicht in Aussicht, dass sich dies ändern könnte. Gleichwohl erteilt sie der Fortsetzung der bisherigen Geschichte keine Absage, sondern hält unter Hochhaltung der Gebürtlichkeit an der Fortpflanzung leidenmüssender Menschen fest.
Arendts narrative Anthropodizee
Auch wenn man sie als Mutter der Gebürtlichkeit bezeichnen mag, rekurriert Arendt nicht auf den Begriff der Natalität, um das zu leisten, was dem Versuch einer Anthropodizee am ehesten gleichkommt. Gegen unsere Todesgebürtlichkeit (Thanatalität) bietet sie in ihrem Werk Vita actica nicht die Natalität auf, sondern verfolgt diesen Ansatz:
„Dass wir es als Lebende überhaupt aushalten, mit dem Tod vor Augen zu existieren, dass wir uns nämlich keineswegs so verhalten, als warteten wir nur die schließliche Vollstreckung des Todesurteils (Todesurteil lebenslang) ab, das bei unserer Geburt über uns gesprochen wurde, mag damit zusammenhängen, dass wir jeweils in eine uns spannende Geschichte verstrickt sind, deren Ausgang wir nicht kennen. Der Lebensüberdruss, das taedium vitae, ist vielleicht nichts anderes als ein Erlahmen dieses Gespanntseins.“ (Arendt, Vita Actica, S. 184)
Arendt lässt hier außer Betracht, dass wir nicht nur in (eine) Geschichte(n) verstrickt sind, sondern bionome Imperative und soziale Anforderungen uns zu Tätigkeiten nötigen, ohne die unser Stoffwechsel alsbald zum Erliegen käme oder unser sozialer Abstieg bevorstünde. Wir wollen nicht bloß in Erfahrung bringen, wie es mit uns weitergeht, sondern wir werden durch biologische Imperative zum Weitermachen gedrängt. Arendt setzt ihre Anthropodizee fort:
„Der Grund, warum die Spannung des Lebens, gleichsam der Elan des mit der Geburt gegebenen Anfangs, anhalten kann bis zum Tode, liegt darin, daß die Bedeutung einer jeden Geschichte sich voll erst dann enthüllt, wenn die Geschichte an ihr Ende gekommen ist, daß wir also zeit unseres Lebens in eine Geschichte verstrickt sind, deren Ausgang wir nicht kennen.“ (Ebd.) An dieser Stelle versucht Arendt, sich den Lotteriecharakter unseres Daseins für ihre Anthropodizee dienstbar zu machen. Da wir nicht wissen, wie das Leben ausgeht, wollen wir ihm beiwohnen, wie gebannte Zuschauer einer Vorführung. Es ist schwer nachvollziehbar, warum die mit dem Sinnlosigkeitsleiden der industriellen Arbeitswelt wohlvertraute Arendt hinter jeder Biographie eine bedeutende Geschichte wähnt, der der Betreffende (mit seinem beruflichen und gesellschaftlichen Dasein womöglich Unzufriedene) bis zur brutalen Sterbenskatastrophe beiwohnen will, deren Regie sich menschlicher Kontrolle entzieht.
Sofern Arendt einen Élan natal unterstellt, indem sie vom „Elan des mit der Geburt gegebenen Anfangs“ spricht, könnte es scheinen, als wolle sie im Sinne einer abstrakten Natalität (für Arendt ist die Geburt zunächst eine „nackte Tatsache“) ein „Von der Geburt weg“ gegen ein „Auf den Tod hin“ ins Feld führen und die vorgebliche Todesversessenheit der Philosophie mit einer Erinnerung an Natalitätsvergessenheit neutralisieren. Allerdings weiß Arendt sehr wohl darum, dass nicht unsere biologische Geburt entscheidend ist, sondern unsere soziale, das, was sie die „zweite Geburt“ nennt, durch die wir zuallererst in Geschichte(n) eingebunden werden:
„Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen.“ (A.a.O., S. 165)
Hier räsoniert die Mutter der Natalität etwas vorschnell: Mit der Personwerdung des Kleinkindes haben wir ein handelndes und sprechendes Wesen vor uns. – Aber ist es hierdurch elternentlastend verantwortlich für sein Geborenwordensein? Mitnichten. Arendts Versuch, die Eltern aus der Verantwortung zu entlassen, scheitert bereits daran, dass das Kleinkind zwar sprechen und handeln kann, längst aber nicht für sich selbst sorgen. Weshalb Kant die Eltern erst mit der Volljährigkeit des Kindes aus der Verantwortung entlässt.
Bis hierhin können wir aus Arendts Ausführungen folgenden Gedanken destillieren: Nach seiner zweiten (sozialen) Geburt findet sich der Mensch in einem Netz aus Unabgeschlossenem mitwirkend vor, und er möchte zu jedem Zeitpunkt und in jedem Lebensalter wissen, wie die Geschichte ausgeht; auch, wenn es im Verlauf dessen mit ihm selbst ausgeht. Das manifestierte Dabeiseinwollen, Erfahrenwollen und Mitteilenwollen nach der zweiten Geburt, von Tag zu Tag, wäre Arendts narrative Anthropodizee. Kaum haben wir dieses Destillat festgehalten, vollführt Arendt jedoch einen Salto natale und kehrt auf den Standpunkt der biologischen Geburt zurück:
„Die Anwesenheit von Anderen, denen wir uns zugesellen wollen, mag in jedem Einzelfall als ein Stimulans wirken, aber die Initiative selbst ist davon nicht bedingt; der Antrieb scheint vielmehr in dem Anfang selbst zu liegen, der mit unserer Geburt in die Welt kam, und dem wir dadurch entsprechen, dass wir selbst aus eigener Initiative etwas Neues anfangen.“ (a.a.O., S. 166) Plötzlich ist es doch die biologische Geburt, die uns mit einem Élan natal, einem lebenslang vorhaltenden und anthropodizeetisch wirkenden Impetus ausstatten soll.
Neganthropischer Pronatalismus der Hannah Arendt
Arendt selbst wie auch ihren um eine Philosophie der Natalität bemühten Adepten erschloss sich nicht, dass sich die seltsam bemühte Feier der Natalität gerade auf dem Boden der Analysen Arendts beinahe schon zynisch ausnehmen muss. Jedenfalls dann, wenn man Arendt ernst nimmt. In ihrem bedeutenden Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ von 1951 bemerkt Arendt:
„Es liegt im Sinne unserer gesamten philosophischen Tradition, daß wir uns von dem radikal Bösen keinen Begriff machen können, und dies gilt auch noch von der christlichen Theologie, die selbst Satan noch einen himmlischen Ursprung zugestand (...). So haben wir eigentlich nichts, worauf wir zurückfallen können, um das zu begreifen, womit wir doch in einer ungeheuerlichen, alle Maßstäbe zerbrechenden Wirklichkeit konfrontiert sind. Nur eines scheint sich hier abzuzeichnen; wir können immerhin feststellen, daß dieses radikal Böse im Zusammenhang eines Systems aufgetreten ist, in dem alle Menschen gleichermaßen überflüssig werden. Die totalen Machthaber sind von ihrer eigenen Überflüssigkeit genauso überzeugt wie von der aller anderen, und die totalitären Henker sind so gefährlich, weil es ihnen offenbar einerlei ist, nicht nur, ob sie leben oder sterben, sondern ob sie je geboren wurden oder niemals das Licht der Welt erblickten.“ (Arendt…, S.941f)
Aus diesen Worten Arendts könnte manch einer eine Affinität des Antinatalismus zum Totalitarismus herleiten wollen: Wem es nichts ausgemacht hätte, niemals geboren worden zu sein, hätte einen gemeinsamen Nenner mit den „totalitären Henkern“. Allerdings stellt sich doch gerade auf dem Boden von Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ die Frage, ob man Menschen künftig ein Leben in totalitären Gesellschaften zumuten soll, indem man sie zeugt und totaler Herrschaft zuallererst ausliefert.
Zwar sagt Arendt:„Die Gaskammern des Dritten Reichs und die Konzentrationslager der Sowjetunion haben die Kontinuität abendländischer Geschichte unterbrochen, weil niemand im Ernst die Verantwortung für sie übernehmen kann.“ (Arendt, Elemente, S. 946) Gleichwohl scheint Arendt die Fortsetzbarkeit dieser Geschichte – im Sinne moralischer Verantwortbarkeit der Fortsetzung des Gattungsexperiments – nirgends in Frage gestellt zu haben. Indem sie es als Denkerin trotz ihrer Einsichten unterlässt, ein Ende der entgleisten Geschichte auf dem Wege nataler Enthaltsamkeit zu bedenken, macht sie sich zur objektiven Komplizin künftigen Unheils. Für ein Ende der Fortzeugungen zu plädieren, kommt für Arendt offenbar deswegen nicht in Frage, weil einem solchen Plädoyer die Auffassung inhäriert, der Mensch sei überflüssig und sinnlos. Dies gilt ihr als Element totaler Herrschaft. Stattdessen zitiert sie in pronataler Absicht Augustinus (der selbst allerdings zur rascheren Herbeiführung des Gottesstaates dem Aussterben der Menschheit via nataler Enthaltsamkeit den Vorzug gab und zudem das verdammte Gros aller Menschen in der Hölle verkohlen sah): „damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen.“ Erläuternd fügt Arendt an: „Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen.“ (Arendt, Elemente… S. 979)
Will Arendt sagen, durch die Massenmorde sei zwar Verantwortbarkeit in der Geschichte und damit die geschichtliche Kontinuität unterspült, sie werde jedoch mit jeder Neugeburt wiederhergestellt? Wenn Natalität dies besagen soll, so hätten wir es mit einem zynischen Prinzip reiner Verantwortungslosigkeit zu tun. Ist Arendt sich doch vollkommen im Klaren darüber, dass die Barbarei erneut über uns kommen kann, der sie das Menschenmaterial mit der Feier der Natalität ideell zur Verfügung stellt. In Ansehung von Arendts Analysen ist die Feier der Natalität verantwortungsloser Pronatalismus, weil die Philosophin besser als die meisten um unsere conditio in/humana weiß und ausdrücklich zu bedenken gibt: „Noch weniger ahnen wir, wie viele Menschen unseres Jahrhunderts bereit wären, totale Herrschaftsmethoden zu akzeptieren bei voller Einsicht in ihre Ungeheuerlichkeit – wie viele etwa durchaus willens wären, die sichere Erfüllung aller Aufstiegswünsche mit einer erheblich abgekürzten Lebenszeit zu bezahlen. (...) Wir wissen nicht, wie viele Menschen in diesem Massenzeitalter – in dem sich jeder auch dann noch fürchtet, „überflüssig“ zu sein, wenn das Gespenst der Arbeitslosigkeit nicht umgeht – freudig jenen ‚Bevölkerungspolitikern‘ zustimmen würden, die unter diesem oder jenem ideologischen Vorwand in regelmäßigen Abständen die ‚Überflüssigen‘ ausmerzen. Wir wissen auch nicht, aber wir können es ahnen, wie viele Menschen sich in Erkenntnis ihrer wachsenden Unfähigkeit, die Last des Lebens unter modernen Verhältnissen zu tragen und zu ertragen, willig einem System unterwerfen würden, das ihnen mit der Selbstbestimmung auch die Verantwortung für das eigene Leben abnimmt.“ (Arendt, Elemente…, S. 906)