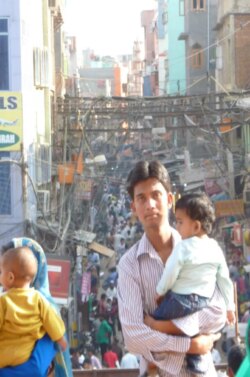Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 159
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDamnatoren
Als Damnatoren bezeichnen wir humanistisch reflektierte und neganthropisch informierte Träger von Kultur und Wissenschaft, die ruhigen Gewissens dazu auffordern, weitere Menschen einem ungewissen Schicksal und dem gewissen Sterbenmüssen auszuliefern. Solange man in Gott den Weltdiktator sah (Gotteskindschaft) und bevor prononciert wurde, dass es Menschen sind, die andere Menschen zum Menschsein verdammen, beschuldigte man anstelle der menschlichen Daseinstäter diesen Gott – wie der nachromantische Dichter Platen es tut, wenn er Menschen als Sträflinge Gottes sieht:
„[…] O suche ruhig zu verschlafen / In jeder Nacht des Tages Pein; / Denn wer vermöchte Gott zu strafen, / Der uns verdammte, Mensch zu sein!“ (Platen, Werke Bd. 1: Lyrik S. 69)
Rousseau (1712–1778)
Ein Damnator ersten Ranges ist Rousseau, der einerseits die allen Kindern bevorstehenden Leiden minutiös auflistet, sich aber zugleich hinter der Natur als der Gebieterin dieser Leiden versteckt:
„Beobachtet die Natur und folgt dem Weg, den sie euch vorzeichnet. Sie übt die Kinder ohne Unterlaß, sie härtet ihre Physis ab durch Prüfungen aller Art und lehrt sie von früh an, was Schmerz und Leid ist. Das Zahnen lässt sie fiebern; Leibschmerzen führen zu Krämpfen; Husten lässt sie fast ersticken, Wärmer quälen sie; die Plethora verdirbt das Blut; es entwickeln sich Gärstoffe und verursachen gefährliche Ausschläge: Fast die gesamten ersten Lebensjahre sind Krankheit und Gefahr. Die Hälfte der Kinder stirbt vor dem achten Lebensjahr. (…) So will es die Natur. Warum sich ihr widersetzen?“ (Rousseau, Emil, S. 20f) Zwar sagt Rousseau, so wolle es die Natur, aber er führt dies an anderer Stelle differenzierter aus (Zeugungspflicht).
Parfit, Derek (1942–2017)
Zu den Damnatoren rechnen wir den bedeutenden Philosophen Derek Parfit, der in seinem umfangreichen Werk „On what matters“ von 2011 Überlegungen zur Rechtfertigung der Fortsetzung der menschlichen Geschichte vor dem Hintergrund der Vergangenheit anstellt. Selbst wenn die Vergangenheit, so Parfit, aufs Ganze gesehen „schlecht“ gewesen sein sollte – worunter er im Wesentlichen eine negative Leid-Glück-Bilanz versteht – dürfe man nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Denn die Zukunft könne sich mit einer positiven Glücksbilanz als sehr viel besser erweisen als die Vergangenheit. Parfit geht so weit, die Menschheit zu personifizieren und ihr unterschiedliche Lebensphasen zuzuschreiben. Die bisherige Geschichte der Menschheit entspreche dann einer unglücklichen Kindheit, die von einem insgesamt glücklichen Leben überkompensiert werden könne:
„Even if the past has been in itself bad, the future may be in itself good, and this goodness might outweigh the badness of the past. Human history would then be, on the whole, worth it. We could also truly claim that the past was worth it, not in itself, but as a necessary part of a greater good. On this view, the past would be like an unhappy childhood in some life that is on the whole worth living.“ (Parfit, On what matters, Bd. 2, S. 612) An dieser Stelle begeht Parfit einen Kategorienfehler, der bei einem Denker seiner Brillanz kaum nachvollziehbar ist: Er vergleicht ein subjektloses Aggregat aus Menschen (die Menschheit) mit der Biographie eines Subjekts, das rückblickend durchaus urteilen kann, das in frühen Phasen seines Daseins durchgemacht Leid sei es in Ansehung später erfahrenen Glücks annehmbar. Wir widersprechen Parfit grundsätzlich, da wir meinen, dass es generell falsch ist, so zu handeln, das ein Mensch zu existieren beginnt, der immer auch leiden muss.
Vollends sichtbar wird Parfits damnatorischer Zug, wo er unter Außerachtlassung der Suizidschranke reflektiert: „Even if our children's lives would be worse than nothing, they might decide to bear such burdens, as many people have earlier done, for the sake of helping to give humanity a good future. We could justifiably have children, letting them decide whether to act in this noble way, rather than making this decision on their behalf, be never having children.“ (Parfit, S. 615) Ähnlich wie bei den Extremen Stalin oder Mao der Fall, ist Parfit offenbar bereit, Handlungen moralisch gutzuheißen, als deren Konsequenz Menschen eine elendige Existenz beschieden ist, solange dies mit einer „guten Zukunft“ anderer Menschen gerechtfertigt werden kann.