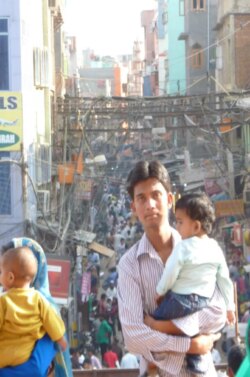Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 171
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Henrich, Dieter(*1927)
ОглавлениеHenrichs Ausführungen zur Daseinsdankbarkeit sind in mancherlei Hinsicht bemerkenswert: „Dank fürs schiere Dasein scheint zwar ohne Sinn, und das schon allein deshalb, weil dieses Dasein auch als Last und Verhängnis erfahren werden kann. Wenn unser Leben aber auch nur einfach dahingeht, wenn also nichts uns denken lässt, es wäre besser gewesen, gar nicht geworden zu sein, kann schon ein Gedanke in uns Platz greifen, der mit den Gedanken, die in die Todesangst eingehen, in einem direkten Zusammenhang steht. [...] So können wir also den Gedanken denken, dass diese Welt ist, ohne dass wir je in sie gekommen sind. Dieser Gedanke unseres Nichtseins schlechthin kommt uns zwar nicht mit jenem Erschrecken, das der Todesangst ihre Schärfe gibt. Aber man kann ihn doch nicht fassen und sich mit ihm vertraut machen, ohne dabei durch ein Erschrecken von kühlerer Art zu gehen: Insofern es uns erschrickt, dass wir non ens schlechthin sein könnten, sind wir geneigt, in eben diesem Moment auch dankbar zu sein für alle die Umstände, die dafür standen, dass wir wirklich geworden sind.“ (Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit, S. 169f)
Zunächst relativiert Henrich den Grund für existentielle Dankbarkeit. Er bekundet sein Wissen darum, dass das Dasein nicht für jeden erträglich ist. Als Mindestvoraussetzung für Daseinsdankbarkeit setzt er ein Leben, das „einfach dahingeht“. Bricht sich das Dasein an Ereignissen, die bei der jeweiligen Person einen Niegewesenseinswunsch aufkommen lassen, so habe man beim Betroffenen weniger mit Daseinsdankbarkeit zu rechnen.
Der Boden für die von Henrich analysierte Daseinsdankbarkeit ist ein Gedankenexperiment: nämlich ein mittels Rücklauf vor unseren Lebensbeginn denkbares alternatives Weltgeschehen, in dessen Verlauf wir nicht zu existieren begonnen hätten. Denken wir an einen Weltlauf, der unser Ausbleiben in der Welt bedeutet hätte, so überfällt uns laut Henrich zwar kein der Todesangst vergleichbarer Schrecken, immerhin aber noch „ein Erschrecken kühlerer Art“. Genau dieses Erschrecken speist laut Henrich die Dankbarkeit dafür, dass es in der Welt nicht so gekommen ist, dass wir nicht zu existieren begannen. Deshalb ist für ihn Daseinsdankbarkeit eine Dankbarkeit „für alle die Umstände, die dafür standen, dass wir wirklich geworden sind.“
Aber welche Umstände sind es, die für unser Zurweltkommen unverzichtbar sind? Oder, symmetrisch gefragt: Was in der Welt hätte anders laufen können – und in welchem Maße anders – sodass wir dennoch entstanden wären? Vermutlich wären die meisten gegenwärtig lebenden Menschen auch dann zur Welt gekommen, wenn Ennius (gest. 169 v. Chr.) kein Kochbuch für Feinschmecker geschrieben hätte und Lucullus die Edelkirsche gegen 79 v. Chr. Nicht aus Kleinasien nach Rom gebracht hätte. Mit einiger Wahrscheinlichkeit aber wäre kein seit der Wende zum 21. Jahrhundert in Westeuropa Lebender gezeugt worden, wenn der Erste Weltkrieg oder Zweite Weltkrieg mit dem Judäozid nicht stattgefunden hätten. Mit dem Ausbleiben dieser geschichtlichen Zäsuren, wären zahllose Weichen anders gestellt worden, sodass kaum einer der gegenwärtig Existierenden zu existieren begonnen hätte. Für jeden Westeuropäer stellen diese Ereignisse Daseinsdeterminanten von elementarer existentieller Bedeutung dar. Sie gehören zu der von Henrich angesprochenen Reihe der „Umstände, die dafür standen, dass wir wirklich geworden sind.“ Unsere Einstellung zu ihnen sollte laut Henrich diejenige der Dankbarkeit sein.
Offenbar blieb Henrich verborgen, dass immer auch Großkatastrophen über unseren Existenzbeginn mitentscheidende Daseinsdeterminanten sind. Hätte er dies in Betracht gezogen, dürfte er seine pauschale Dankbarkeit für die uns ermöglichenden Umstände nicht in der vorliegenden Form ausgesprochen haben. Welcher Asiate – oder Europäer – kann von sich mit Sicherheit behaupten, er hätte zu existieren begonnen, wenn die Mongolenstürme niemals stattgefunden hätten, welcher dunkelhäutige US-Amerikaner lebte heute in den USA, hätte es die Jahrhunderte der Sklaverei seit dem Vordringen moslemischer Araber niemals gegeben?
Bin ich dankbar, dass die gesamte zurückliegende Geschichte so verlief, wie sie tatsächlich verlaufen ist, weil allein auf diese Weise die für meinen Existenzbeginn notwendigen Bedingungen zusammenkamen, so mache ich mich eines ungeheuren Daseinsnarzissmus schuldig: Meine Entstehung ist es mir wert, dass Millionen leiden und sterben mussten.
Führen wir etwas weiter aus, was einleitend zu diesem Stichwort gesagt wurde: Wenn es nun mit Blick auf die negativen Ereignisse, ohne die man vermutlich nicht zu existieren begonnen hätte (Daseinssünde), moralisch fragwürdig ist, für das eigene Dasein dankbar zu sein – kann man nicht zumindest den Eltern für die eigene Existenz danken? Bei näherer Betrachtung erhellt, wie dieser Form der Dankbarkeit der Boden entzogen wird. Bedenkt man, dass eine andere genetische Rekombination stattgefunden hätte und eine andere Person entstanden wäre, wenn die eigenen Eltern zu einem anderen Zeitpunkt gezeugt hätten, wird deutlich, wie sehr ein jeder von uns ein Produkt dessen ist, was man gemeinhin „Zufall“ nennt. Mit anderen Worten, unsere Eltern hatten uns nicht nur phänotypisch nicht vor Augen, als sie ein Kind wollten, wir waren auch mit unserer faktischen genetischen Ausstattung nicht in ihnen prästabiliert oder dauerhaft „präsent“. Über unser Sein oder Nichtsein wurde kurzfristig entschieden. Und zu alledem hätte nach erfolgter Zeugung jener Embryo, der später unser Bewusstsein ausbilden sollte, das wir essentiell sind, jederzeit unbemerkt in einem Spontanabort verloren gehen können. Niemand hätte unserem embryonalen Organismus eine Träne nachgeweint. Mit Thomas Nagel zu sprechen, besteht „absolutely no reason why I should have come into existence in the first place: if I hadn’t, the world would have been none the worse (…) We might go further and say there is no reason why human beings and their form of life should ever have existed: if they hadn’t, it would not have been necessary to invent them…“ (Nagel, The View from Nowhere, S. 213) [Glück, geboren zu sein]
Wie eben dargelegt, wäre es geradezu unmoralisch, dankbar dafür zu sein, dass all die Umstände eintraten, ohne die wir niemals zu existieren begonnen hätten. Statt dankbar dafür zu sein, dass die Geschichte jenen uns ermöglichenden Lauf nahm, sollten wir bedauern, dass alles so gekommen ist, dass auch wir zu existieren begannen. Allein damit ist noch nicht jener existentialontologische Schauder aus der Welt geschafft, der manchen überkommen mag, wenn er in einem selbst- oder fremdinduzierten Rücklauf vor den eigenen Lebensbeginn sein Niegewesensein gedankenexperimentell durchspielt.
Die Abwehr des Niedagewesenseins und der Daseinsnarzissmus dürften sich aus drei Quellen speisen, die wohl nur idealtypisch klar differenzierbar sind:
1.
Zum einen scheint mehr oder minder unbewusst der Gedanke hineinzuspielen, hätte man nicht zu existieren begonnen, so wäre man dazu verurteilt geblieben dem Nichts nahe als halbseiendes Etwas dahinzuwesen, das niemals zum Vollsein erweckt worden wäre. Belege hierfür sind Anspielungen in der Literatur, die ausdrücken, ungezeugt wäre man in präexistentiellem Schlummer verblieben (Proto-Ich, Schlummer des Nichtseins).
2.
Zum anderen ist ein retrojizierter Tod zu veranschlagen: Ist der Tod das Jenseits des Daseins, so wird auch das dem Dasein Vorgängige als todesähnlich vorgestellt und entsprechend bedrohlich empfunden. Demnach wäre ich für immer „tot geblieben“, hätte man mich nicht gezeugt.
3.
Drittens ist als Spielart des retrojizierten Todes zu veranschlagen: Befrage ich A, ob es nicht vielleicht gut gewesen wäre oder warum es schlecht gewesen sein sollte, wenn er (oder seine Kinder) niemals gelebt hätte, so wird er diese Infragestellung seines Lebens mit einiger Wahrscheinlichkeit, reflexhaft, als ein lebensbedrohliches Ansinnen aufnehmen, etwa als nachträgliche Androhung pränataler Vernichtung oder Infragestellung des Weiterlebens vom gegenwärtigen Zeitpunkt an. Der schieren „Zufälligkeit“ der eigenen Existenz (des Umstands, dass nur ganz bestimmte Ereignisverkettungen die Zeugung unseres Organismus und unseren Lebensbeginn notwendig machten) wird offenbar niemand gerne inne. Stattdessen sieht man ein gütiges Schicksal im Spiel, das „von weit her“ zum eigenen Dasein führen musste. Das präkonzeptive „Möglichgewesensein“ wird als eine Art Ich-Präexistenz gedeutet, die ein Niegeborenwordensein zerstört hätte.