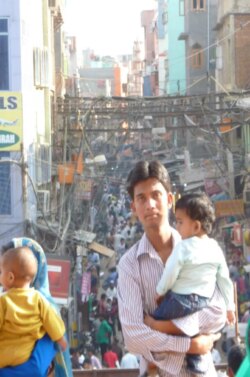Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnnaba (alias Philippe Belotte, *1944)
Im Jahr 2008 blickt der französische Journalist und Autor Annaba auf eine bereits 40-jährige Karriere als antinatalistischer Denker zurück:
„Seit vierzig Jahren schon verlacht ihr / Meine antinatalistischen Verwünschungen.“{10}
Wie vor ihm Kurnig redet Annaba nicht vom Antinatalismus, der sich als Begriff erst später vom bevölkerungstheoretischen Antinatalismus abscheiden sollte, sondern bedient sich des Begriffs Antiprokreationismus.
Annabas früheste uns zugängliche Verwerfungen der Fortpflanzung finden sich in seiner Schrift „Cris, sans titre, sans musique, sans rien…“ aus dem Jahr 1973, woraus wir zitieren:
„Dass die Menschheit doch rebelliere / gegen die sich Fortpflanzenden!... / Stattdessen aber / pflegt die Menschheit / das Verbrechen der Fortzeugung!... / Sie reden von Liebe / Und es ist der Fortpflanzungstrieb.“ (Annaba, CRIS, SANS TITRE, SANS MUSIQUE, SANS RIEN..., S. 16) (Zeugungsverbrechen)
Hier formuliert Annaba den Aspekt der Mitverantwortung aller sich Fortzeugenden für die Perpetuierung von Leid und Elend:
„Nur wer sich fortpflanzt, ist verantwortlich / für sich selbst / für die Gesellschaft, / für die Menschheit und ihre Verbrechen…“ (A.a.O., S. 12) (Zeugungsfolgenabschätzung)
Annabas antinatalistischer Roman: Le berceau (Die Wiege)
Während der Topos vom letzten Menschen Gegenstand vieler Romane ist, ist der Antinatalismus ein Stiefkind der erzählenden Literatur geblieben. Einen Anfang mach hier Annaba. Als Sébastien, der antinatalistische Held seines Romans, erfährt, dass sein Vater ihm unerträgliche Migräne vererbt hat, bricht er das Elterntabu: Er hinterfragt die moralische Integrität seines Vaters, der es im Wissen um die Erblichkeit der Krankheitsdisposition fertigbrachte, sich fortzupflanzen. Während Sébastien sich schon in jungen Jahren dagegen entscheidet. Warum einen Menschen zeugen, wenn man selbst leidet?
Sich in nataler Enthaltsamkeit zu üben, wird zu Sébastiens erklärter Religion. Anhand eines intensiven Gesprächs zwischen Sébastien und Laurence expliziert Annaba diese Privatreligion dialogisch. Sie gebiete nur das Eine: Massaker und andere Missstände nicht fortzusetzen. Zu diesen Missständen gehöre eben auch, verurteilt zu sein, sich das tägliche Brot 40–60 Jahre lang im Schweiße seines Angesichts verdienen zu müssen. Lauras Irrealismusvorwürfe pariert Sébastien mit der Entgegnung: „Ich verbleibe lieber in meinem Wolkenkuckucksheim, da ich nicht darum gebeten zu habe, auf die Erde zu kommen.“ Wenn nun aber jeder so denken und handeln würde wie er, dann gäbe es schon bald keine Menschen mehr, so Laura. Sébastien: „Die Moral von der Geschichte ist, dass es nicht dazu kommt, da die Masse auch künftig ihren Instinkten folgen wird.“ Sébastien jedenfalls trennt sich durch einen radikalen Schnitt von der ihn umgebenden Fortpflanzungsgemeinschaft: Er reist nach England, um sich einer Vasektomie zu unterziehen, die in Frankreich, seinem Heimatland, bis 1999 verboten war.
Bemerkenswert sind einige Kategorisierungen, die Annaba im Roman dialogisch entfaltet. Auf den Vorwurf, er sei misogyn, führt Sébastien aus: „Du hast mich immer noch nicht richtig verstanden. Ich bin nicht misogyn, sondern – schlimmer noch – anthrophob. Ich mag die Menschheit nicht.“ Und auf die Frage, ob er vielleicht sagen wolle, er sei ein Misanthrop, da „anthrophob“ kein gängiges Wort sei: „Nein, der Misanthrop schert sich wenig um die Menschheit. Er mag die ihm begegnenden Menschen nicht. (…) Ich hingegen bin ziemlich gesellig, was mich aber anwidert, ist die Menschheit insgesamt.“ Denn die Menschheit erweise sich als durch sich selbst unbelehrbar. Ihre Religion ist das Wachstum: mehr Kinder und mehr Wirtschaft, die die Lebensgrundlage der vielen Kinder zerstört. Im letzten Drittel des Romans ergänzt Annaba den Antinatalismus und die Anthrophobie im Umfeld einer ländlichen Kommune plausibel durch ein Plädoyer für Entschleunigung und negatives Wirtschaftswachstum.