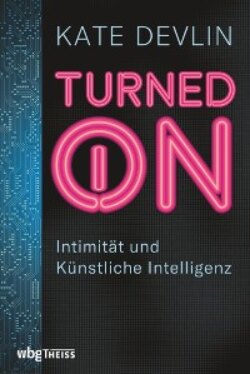Читать книгу Turned on - Kate Devlin - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pflege und Begleitung
ОглавлениеZweitausend Jahre, nachdem Laodameias tragische Geschichte um ihren Protosexroboter geschrieben wurde, taten sich ein französisches Robotikunternehmen und eine japanische Telekommunikationsgesellschaft zusammen, um einen neuen humanoiden Prototyp zu bauen – einen Begleitroboter namens Pepper. Die Zusammenarbeit von Aldebaran Robotics und SoftBank Mobile war ein unternehmerisches Projekt zur Schaffung eines Roboters, der auf Menschen, denen er begegnete, emotional eingehen konnte. Pepper wurde entworfen, um die Stimmen und Gesichtsausdrücke von Menschen, ihre Körperbewegungen und Wörter zu analysieren und um in natürlicher und angemessener Weise darauf zu reagieren. Laut den beteiligten Unternehmen ist Pepper ein „täglicher Begleiter und echter Robotergefährte“. Ein eher zynisch veranlagter Betrachter könnte zu der Feststellung gelangen, dass Peppers Einsatz in Einzelhandelsgeschäften und im Kundenumgang es mit sich bringt, dass riesige Mengen an Daten über das Konsumentenverhalten verfolgt und untersucht werden können. Nichtsdestotrotz wird Pepper vom Handel wie vom Publikum stark nachgefragt.
Der ungefähr 1,2 Meter große und aus glänzend weißem Plastik bestehende Pepper ist der Torso eines Menschen mit einer kompakt gewölbten, säulenförmigen unteren Hälfte, die sich auf einem fahrbaren Untersatz reibungslos durch den Raum bewegt. Die großen Augen sind weit geöffnet und blinzeln einen an – ein Gestaltungsmerkmal, das uns bekanntermaßen fesselt, weil wir psychologisch so gepolt sind, dass wir auf babyhafte Gesichtszüge ansprechen, die wir als „süß“ oder „niedlich“ bezeichnen. Peppers Stimme ist ebenfalls kindlich. Daraus sollen wir auf Gefahrlosigkeit und Vertrauenswürdigkeit schließen. Die Augen und der Mund jedoch beherbergen die Kameras, die es Pepper ermöglichen, die nötigen Informationen zu sammeln, um unsere Emotionen analysieren und auswerten zu können. Lassen wir uns nicht täuschen: Hinter diesem bezaubernden Äußeren steckt eine gefühllose Maschine, die uns dazu bringen soll, unsere Gefühle auszudrücken. Und was soll man sagen, es funktioniert. Die Menschen mögen Pepper. Sie wollen mit ihm in Interaktion treten. Nur wenige Jahre nach seiner Markteinführung können Sie jetzt Ihren eigenen Pepper kaufen, damit er Ihr häuslicher Begleiter wird und sich als freundliche Figur, die immer für Sie da ist, die immer zuhört und immer reagiert, in Ihr Leben einfügt.
Ich bin bei verschiedenen Anlässen diversen Exemplaren von Pepper begegnet, meist in Museen oder auf Messen und kürzlich auch auf der norwegischen Entwicklerkonferenz in Oslo: Pepper war dort auf der Ausstellungsfläche, doch nicht, um Begleitroboter zu bewerben, sondern als Lockmittel, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf ein nicht verwandtes Softwareprodukt zu lenken. Pepper bot an, für mich zu tanzen, und ich war einverstanden. Die Musik setzte ein, sanft und wabernd, und Peppers Arme griffen anmutig aus, beugten und drehten sich elegant, dabei neigte und hob er seinen Kopf, so als folgte er mit ihm der Bewegung der Hände, während der Körper sich auf seinen Rädern drehte. Es sah wirklich wie Tanzen aus. Das aktuelle Werbegesicht für empfindsame Begleitroboter ist eine humanoide Maschine von reizender Anmut.
Falls Sie beschließen, sich selbst einen Pepper zuzulegen, sollten Sie wissen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine interessante Klausel enthalten. Darin heißt es, dass man ihn nicht „für Handlungen zum Zwecke sexuellen oder anstößigen Verhaltens oder zum Zwecke des Umgangs mit unkundigen Personen des anderen Geschlechts“ einsetzen darf. Die Formulierung ist, möglicherweise absichtlich, vage gehalten und nennt die Anwendungselemente der bestimmten Aktivitäten nicht richtig beim Namen. Klar scheint indes, dass den Herstellern durchaus bewusst ist, dass irgendwo irgendwer den Wunsch haben könnte, mit seinem oder ihrem Roboter zu schlafen.
2017 wurde Pepper in einem Pflegeheim in Southend im Vereinigten Königreich eingesetzt, um mit den Bewohnern zu interagieren und ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Die Reaktionen waren gemischt. Kritiker betonten gleich, dass sich menschliche Nähe und der Umgang mit Menschen durch nichts ersetzen lassen. Obwohl sie das Fehlen von Pflegekräften und Betreuern in den Industrieländern einräumten, sahen sie in den Robotern eine Behelfslösung, mit der grundlegende Probleme bei der Versorgung einer alternden Bevölkerung verdeckt würden. Die betagten männlichen und weiblichen Nutzer aber zeigten sich aufgeschlossen und waren positiver gestimmt. In einem Bericht der Daily Mail wird eine Heimbewohnerin wie folgt zitiert: „Das Wichtigste ist die Gesundheit … Meine Familie lebt nicht in der Nähe, darum ist alles, was mir und meinem behinderten Mann behilflich sein kann, eine tolle Sache.“
Pflegeroboter umgeben uns schon eine Weile. In Japan sind Robotervorrichtungen entwickelt worden, die gebrechliche Menschen oder Menschen mit Behinderung dabei unterstützen können, sich zuhause fortzubewegen. Japans Strategieplan zur Verwendung von Robotern, der 2015 veröffentlicht wurde, sieht ihren routinemäßigen Einsatz in der ärztlichen Praxis und im Pflegedienst vor, um, wie es heißt, eine bessere medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Betreuung und Pflege älterer Menschen sei eine immer dringlichere Aufgabe. Japans geburtenstarke Jahrgänge kommen in das Alter, in dem Versorgung und Zuwendung wichtiger werden: Japan hat eine überalterte Bevölkerung, die bis 2025 geschätzte 2,5 Millionen Pflegekräfte erforderlich machen wird. Trotz seines Mangels an Arbeitskräften aber schreckt das Land davor zurück, Migranten als Pflegepersonal einzustellen. 2015 mahnte Premierminister Shinzo Abe die Notwendigkeit an, die Geburtenrate des Landes anzuheben. In der Zwischenzeit wird die Technologie weiter angeschoben, um so die Lücke zu schließen.
Japans Strategie zum Robotereinsatz besteht nicht darin, humanoide Roboter als Ergänzung oder Ersatz für die im Gesundheitswesen tätigen Pflegekräfte einzuführen. Vielmehr soll die Entwicklung einer besseren Roboterausstattung zur Krankenpflege vorangetrieben werden, wie etwa die von Roboterrollstühlen, die unabhängig und gefahrlos arbeiten können. Es geht in erster Linie darum, denjenigen zu helfen, die Unterstützung brauchen, um selbstständig leben zu können. Zugegeben, es gibt schon ein paar etwas sonderbare Roboter. Robear ist ein experimenteller Pflegeroboter: Mit seinen immerhin 140 kg ist dieser stabil gebaute weiße Plastikbär nur ein bisschen kleiner als ein Mensch. Robear ist dazu gedacht, Patienten hochzuheben und zu tragen. Dies könnte eine enorme Erleichterung für die Pflegemitarbeiter bedeuten, die Patienten im Schnitt vierzig Mal am Tag hochheben müssen und für die Rückenschmerzen ein ganz reales Problem darstellen. Robear befindet sich allerdings noch in der Erprobungsphase und ist längst nicht zum Einsatz bereit. Obgleich er von seinem Hersteller RIKEN als „der starke Roboter mit dem sanften Touch“ beschrieben wird, zeigt sich, dass die erforderlichen feinfühligen Bewegungen seine Fähigkeiten vorerst ziemlich übersteigen. Noch kann man ihn nicht auf Menschen loslassen, zumal, wenn sie gebrechlich sind.
Meine Großmutter, mit der ich den Namen teile, war eine starke und unabhängige Frau, die ich über alles geliebt habe. Auf meinem Lieblingsbild von ihr ist sie in ihren Zwanzigern und sitzt mit ihrer Schwester im Hof des Hauses, in dem sie aufgewachsen ist. Dabei hat sie den Kopf zurückgeworfen und lacht. Ich habe lauter glückliche Erinnerungen an meine Kindheit. Großmutter war eine fleißige Frau aus der Arbeiterschicht, die nicht zu emotionalen Ausbrüchen neigte, es jedoch immer schaffte, ihren Enkelkindern ihre Liebe zu zeigen. Sie ging auf die neunzig zu, als sie eine vaskuläre Demenz entwickelte. Dies ist der zweithäufigste Typ von Demenz. Anders als bei Alzheimer, dem häufigsten, wird die vaskuläre Demenz durch Unterbrechungen des Blutflusses ins Gehirn verursacht. Ein Kennzeichen dieser Krankheit ist, dass sie oft von Problemen wie eingeschränkter Beweglichkeit oder Sprechstörungen begleitet wird, und damit von ähnlichen Beeinträchtigungen, wie sie auch nach Schlaganfällen auftreten, die selbst wiederum zu der Krankheit beitragen können.
Ich war zehn, als meine Großeltern sich erstmals ein Häuschen gekauft hatten. Meine Oma war unheimlich stolz darauf. Es war ihr Hoheitsgebiet: Sie brauchte keine Miete mehr dafür zu zahlen, dass sie in fremdem Eigentum wohnte. Jetzt hatte sie die lange gesuchte Sicherheit. Als nach dem Tod meines Großvaters ihre Gesundheit nachließ, fiel es ihr immer schwerer, sich durch ihr Haus zu bewegen, zu kochen und sich selbst zu versorgen. Doch umziehen wollte sie auf keinen Fall. Sie war fest entschlossen, in ihrem eigenen Bereich zu bleiben. Meine Mutter, die etwa 20 km entfernt lebte, tat, was sie konnte (sie musste sich auch um meinen Vater kümmern, der einen zweiten Schlaganfall erlitten hatte). Sie organisierte die Pflegekräfte und stellte jemanden ein, der jeden Tag nach meiner Großmutter sah und darauf achtete, dass sie genügend aß.
An ihrem 90. Geburtstag flog ich in mein Heimatland Nordirland zurück, um ihr einen Besuch abzustatten. Wir unterhielten uns, auch wenn sie Schwierigkeiten hatte, die Wörter herauszubringen. Die vaskuläre Demenz ruft eine Aphasie hervor. Für meine Großmutter aber stand fest: Sie würde ihr Leben, von dem sie spürte, dass es zu Ende ging – trotz der Versuche meiner Mutter, sie von einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung zu überzeugen – bei sich zuhause beschließen. Sie war 91 Jahre alt, als sie starb. Sie war gestürzt und hatte auf dem Boden gelegen, unfähig aufzustehen und Hilfe zu holen. Sie verstarb, während ich auf dem Weg zum Flughafen war und wider alle Hoffnung darauf hoffte, sie noch einmal wiedersehen zu können.
Hätte ich meiner Oma ermöglichen können, sicher und unabhängig bei sich zuhause zu leben, ich hätte die Gelegenheit ergriffen. Sie wusste, was sie wollte, und sie ließ sich davon nicht abbringen (Dickköpfigkeit ist ein Charakterzug, den ich erfreulicherweise geerbt habe). Für sie war es von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre letzten Jahre umgeben von all dem verbringen konnte, was ihr Leben ausgemacht hatte. Wenn Roboter ihr das hätten erleichtern können, hätte ich das ohne zu zögern begrüßt. Ich glaube, sie hätte das auch getan. Roboterpfleger – das hört sich vielleicht wie eine kalte, ziemlich emotions- und vielleicht sogar herzlose Lösung für die Krise des Pflegesektors an. Dafür aber könnten sie den Menschen, die sich verzweifelt nach Unabhängigkeit sehnen, wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen. Meine Oma hätte von Robotern und ihrer Unterstützung profitieren können, sei es beim Stehen oder Laufen, beim Saubermachen oder Kochen. Auch Gesellschaft wäre ihr oft willkommen gewesen. Sie freute sich über Besuche von ihren Urenkeln (in kleinen Dosen), und sie hatte eine Katze, auch wenn sie es schwierig fand, sich um ein Haustier zu kümmern.
Gesellschafts- oder Begleitroboter – anstelle von Robotern rein für die praktischen Zwecke der Pflege – sind eine andere mögliche Lösung für das Problem einer alternden Bevölkerung, die unter Einsamkeit leidet. Sicher kann man gute Argumente finden, warum Maschinen, und seien sie noch so interaktiv, niemals den Kontakt mit Menschen ersetzen könnten, noch sollten. Dazu gäbe es eine Menge zu sagen. Für viele Menschen stellen menschliche Kontakte das Ideal dar. Im Vereinigten Königreich hat die Regierung jüngst tatsächlich eine Ministerin für Einsamkeit ernannt. Die mit dem Ausmaß des Problems befasste Kommission stellte fest, dass „sich mehr als 9 Millionen Menschen ständig oder häufig einsam fühlen“, dass „sich rund 200.000 ältere Menschen seit mehr als einem Monat nicht mehr mit einem Freund/einer Freundin oder einem/einer Verwandten unterhalten haben“ und dass sich „bis zu 85 Prozent der jungen – 18- bis 34-jährigen – Erwachsenen mit einer Behinderung einsam fühlen“.
Man kann nicht bestreiten, dass unsere Gesellschaften sich verändert haben. Die Welt hat sich weitergedreht. Heute leben wir in einer globalisierten Gesellschaft: Familie und Freunde sind ganz verschieden, und viele Menschen studieren oder arbeiten weit entfernt von dem Ort, an dem sie geboren wurden. Die Technologie, die die Beschäftigungslandschaft verändert hat, hat es uns auch ermöglicht, mit unseren Lieben selbst über große Entfernungen hinweg in Kontakt zu bleiben. Doch reicht das? Was ist, wenn es niemanden gibt, an den oder die wir uns wenden können?
Jüngst hat es Versuche zum therapeutischen Einsatz von Roboterbegleitern gegeben. Dieses Entwicklungsgebiet ist aus einem Wissenschaftszweig hervorgegangen, den man als Sozialrobotik bezeichnet. Seit fünfundzwanzig Jahren arbeiten Wissenschaftler an der Entwicklung von Robotern, die auf sozialer Ebene interagieren können. Pepper ist nur einer in einer langen Reihe vieler solcher Roboter. Der erste war Kismet, ein Roboterkopf, den die Ingenieurin Dr. Cynthia Breazeal in den späten 1990er Jahren in der KI-Abteilung des MIT entwickelt hat. Breazeal baute Kismet im Rahmen ihrer Doktorarbeit und gab ihm ein paar menschliche Merkmale mit: falsche Wimpern und rote Lippen auf einem als Gesicht gestalteten mechanischen Rahmen. Kismet war dazu gedacht, zu lernen. Er sollte die Welt über sozial situiertes Lernen erkunden, ganz so, wie ein Kleinkind das tun würde. Je mehr Kontakt und Umgang er hat, desto mehr Informationen eignet er sich an, so dass er auf seine Gegenüber besser eingehen und sich im sozial-emotionalen Umgang mit ihnen verbessern kann.
Durch die Arbeit mit Kismet und seinen Nachfolgern lernte Breazeal nicht nur viel über die Entwicklung von Robotern, sondern auch eine ganze Menge über das Interaktionsverhalten von Menschen. Wie sie feststellte, bauen Menschen, die sich auf Roboter einlassen, eine ganz ähnliche emotionale Beziehung zu ihnen auf wie zu Haustieren. Darum ist es kein Wunder, dass Roboterhaustiere mittlerweile dafür genutzt werden, Menschen Gesellschaft zu verschaffen. Das wohl berühmteste von ihnen ist Paro.
Eine Person, die eine Begegnung mit Paro unberührt ließe, müsste schon sehr hartherzig sein. Paro ist ein flauschiges Sattelrobbenbaby mit großen braunen Augen, das kleine Begeisterungsquiekser von sich gibt. Sein Niedlichkeitsgrad geht gegen unendlich: Paro sieht einfach wie ein großes Spielzeug zum Knuddeln aus. Und genau das ist er auch. Obendrein aber ist er ein therapeutischer Roboter. Unter seinem Fell befinden sich Prozessoren, Mikrofone und Sensoren. Streicheln Sie ihn, und er wird seine Augen schließen, mit seinem Körper wackeln und Sie anfiepsen. Er kann Namen lernen und sich Gesichter merken. Er besitzt sogar die offizielle medizinische Zulassung.
Studien mit Pflegeheimbewohnern haben ergeben, dass der Umgang mit Paro die Gruppenbeteiligung fördert, eine beruhigende Wirkung hat und die Angst der Nutzer verringert. Einer Studie zufolge beschäftigten sich die Bewohner tatsächlich mehr mit Paro – und miteinander, wenn Paro anwesend war – als mit dem Hund des Pflegeheims. Außerdem braucht Paro auch nicht gefüttert oder ausgeführt zu werden, und niemand muss hinterher sauber machen.
Trotz der positiven Resultate gab es Kritik an Paros Einsatz. Dieser, so die Bedenken, sei mit einer Täuschung verbunden, zumal bei demenzkranken Nutzern, und beeinträchtige deren Würde. Werden diese Menschen durch Paro getäuscht? Werden bedürftige Nutzer zum Narren gehalten? Oder wiegt es schwerer, dass sie sich beschäftigen und wir Vorteile darin sehen? Dies sind wichtige Fragen, und sie sind Teil ethischer Debatten, die auch heute geführt werden.
Sherry Turkle hat sich ihre ganze Laufbahn lang intensiv mit dem Wechselspiel zwischen Mensch und Technologie befasst. In ihrem 1984 veröffentlichten Buch The Second Self, das gut rezensiert und zu einem vielgelesenen Klassiker in dem Bereich wurde, untersucht sie, wie Menschen aus allen Gesellschaftsschichten die von ihnen genutzte Technologie erleben und mit ihr umgehen. Ihre Ausführungen sind faszinierend. Anhand von Fallstudien berichtet sie von der Bereitschaft der Menschen, soziale und emotionale Beziehungen zu Robotern einzugehen und sie so zu behandeln, als seien sie ein Haustier oder ein anderer Mensch, selbst wenn sie sich bewusst sind, dass es sich bei Robotern um nichts weiter als Maschinen handelt.
Dies ist ein immer wiederkehrendes Phänomen. Wir verhalten uns zu dem, was uns umgibt, nach dem Vorbild unserer sozialen Beziehungen untereinander. Für uns ergibt es Sinn, mit reaktiven, ansprechbaren Dingen so umzugehen, als seien sie imstande, uns zu verstehen, auch wenn wir wissen, dass sie das nicht tun. Auf diese Weise gehen wir miteinander um, und so gehen wir auch mit Tieren um. Wenn ein Computer mit uns spricht oder uns ein Zeichen sendet, dass er ansprechbar ist, dann gehen wir in der uns standardmäßig eigenen Weise darauf ein, und diese ist eine grundlegend menschliche und mit menschlichen Erwartungen verbunden.
3,3 Millionen Jahre technischer Entwicklung, von geschärften Steinen zum Silicon Valley, haben uns eine Welt beschert, in der wir Arbeit auf Maschinen abladen können. In dieser Zeit haben wir gelernt, wie man Feuer beherrscht, wie man Räder an Objekten anbringt, Nahrung lagert und Stoffe webt, wie man schreibt und Bilder aufnimmt, wie man Rundfunksendungen ausstrahlt und weltumspannend kommuniziert, wie man Leben rettet und Leben nimmt. Wir haben jedes dieser Dinge bis zu dem Punkt weiterentwickelt, wo wir auf die Geräte zu ihrer Ausführung nicht mehr angewiesen waren und uns von ihnen trennen konnten. Der Mensch hat die Technik schon immer zur Steigerung der physischen Produktivität genutzt. Roboter sind nur die nächste Stufe davon. Und jetzt versuchen wir, wie man sehen wird, auch die geistigen Anteile der Arbeit abzuladen.