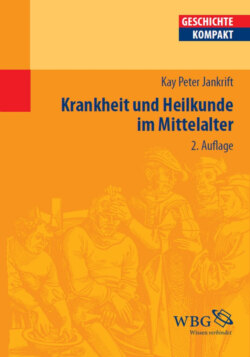Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Bildquellen und Realien
ОглавлениеRealien
Eine wichtige Ergänzung erfahren die schriftlichen Befunde durch verschiedene Sach- sowie Bildquellen. Der Großteil der erhaltenen Realien entstammt entweder dem Umfeld mittelalterlicher Fürsorgeeinrichtungen, medizinischer Fakultäten der Universitäten oder dem Besitz von Heilkundigen. Bauliche Überreste mittelalterlicher Hospitäler und Leprosenhäuser finden sich noch heute in zahlreichen Städten Europas, so etwa das St. Jans-Spital in Brügge, das spätmittelalterliche Hospital im burgundischen Beaune und das Heilig-Geist-Spital in Lübeck oder die Leprosenhäuser in Eichstätt, Münster und Beauvais. Daneben haben sich oft Kapellen von Einrichtungen erhalten, die durch Patrozinien und innere Gestaltung noch immer auf ihre einstige Funktion verweisen. So verraten in romanischen Ländern insbesondere dem Heiligen Lazarus geweihte Kapellen mit entsprechender ikonographischer Ausschmückung häufig deren ursprüngliche Funktion als Gotteshaus der Leprakranken. Umbauten sowie Veränderungen während der vergangenen Jahrhunderte, die mit einem Funktionswandel der Leprosenhäuser einhergingen, und die sich – wie in Münster-Kinderhaus – am Gebäude sichtbar erkennen lassen, vervollständigen das in den Schriftzeugnissen gezeichnete Bild. Auch spezielle topographische Gegebenheiten – wie etwa die Lage von Leprosenhäusern außerhalb der Stadt und in Anlehnung an medizinische Theorien bevorzugt auf der windabgewandten Seite – sind noch ansatzweise erkennbar, so wiederum am Beispiel des nördlich von Münster gelegenen Leprosoriums Kinderhaus. Gegenstände des täglichen Bedarfs, die eindeutig dem Gebrauch der Kranken zuzuordnen sind, beispielsweise spätmittelalterliche Klappern oder Almosenbüchsen, sind jedoch nur selten überliefert. Daneben finden sich ärztliche Instrumente, so wie bei archäologischen Grabungen im westfälischen Höxter, die eine Vorstellung von der praktischen Arbeit der Heilkundigen vermitteln.
Siegel
Darüber hinaus zeugen Siegel von Hospitälern, Leprosenhäusern oder medizinischen Fakultäten von Bedeutung und Ansehen einer Einrichtung wie auch von deren Selbstverständnis. Das vom Kölner Melatenhaus, dem größten der Leprosenhäuser in der rheinischen Stadt, im 15. und 16. Jahrhundert verwendete Siegel, das vergleichsweise häufig an zeitgenössischen Dokumenten überliefert ist, zeigt auf seiner Vorderseite den armen Lazarus an der Schwelle des reichen Mannes. Während der Bettler ärmlich gekleidet mit Bettelstab und Sack, aber ohne die für Leprakranke charakteristische Klapper, am Hauseingang um ein Almosen ersucht, sitzt der Reiche in prächtiger Gewandung inmitten seines Hauses. Die Umschrift lautet: SIGILLVM LEPROSORVM EXTRA MVROS CIVITATIS COLONIE(N)S(IS). Auf der Rückseite befindet sich umschrieben mit den Worten SENATVS COLONIENSIS BENEFICIO eine dreiblättrige Klapper: Im Gegensatz zum renommierten Kölner Leprosorium besaßen die meisten Leprosenhäuser jedoch kein eigenes Siegel. Dokumente wurden stattdessen mit dem Siegel der Provisoren, der gewissermaßen Aufsicht führenden Ratsherren, oder dem Stadtsiegel versehen. Das münsterische Aussätzigenspital Kinderhaus verfügte zwar ebenfalls nicht über ein eigenes Siegel. Verschiedentlich griffen die Provisoren während des 17. Jahrhunderts aber neben ihrem eigenen und dem städtischen auf ein Siegel zurück, das der stilistischen Form nach möglicherweise bereits für den ersten Pastor der Kinderhauser Kirche, Wessel de Perlinctorpe, um 1333 angefertigt worden sein könnte. Es zeigt die heilige Gertrud von Nivelles in Gestalt einer Äbtissin mit Äbtissinnenstab, die in ihrer linken Hand ein Modell der Kinderhauser Kirche hält. Nur zwei Exemplare des Siegelabdrucks sind bekannt. In der schlecht erhaltenen Umschrift steht zu lesen: SIGILLVUM RECTORIS ECCLESIE SANCTE GERTRUDIS.
Bildquellen
Neben solchen Realien geben auch zahlreiche Bildquellen einen Einblick in zeitgenössische Krankheitswahrnehmung. Die Darstellung von Heiligen bei der Krankenheilung zeigt auch die Patienten und deren Leid. Illustrationen der medizinischen Schriften stellten die Anwendung bestimmter Behandlungsmethoden visuell ebenso dar wie die Gestalt ärztlicher Instrumente. Der Bildbefund dient nicht zuletzt der Archäologie zur Identifizierung von Fundmaterial, das potenziell dem Besitz eines Heilkundigen zuzuordnen ist.