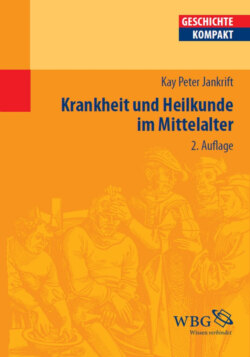Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die Nadel im Heuhaufen. Krankheit und Tod als Gegenstand mittelalterlicher Schriftquellen
ОглавлениеSchriftquellen
Wer sich mit Fragen nach Krankheit und Tod in der mittelalterlichen Gesellschaft beschäftigt, stellt schnell fest, dass die Recherche in den Schriftquellen der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Lässt sich den theoretischen Grundlagen mittelalterlicher Medizin über die zum Teil in Editionen vorliegenden Schriften der Ärzte vergleichsweise mühelos nachspüren, erweist sich ein Blick auf die praktische Tätigkeit der Heilkundigen als ungleich schwieriger. In nahezu allen Schriftzeugnissen finden sich verstreute Hinweise, etwa auf den Tod eines Bürgermeisters, die Anstellung eines Arztes oder die Erkrankung eines Bischofs, doch diese zusammenzutragen erweist sich je nach Fragestellung als mehr oder weniger beschwerlich. So nehmen erzählende Quellen, vor allem die verschiedenen Formen der Chroniken wie auch Viten, zwar häufig Bezug auf den Themenkomplex und schildern etwa den Ausbruch von Seuchen oder den Tod weltlicher wie geistlicher Herrscher. Weit seltener sind jedoch Berichte über die Erkrankung eines Herrschers und deren Verlauf. Hier stechen vor allem die umfangreichen Ausführungen des Erzbischofs Wilhelm von Tyrus heraus, der in seinem während des 12. Jahrhunderts entstandenen Geschichtswerk detailgetreu die Entwicklung der Lepraerkrankung seines früheren Zöglings, König Balduins IV. von Jerusalem, beschreibt. Zusammengenommen machen derartige Berichte im Rahmen einer mitunter Hunderte von Seiten langen Chronik allerdings kaum mehr als wenige Zeilen aus.
Q
Die Gichterkrankung des Bischofs Maurilius von Cahors
Gregorii Episcopi Turonensis Historiarum (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Tomus I), hrsg. v B. Krusch u. W. Levison, Hannover 1951, S. 281.
Dt. Übersetzung: Zehn Bücher Fränkischer Geschichte vom Bischof Gregorius von Tours, übersetzt v. W. Giesebrecht, 2 Bde. (= Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. VI. Jahrhundert, Bde. 4 u. 5), Berlin 1851, S. 249.
Maurilius, der Bischof der Stadt Cahors, erkrankte schwer an der Fußgicht, aber außer den Schmerzen, welche ihm die Gicht schon verursachte, fügte er sich selbst noch größere Schmerzen zu. Denn er brannte oft mit einem glühenden Eisen seine Schienbeine und Füße, damit er so seine Pein noch vergrößere. Da aber viele nach seinem Bistum strebten, erwählte er sich selbst zum Nachfolger den Ursicinus, der einst Kanzler der Königin Vultrogotha gewesen war und bat, dass er noch bei seinen Lebzeiten möge geweiht werden; dann schied er aus der Zeitlichkeit. Er war ein großer Wohltäter der Armen, sehr bewandert in den heiligen Schriften, sodass er die verschiedenen Geschlechtsregister, welche in den Büchern des alten Testaments verzeichnet sind, und die viele nur mit Mühe sich einprägen, häufig aus dem Gedächtnis hersagte. Auch war er gerecht im Gerichte und wahrte die Armen seiner Kirche vor den Gewalttaten schlechter Richter nach den Worten des Hiob: „Ich errettete den Armen, der da schrie und den Waisen, der keinen Helfer hatte. Der Segen des, der verderben sollte, kam über mich und ich erfreute das Herz der Witwen. Ich war des Blinden Auge und des Lahmen Füße. Ich war ein Vater der Armen.“
Weitaus häufiger stößt man auf Aussagen zu Krankheit, Krankenbehandlung und den Umgang mit dem Tod in den so genannten hagiographischen Quellen, die sich mit dem Leben (vita) und den Wundern (miracula) von Heiligen sowie der Überführung der Gebeine (translationes) befassen. Die in den hagiographischen Schriften enthaltenen Informationen erlauben beispielsweise fragmentarische Einblicke in die Art der Erkrankungen und Wege der Behandlung. Weitere Zeugnisse religiösen Schrifttums zeigen ebenfalls Formen der Bewältigung von Krankheit und vom Umgang mit dem Tod auf. Exemplarisch sind in diesem Zusammenhang die zahlreichen Pestgebete und Nekrologe, Listen mit den Namen Verstorbener zum Einschluss in das Gebetsgedenken einer klösterlichen Gemeinschaft.
Doch auch weltliche und geistliche Rechtsquellen nehmen Stellung zum Umgang mit Krankheit und Tod. Konzilsbeschlüsse wie weltliches Recht regelten beispielsweise die Stellung der Ärzte, ihre Ausbildung oder gar Einschränkungen einer bestimmten Tätigkeit wie der Chirurgie. Sie verfügten auch Verhaltensmaßnahmen für den Umgang mit Leprakranken oder erließen Verfügungen über die Führung von Hospitälern. Weitere normative Quellen organisierten mit ihrer Aufzeichnung von Rechten und Pflichten das Leben in den Fürsorgeeinrichtungen. Selbst die Urkunden, in denen man zunächst wenig Berührungsfläche zum Gegenstand der Fragestellung vermuten könnte, sind von Belang. Sie zeigen als Rechtsakte etwa die Umstände einer Hospitalstiftung oder die Ausstattung eines Leprosenhauses mit weiterem Besitz.
Archivalien
Die Arbeit mit ungedruckten Quellen erweist sich im ersten Anlauf als ernüchternd. Verlockend erscheinende Einträge wie „Medizinalwesen“, „Seuchen“ oder gar „Ärzte“ in den Findbüchern, die den Weg zur Quelle weisen sollen, entpuppen sich in aller Regel als Verweise auf neuzeitliches Material zumeist rechtlicher Natur. Die Suche nach mittelalterlichen Heilkundigen, kranken Obrigkeitsvertretern oder ärztlichen „Kunstfehlern“ wie auch nach den Auswirkungen von Seuchen oder dem obrigkeitlichen Umgang mit Leprakranken, erfordert in der Regel eine Durchsicht mehr oder weniger großer Quellenmengen, in denen sich jedoch zahlreiche Hinweise verbergen. Dabei kommt nahezu das gesamte Spektrum städtischen oder auch höfischen Schriftgutes als potenziell interessant in Frage. Ratslisten etwa verraten den Zeitpunkt des Ablebens von Magistratsvertretern und liefern so unter Umständen Hinweise auf den Ausbruch einer Seuche. Stadtrechnungen geben Aufschluss über eine Anstellung von Ärzten und Wundärzten, deren Anwerbung oder auch deren Tätigkeiten. Die Befunde der Finanzdokumente werden durch Ausführungen in den Ratsprotokollen ergänzt. Gerichtsakten verweisen auf das Wirken von Heilkundigen, die sich entweder Verletzter annahmen und nun als Zeugen auftraten oder aber selbst wegen des Misserfolgs einer Behandlung auf der Anklagebank saßen. Testamente nennen bisweilen das Leiden des Testators und geben – besonders in Seuchenzeiten – Einsicht in die Umstände ihrer Aufstellung. Die größten zusammenhängenden Materialfunde verspricht der Zugriff auf die zumeist in geschlossenen Beständen abgelegten Urkunden und Akten von Hospitälern und Leprosenhäusern oder – sofern eine solche existierte – der Chirurgen- bzw. Barbierzunft. Mitunter gelangt dabei selbst ein Buch mit Aufzeichnungen zu ärztlichen Konsultationen ans Licht. Die Arbeit ist also langwierig und mühsam. Doch zusammengefügt ergeben die Befunde aus unterschiedlichen Quellen umfangreiche Einblicke in die medizinische Kultur des Mittelalters und die Auseinandersetzung mit Krankheit oder Tod.
Interpretation von Seuchendarstellungen
Der kritische Umgang mit dem Quellenmaterial, der Grundlage historischer Arbeit, ist auch bei der Erforschung von Krankheit und Tod im Mittelalter unerlässlich. Die Intentionen des Berichterstatters, die bei der Erklärung seiner Schilderung politischer Ereignisse stets zu Recht betont werden, werden im Hinblick auf seine Darstellung von Krankheit allzu oft vergessen. Gewisse Krankheiten jedoch, allen voran die Lepra, bedeuteten zugleich Stigma. Die „Lepra der Seele“ kennzeichnete im späteren Mittelalter im übertragenen Sinne den vermeintlichen Sünder oder Häretiker. Die Schilderung von Krankheiten kann dementsprechend, je nach Zusammenhang, absichtsvoll eingesetzt sein. Vorsicht ist auch bei der Interpretation von Seuchenschilderungen mittelalterlicher Chroniken angebracht. Oftmals ist der vorgebliche Seuchenausbruch nicht mehr als ein Topos. Darüber hinaus werden als ein Resultat der kompilatorischen Arbeit mittelalterlicher Geschichtsschreiber Seuchen durch die Übernahme aus anderen Vorlagen bisweilen gewissermaßen „domestiziert“. So lässt sich etwa die Schilderung eines Seuchengeschehens des 11. Jahrhunderts, das der Chronist in seiner Heimatstadt Minden an der Weser stattfinden lässt, als nahezu wörtliche Entlehnung aus einer älteren Chronik belegen, die das Ereignis jedoch für einen völlig anderen Ort beschreibt.