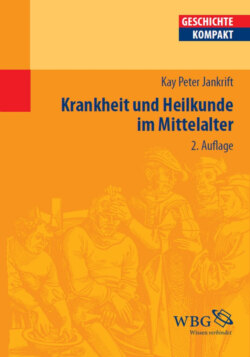Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
d) Volksmedizin und Magie
ОглавлениеMerseburger Zaubersprüche und Leechbooks
Die bewusst christliche Ausrichtung des Lorscher Arzneibuchs unter konsequenter Zurückweisung von Magie und Aberglauben darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Klostermedizin als Bewahrerin der griechisch-römischen Heilkunde trotz ihrer unbestreitbar weitreichenden Wirkung keinesfalls in alle Bereiche des medizinischen Alltags vordrang. Neben dieser existierte auch weiterhin eine in ihrer Tragweite aufgrund des Fehlens schriftlicher Zeugnisse kaum abzuschätzende Volksmedizin, für die – von jeglichem theoretischen Überbau unberührt – neben Erfahrung im Umgang mit Krankheiten auch magische Elemente eine Rolle spielten. Die Stabreime der so genannten Merseburger Zaubersprüche, die im Einband eines Gebetbuches in der Bibliothek des Merseburger Domkapitels entdeckt wurden, werfen ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Bedeutung der Magie innerhalb des volksmedizinischen Alltags. Nicht Christus, Wodan tritt hier in einem der Reime, dessen Ursprung bis in die Abfassungszeit des Lorscher Arzneibuchs zurückreicht, als Heiler in Erscheinung. Er ist derjenige, dem unter ständiger Beschwörung die Heilung einer Verrenkung – in diesem Fall der eines Pferdes – überantwortet wird. Ein weiteres eindrucksvolles Zeugnis für die Anwendung magischer Praktiken im Rahmen der medizinischen Alltagspraxis liefert das im 10. Jahrhundert auf den Britischen Inseln entstandene Leechbook des Bald. Ein gewisser Bald, von dem nicht mehr bekannt geworden ist als sein Name, verfasste das Kompendium in der angelsächsischen Vulgärsprache und gemäß den Ausführungen der Handschrift zum Eigengebrauch. Er gehörte zu jener Gruppe von weltlichen Heilkundigen, die nicht an den Klosterschulen ausgebildet wurden und über die bis heute nur wenig bekannt ist. Die Leeches erwarben ihr Wissen in einer Art Ausbildung, die am ehesten mit einer handwerklichen Lehre verglichen werden könnte, und zogen wahrscheinlich von einem Ort zum nächsten. Einschübe in lateinischer Sprache sowie Plinius dem Älteren oder Alexander von Tralleis (um 525–ca. 605) zugeschriebene Passagen weisen ebenso wie Empfehlungen zum Lesen einer Messe über bestimmte Heilkräuter darauf hin, dass der heilkundige Empiriker einen gewissen Bildungsstand besaß und dass ihm die klösterliche Medizin nicht fremd war. Nicht wenige Rezepte hingegen enthalten eindeutig magische Beschwörungsformeln, die einen Patienten von seinem Leiden befreien sollen.
Ein weiteres Zeugnis magisch-medizinischer Natur ist das im gleichen Kulturraum im 11. Jahrhundert zusammengefügte Sammelwerk Lacnunga. In diesem Werk verschmolzen christliche Vorstellungen mit heidnischen Traditionen zur Behandlung von Krankheiten aller Art. Lateinische Gebete oder ein Stab mit den Namen der Evangelisten gehörten beispielsweise zum Fertigungsprozess einer Heilsalbe, deren Grundstoff Butter einer weißen und einer roten Kuh sein musste. Als Verursacher der Beschwerden wurden häufig Kobolde oder Elfen angesehen. Doch selbst den frühmittelalterlichen Mönchen in den Klöstern waren die Vorstellungswelten des Leechbook oder der Lacnunga keineswegs fremd. Auch sie scheuten sich nicht, in althergebrachter Weise Sprüche zur Vertreibung krankheitsverursachender Elfen zu benutzen.