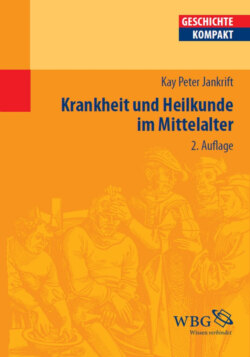Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
e) König Lothar II. und Theutberga. Ein Beispiel zur Bedeutung der Magie in mittelalterlichen Krankheitskonzeptionen
ОглавлениеMagie vermochte nach zeitgenössischer Vorstellung nicht nur zu heilen, sie konnte auch Krankheit verursachen. Bis weit über das Mittelalter hinaus spielte die Magie eine nicht zu verkennende Rolle für die Konzeption von Krankheit. Ein Beispiel für die Wirkung dieses Motivs bieten die Auseinandersetzungen um die Ehe König Lothars II. (gest. 869) mit seiner Gattin Theutberga. Im Jahre 855 schloss König Lothar II. die Ehe mit Theutberga aus dem Adelsgeschlecht der Bosoniden. Aus diesem höchst einflussreichen Geschlecht stammten im 9. Jahrhundert mehrere Könige von Burgund und der Provence. Trotz der unverkennbar von pragmatischen Erwägungen geleiteten Eheschließung mochte der König nicht von seiner früheren Verbindung zu einer Frau namens Waldrade lassen. Schon bald strebte er danach, den mit Theutberga geschlossenen Ehebund zu lösen und stattdessen seine inoffizielle so genannte Friedelehe mit Waldrade zu einer Vollehe zu erheben. Diese königlichen Bestrebungen führten zu einer jahrelangen Auseinandersetzung um die königliche Scheidung auf höchster politischer Ebene. Nach einem vorangegangenen Gottesurteil zugunsten Theutbergas widmeten sich gleich mehrere Synoden in Aachen der Angelegenheit. Im Zentrum der Diskussionen stand die schwer wiegende Beschuldigung, Theutberga unterhielte ein inzestuöses Verhältnis zu ihrem Bruder. Ein mit diesem gezeugtes Kind habe sie durch einen Trank abgetrieben. Um die Bedeutung von Magie für mittelalterliche Krankheitskonzeptionen zu beleuchten, ist ein Aspekt von Interesse, der im Rahmen der Auseinandersetzungen über die Auflösung von Lothars Ehe zwar eine untergeordnete, aber keineswegs bedeutungslose Rolle gespielt zu haben scheint: Aus der Ehe mit Theutberga waren keine Kinder hervorgegangen. Mit Waldrade indes hatte der Herrscher mehrere Kinder – darunter vielleicht schon 857 einen Sohn namens Hugo – gezeugt.
Impotenz durch Magie
Die Möglichkeit einer durch magische Kräfte hervorgerufenen Impotenz des Königs, ein triftiger Scheidungsgrund, wurde Gegenstand der theologischen Erörterung. Erzbischof Hinkmar von Reims, der sich entschieden gegen eine Auflösung der Ehe mit Theutberga wandte, befasste sich in einem langen Gutachten über den Fall auch mit der Frage, ob es überhaupt möglich sei, dass ein Mann aufgrund bösen Zaubers zwar zu seiner rechtmäßig angetrauten Gattin nicht in ehelichen Verkehr treten könne, anderen Frauen hingegen beizuwohnen vermöchte. Für den Erzbischof von Reims und seine Zeitgenossen stand trotz der daneben bestehenden christlich motivierten und von den griechisch-römischen Autoren entwickelten Krankheitskonzeptionen außer Frage, dass magische Einflüsse durchaus Impotenz bewirken könnten. Da die Ehe in diesem Fall aus kirchenrechtlicher Sicht nicht vollzogen werden konnte, äußerte sich Hinkmar dahingehend, dass eine Scheidung erfolgen dürfe, sofern Versuche zur Heilung des durch bösen Zauber verursachten Leidens scheiterten. Selbst in späteren Jahrhunderten beschäftigten sich Kirchenrechtler noch verschiedentlich mit der Frage der Eheauflösung wegen angehexter Impotenz. Auch sie schlossen sich – wie beispielsweise Ivo von Chartres am Beginn des 12. Jahrhunderts – dem Urteil des Hinkmar von Reims an. Unklar bleibt, welchen Anteil im Rahmen der geschilderten Scheidungsaffäre der Glaube an die Wirksamkeit solchen Schadenzaubers tatsächlich zukam. Mag die angenommene Impotenz des Herrschers auch auf einer Spekulation fußen, die sich aus den am Hof kursierenden Gerüchten nährte, so hielt es ein angesehner Theologe wie Hinkmar doch immerhin für notwendig, sich ernsthaft mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass zeitgenössische Krankheitskonzeptionen sich nicht auf christliche oder rationale Erklärungsmodelle beschränkten, sondern auch die Magie und insbesondere den Krankheitszauber wie selbstverständlich umfassten.