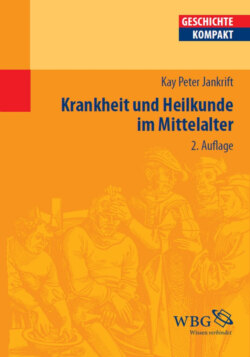Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Das „Haus der Heilkunde“
a) Corpus Hippocraticum und die Lehren Galens
Hippokrates
Die Lehren der griechisch-römischen Medizin bildeten die theoretische Grundlage der mittelalterlichen Heilkunde und Gesundheitspflege. Am Anfang dieser langen Tradition stand der sagenumwobene Hippokrates von Kos. Nur wenig ist über das Leben jenes Mannes bekannt, der zum Inbegriff des idealen Arztes wurde. Soranos von Ephesos, sein in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts tätiger Biograf, bestimmte das Geburtsjahr des Hippokrates auf 460 / 459 vor Christus. Der weiteren Überlieferung zufolge soll er im 4. Jahrhundert vor Christus als hochgerühmter Heilkundiger gewirkt haben. In Ableitung naturphilosophischer Konzeptionen von den vier Elementen (Erde, Luft, Wasser, Feuer) schuf Hippokrates eine im Rahmen des zeitgenössischen Verständnisses rationale Theorie der Medizin. Ihren Kern bildete die bis über das Mittelalter hinaus akzeptierte so genannte Säftelehre. Gemäß dieser werden die Elemente zu den vier Körpersäften Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle gekocht. Während die ersten drei unschwer zu identifizieren sind, ist heute unklar, was sich hinter Hippokrates’ Bezeichnung der „schwarzen“ Galle verbirgt. Sie lässt sich nach modernen medizinischen Definitionen mit keiner der im menschlichen Körper tatsächlich vorkommenden Substanzen in Verbindung bringen. Die vier Körpersäfte der hippokratischen Lehre sind zugleich mit den natürlichen Eigenschaften warm, kalt, trocken und feucht verbunden. Das Blut beispielsweise ist nach diesem Schema warm und feucht, die schwarze Galle kalt und trocken. Der Umfang von Hippokrates’ literarischem Werk lässt sich nicht genau bestimmen. Über 60 medizinische Schriften versammelt das so genannte hippokratische Corpus unter seinem Namen, doch ist nach wie vor ungeklärt, wie viele von diesen tatsächlich von dem viel gerühmten Arzt selbst verfasst wurden. Für keine einzige der Abhandlungen ließ sich bislang die Frage nach der Autorschaft des Hippokrates zweifelsfrei klären, doch wurde der griechische Arzt mit dieser Zuschreibung gewissermaßen zum Begründer der Medizin und ärztlichen Praxis.
Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde die hippokratische Säftelehre von dem im kleinasiatischen Pergamon geborenen Arzt Galen weiterentwickelt und verfeinert.
E
Galen (129–zw. 199 und 216) wurde im kleinasiatischen Pergamon geboren. Nach einer umfassenden philosophischen Bildung wandte er sich im Alter von sechzehn Jahren dem Studium der Medizin zu, das er in Smyrna, Korinth und Alexandria fortführte. Um 158 kehrte er nach Pergamon zurück und praktizierte dort als Gladiatorenarzt. Im Jahr 162 siedelte er nach Rom über, wo er Patienten aus den höchsten Kreisen behandelte und öffentlich anatomische Sektionen durchführte. Während der so genannten Pest des Antonius 166 kehrte er vorübergehend nach Pergamon zurück und reiste durch Syrien und Phönizien. Auf kaiserliches Geheiß nach Rom zurückgekehrt, wirkte er als Leibarzt für Marc Aurel (161 – 180) und dessen Sohn Commodus (180 – 193). Vermutlich blieb Galen bis zu seinem nicht präzise datierbaren Tod zwischen 199 und 216 in Rom. Der genaue Umfang seines großen schriftstellerischen Werkes ist unbekannt, doch sind – einschließlich der identifizierten pseudogalenischen – mehr als 330 Schriften unter seinem Namen überliefert.
Er ergänzte die Viererschemata von Elementen, Säften und Qualitäten um die der vier Kardinalorgane, Lebensalter sowie Tages- und Jahreszeiten, die er untereinander in Beziehung setzte. Zugleich resultierten aus diesem hippokratisch-galenischen Denkmodell die vier Temperamente, die durch die jeweilige Zusammensetzung der Körpersäfte bestimmt werden. Beim so genannten Sanguiniker überwiegt das Blut (lat. sanguis), beim Phlegmatiker der Schleim (griech. phlégma), beim Choleriker die Galle (griech. chlolḕ). Auf dieser theoretischen Grundlage erwuchs ein umfassendes Erklärungsmodell von Gesundheit und Krankheit. Krankheit wurde demzufolge durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte verursacht. Gesundheit bedeutete einen Gleichgewichtszustand. Die Deutung einer Erkrankung und ihre Behandlung leiteten sich aus diesem System ab. Das jeweilige Temperament prädestinierte seinen Träger in besonderer Weise für eine Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, die der vorherrschende Saft bedingte. Die Lepra beispielsweise wurde nach zeitgenössischer Auffassung durch ein Übermaß an schwarzer Galle verursacht. Die Natur der Krankheit galt in Anknüpfung an diesen Körpersaft als trocken und kalt. Erkrankten wurde entsprechend Übellaunigkeit und sogar Hinterhältigkeit nachgesagt. In dieser Zuschreibung spiegelt sich der schwermütige Melancholiker wider, der durch seine seelische Konstitution mehr als andere gefährdet war, an der Lepra zu erkranken.
Galens „Haus der Heilkunde“
Die Heilkunst wird nach galenischer Auffassung allein durch eine Theorie der Medizin zur Wissenschaft. Alle anderen Wissenschaften, vor allem Logik, Ethik und Physik, dienen der Medizin. Das sogenannte „Haus der Heilkunde“ hat drei Pfeiler: Physiologie, Phatologie & und Therapie. Die Therapie wiederum teilt sich in Diätetik, Pharmazeutik und Chirurgie. Obwohl nach der Lehre Galens nur eine einzige Wissenschaft vom menschlichen Körper existiert, besteht diese doch aus zwei Bereichen – der Gesundheitspflege (Hygiene) und der Heilkunde (Medizin). Nach dieser Ordnung muss der Arzt zuvorderst auf die Erhaltung der Gesundheit bedacht sein. Die Behandlung der Krankheiten ist der Gesunderhaltung nachgeordnet.
E
Physiologie und Pathologie
Die Physiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den natürlichen Lebensvorgängen (res naturales), insbesondere im Hinblick auf die Funktionen des Organismus. Der Physiologie gegenüber steht die Pathologie, die Lehre von den krankhaften Veränderungen im Organismus (res contra naturam). Sie befasst sich – in der Gegenwart als ein medizinisches Teilgebiet – vor allem mit den Ursachen (Ätiologie), mit der Entstehung und Entwicklung von Krankheiten sowie mit deren Beschreibung (Nosologie). Die bis ins 17. Jahrhundert hinein gültigen Theoriemodelle galenischer Physiologie und Pathologie unterscheiden sich erheblich von den Erkenntnissen der Gegenwartsmedizin. So war den mittelalterlichen Medizinern der Blutkreislauf noch unbekannt. Vielmehr stützten sie sich auf Galens Auffassung, wonach das Blut einem geschlossenen System von Wechselbewegungen gleich den Gezeiten des Meeres unterliegt.
b) Griechisch-römische Medizinalschriften des ersten nachchristlichen Jahrhunderts als Grundelemente mittelalterlicher Gesundheitspflege und Heilkunde
Plinius
Neben den Schriften des hippokratischen Corpus und Galens bildeten die heilkundlichen Abschnitte der groß angelegten Naturkunde des römischen Offiziers Caius Plinius Secundus, besser bekannt unter dem Namen Plinius der Ältere, sowie die umfangreiche Schrift über die Heilmittel des etwa zeitgleich wirkenden Militärarztes Pedanios Dioskurides einen wesentlichen theoretischen Baustein der mittelalterlichen Gesundheitspflege, Heil- und Arzneimittelkunde.
Um 23 / 24 n. Chr. als Sohn einer vermögenden, ritterständischen Familie im norditalienischen Novum Comum (Como) geboren, trat Plinius im Alter von 23 Jahren seinen Offiziersdienst in Germanien an. Nach dessen Ende im Jahre 52 zog er sich zunächst von der militärischen Laufbahn zurück, um diese 67 erneut aufzunehmen. Bis zu seinem Tod während der Evakuierung der durch den Ausbruch des Vesuv am 24. August 79 bedrohten Städte, führten ihn militärische Missionen nach Judäa, Syrien, Ägypten, Afrika, Gallien und Spanien. Daneben tat sich Plinius durch eine rege schriftstellerische Tätigkeit hervor. Zu seinen Werken zählen ebenso Abhandlungen über Kavallerietaktik und Kriegführung wie über Rhetorik und Grammatik. Die Schrift jedoch, die die größte Bedeutung und Verbreitung erlangte, war die so genannte Historia Naturalis, seine groß angelegte Naturgeschichte. Mehr als die Hälfte des 37 Bücher umfassenden Werkes widmete der Autor Beschreibungen von Heilmitteln aus dem Pflanzen- und Tierreich sowie deren Wirkung. Dabei griff er ebenso auf volksmedizinische wie magische Vorstellungen und – mit einiger Kritik versehen – die klassischen Theorien der griechischen Heilkunde zurück. Während des 4. Jahrhunderts entstand aus einem überarbeiteten Auszug der Schrift die so genannte Medicina Plinii, die in ihren drei Büchern Krankheiten und deren Behandlungen vom Kopfschmerz über die Gicht bis hin zu Fieber und Hautkrankheiten beschrieb. Im Laufe des 6. Jahrhunderts erfuhr diese offenbar zunächst bei Laien zur Selbstmedikation verwendete Schrift entscheidende Erweiterungen durch Einarbeitungen aus anderen medizinischen Werken, so etwa des um 605 in Rom gestorbenen byzantinischen Arztes Alexandros von Tralleis in einer gekürzten lateinischen Übersetzung und des als Autor einer Rezeptsammlung aus dem 1. Jahrhundert bekannten Scribonius Largus. Von nun an fand sie unter dem Namen Physica Plinii – irrtümlich auch als Plinius Valerianus – Verbreitung.
E
Pedanios Dioskurides, der aus dem kilikischen Anarzabos stammte, wirkte um die Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts als Militärarzt unter den Kaisern Claudius und Nero. Sein in griechischer Sprache entstandenes und in der lateinischen Übersetzung De materia medica betiteltes Hauptwerk nennt mehr als 1000 Arzneimittel pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs. Von Galen als richtungsweisende Grundlage anerkannt, fand die große Arzneimittelkunde des Dioskurides über rund 1600 Jahre in zahlreichen Übersetzungen, insbesondere ins Lateinische, Arabische, Hebräische und Syrische, sowie in verschiedenen Bearbeitungen und Paraphrasen Verbreitung. Erst die von dem schwedischen Botaniker und Mediziner Carl von Linné (1707 – 1778) aufgestellte botanische Nomenklatur verdrängte die klassische Arzneimittellehre des Dioskurides.
E
Diätetik
Diätetik ist die Lehre der gesunden Lebensordnung und -führung, die in der mittelalterlichen Medizin die theoretische Grundlage zu jeglicher Krankenversorgung bildete. Sie wird nach galenischer Auffassung gekennzeichnet durch ein Maßhalten, das der Gesundheitspflege (Hygiene) unmittelbar dient. Unabdingbar für den gesunden Lebenswandel oder die Wiederherstellung der Gesundheit ist ein rechtes Maß der so genannten sex res non naturales: Licht und Luft (lux et aer), Essen und Trinken (cibus et potus), Bewegung und Ruhe (motus et quies), Schlafen und Wachen (somnus et vigilia), Stoffwechsel (excreta et secreta) sowie Bewegungen des Gemüts (affectus animi).
Celsus
Ein weiterer Zeitgenosse Plinius’ des Älteren und Dioskurides’, Aulus Cornelius Celsus, hinterließ der späteren Gelehrtenwelt ebenfalls ein Werk unter dem Titel De medicina, das zwar schon im Mittelalter berühmt war, aber erst seit der Frührenaissance verstärkt rezipiert wurde. In seinen acht Büchern, entstanden vor dem Jahr 37, vermittelte der Autor nicht nur ein Bild der bisherigen Medizingeschichte, sondern behandelte ausführlich die Prinzipien gesunder Lebensführung und Krankheitsvorbeugung, innere Erkrankungen, Krankheitsbehandlungen und die Chirurgie.
Eine besondere Bedeutung kommt den acht Büchern des Celsus nicht zuletzt deshalb zu, weil mit ihnen die einzige vollständig erhaltene Medizinalschrift für die Zeit zwischen der Redaktion des hippokratischen Corpus und dem ersten nachchristlichen Jahrhundert und damit zugleich ein unentbehrliches Zeugnis für die Geschichte der hellenistischen Medizin vorliegt.