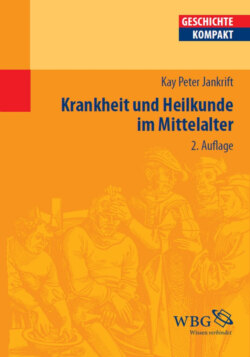Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Das Lorscher Arzneibuch. Ein heilkundliches Zeugnis aus der Karolingerzeit
ОглавлениеWährend des 8. Jahrhunderts, unter dem Einfluss der Karolinger, traten die von Benedikt und Cassiodor propagierten Leitlinien christlich-wissenschaftlicher Gesundheitspflege und Heilkunde unaufhaltsam ihren Triumphzug durch den christianisierten Teil des Abendlandes an. Im Jahre 743 wurde allen Klöstern innerhalb des karolingischen Herrschaftsbereiches die Annahme der Benediktsregel verordnet. Einige Jahrzehnte später verfügte Karl der Große im Rahmen seiner umfassenden Reformen des Verwaltungs- und Klosterwesens, dass der Unterricht an allen Kloster- und Kathedralschulen des Reiches künftig in Anlehnung an das Lehrmodell Cassiodors erfolgen sollte.
Einzigartiges Zeugnis
Als ein einzigartiges Zeugnis medizinischer Lehrinhalte und Wissensvermittlung des 8. Jahrhunderts präsentiert sich das so genannte Lorscher Arzneibuch, das sich heute in der Staatsbibliothek Bamberg befindet. Um das Jahr 795, zur Regierungszeit Karls des Großen abgefasst, gelangte das in der Abtei Lorsch entstandene Buch um die Jahrtausendwende in den Besitz Kaiser Ottos III. (994 – 1002). Dessen Nachfolger auf dem Thron, Heinrich II. (1002 – 1024), übergab es der Obhut der Bamberger Dombibliothek. Das Lorscher Arzneibuch umfasst Auszüge aus zahlreichen Schriften, vor allem aus den Werken verschiedener griechischer und römischer Autoren und einen breiten Kanon der während des 5. und 6. Jahrhunderts gebräuchlichen Arzneimittelrezepte. Zumeist zweisprachige Pflanzenglossare, die Hermeneumata, und Listen, die mögliche Substanzen als Ersatz für schwer beschaffbare oder teuere Drogen durch günstigere vor Ort erwerbbare nennen, schließen sich an. Ebenso findet sich eine Übersicht der angezeigten Maße und Gewichte. Einen weiteren Annex mit diätetischen Empfehlungen bildet der so genannte Anthimus-Brief. Besonderes Augenmerk verdient die programmatische, im Sinne Cassiodors gestaltete Rechtfertigung der Heilkunde, die den eigentlichen medizinischen Texten voransteht.
Q
Rechtfertigung der Heilkunde im Lorscher Arzneibuch
U. Stoll, Das „Lorscher Arzneibuch“, S. 49ff.
Ich bin genötigt, denen zu erwidern, die sagen, ich hätte dieses Buch unnützerweise geschrieben, indem sie behaupten, darin stehe nur wenig Wahres geschrieben. Jedoch wie taub hörte ich nicht auf ihre Worte (Ps 38,14), weil ich die Notlage der Hilfsbedürftigen für wichtiger ansah als den Tadel derer, die gegen mich tobten. Deshalb werde ich ihnen erwidern, nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit denen der Heiligen Schrift. Ist doch die menschliche Heilkunst durchaus nicht zu verschmähen, da feststeht, dass sie den göttlichen Büchern nicht unbekannt ist. Das bisher Gesagte werde als mit der Gunst des Herrn nunmehr fortgesetzt. […]
Wir nehmen aber wahr, dass nicht nur die Medizin als solche in den göttlichen Büchern erwähnt wird, sondern wir finden auch Namen von Arzneisorten, aus denen sie jeweils hergestellt wird. Denn bei Jeremias liest man: „Ist denn kein Balsam in Gilead oder ist kein Arzt dort? Weshalb also ist die Narbe nicht abgeheilt.“ (Jer 8,22) Und wiederum derselbe Prophet: „Wenn du dich“, sagt er, „auch mit Natron gesäubert hast und viel Seifenkraut angewendet hast, bist du doch befleckt.“ (Jer 2,22) […]
Denn aus drei Ursachen wird der Leib von Krankheit befallen: aus einer Sünde, aus einer Bewährungsprobe und aus einer Leidensanfälligkeit. Nur dieser letzteren kann menschliche Heilkunst abhelfen, jenen aber einzig und allein die Liebe der göttlichen Barmherzigkeit. Gleichwohl wurden auch sie bisweilen nicht ohne menschliche Beihilfe geheilt. Das legen wir besser dar, wenn wir einen Beleg bringen.
Aufgrund von Sünde nämlich wurde Saulus mit dem Verlust des Augenlichts geschlagen, wird jedoch nur geheilt durch die Handauflegung eines Menschen (Apg 9,8 – 18). […]
Diese Rechtfertigung verweist deutlich auf die trotz politischer Unterstützung in der klösterlichen Umwelt noch immer keineswegs selbstverständliche Verbreitung und praktische Anwendung von Heilwissen. Untermauert wird der durchgängig hippokratische, durch christliches Gedankengut überformte Geist des Kompendiums denn auch durch eine geschickte rhetorische Ablehnung volksmedizinisch-magischer Elemente.