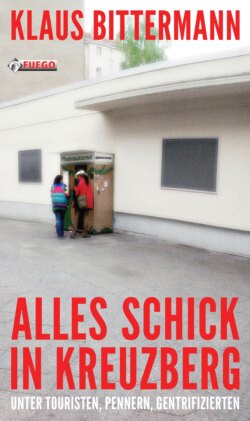Читать книгу Alles schick in Kreuzberg - Klaus Bittermann - Страница 18
Occupy Römer
ОглавлениеIch bin eingeladen zu einem »Künstleressen«. Das steht so auf der Einladungskarte. Es gibt dann aber gar keine Künstler, sondern Hühnchen mit Kartoffelgratin und Gemüse. Das schmeckt sehr gut, aber nach der großen Erwartung bin ich etwas enttäuscht, denn Künstler hatte ich noch nicht. Nicht zum Lunch jedenfalls. Höchstens am Hals.
Es sind aber gar keine Künstler da, sondern nur Leute, die mal in der Werbebranche gearbeitet haben und jetzt Fahrräder verkaufen, oder die seit dreißig Jahren dabei sind, ihre Dissertation zu schreiben und sehr langfristig Filmprojekte planen, von denen noch nie eins zustande gekommen ist. Und Oliver Maria Schmitt, der Bürgermeisterschaftskandidat von Frankfurt für die PARTEI, außerdem Autor des »Besten Romans aller Zeiten«, also ein Mensch, an dem die Hybris nicht einfach so vorbeigegangen ist.
Ich frage ihn, wie seine Chancen bei den kommenden Wahlen im März 2012 stehen. »Sehr gut«, sagt er, weil alle anderen Parteien nur Kandidaten hätten, die niemand kennt. Er würde sich an die Occupy-Bewegung dranhängen und mit der Losung »Occupy Römer« einen erfolgreichen Wahlkampf machen, weil er in seinen Reden dann sagen könne, was für alle nur eine Art politische Praxis sei, sei für ihn schon seit Jahren »gelebtes Leben«, denn seine Frau heiße mit Mädchennamen Römer. Leider wolle seine Frau nicht mitmachen, weshalb er für seinen Wahlkampf auf der Suche nach einer attraktiven, jungen blonden Frau sei, die man als Politiker nun mal an seiner Seite brauche, wenn man einen richtigen amerikanischen Wahlkampf machen wolle, und als Hunter S. Thompson von Frankfurt käme für ihn nun mal nichts anderes in Frage. Ob ich ihm nicht jemand für die Zeit des Wahlkampfs zur Verfügung stellen könne. Danach lasse man das Ganze als schmutzigen Wahlkampf durch Bild auffliegen, und »seine« Wahlkampffrau könne anschließend darüber ein Buch schreiben mit dem Titel »Ich war die Frau des Frankfurter Bürgermeisterschaftskandidaten«.
Ich frage ihn, ob ich das nicht machen könne. Ich würde mir auch die Beine rasieren. »Ich weiß deinen guten Willen zu schätzen«, sagt Schmitt, »aber ich sagte ›jung, attraktiv und blond‹.«
Dann überlegen wir weiter, und dann sage ich wieder, dass ich dafür sogar meine Beine rasieren würde, und Oliver Maria Schmitt sagt wieder, dass er meinen guten Willen zu schätzen wisse. Das geht eine ganze Weile so. Da uns einfach niemand sonst einfällt, der den Job übernehmen würde, trinken wir noch etwas.
Dann gehe ich auf die Straße, winke ein Taxi heran und steige hinten ein. Eine junge, attraktive und blonde Frau in sehr kurzem Minirock und roten hochhackigen Lackschuhen steigt vorne ein. Ich sage, das Taxi sei schon besetzt, und zwar mit mir. Sie möchte trotzdem mitfahren. Ich sage, sie wisse doch gar nicht, wohin ich wolle. Das sei ihr egal, sagt sie. Ich lasse sie mitfahren. Ich bin ja kein Unmensch, und schon gar nicht zu so später Stunde. Vielleicht kommt sie ja als Frankfurter Bürgermeisterschaftskandidatengattin in Frage, aber als ich versuche, ihr den Fall darzulegen, reagiert sie mit keinem einzigen Wort. Als wir dann zusammen aussteigen und ich die schweigsame blonde, attraktive und junge Frau frage, ob ich ihr helfen könne, schüttelt sie nur ausdruckslos den Kopf und stöckelt in die Nacht.